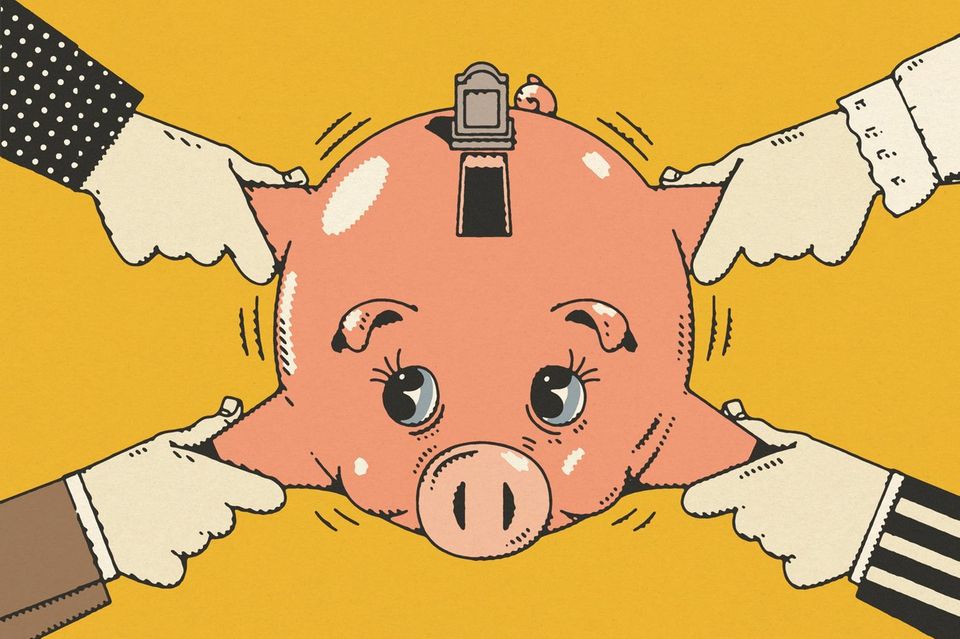Herr Brzeski, die deutsche Wirtschaftsleistung ist zuletzt geschrumpft. Konjunkturindikatoren wie der Ifo-Index für die Stimmung in Unternehmen oder der GfK-Index für den Konsum zeigen ebenfalls nach unten. Wenn Sie eine Schulnote vergeben müssten, wie schlecht ist die Lage der deutschen Wirtschaft?
CARSTEN BRZESKI: Wir sind jetzt wieder bei einer Vier angekommen. Im Frühjahr herrschte ja noch Aufbruchsstimmung, ein bisschen Optimismus. Wir hatten überraschenderweise Wachstum im ersten Quartal, viele Indikatoren zeigten nach oben. Doch zuletzt sehen wir, etwa ab Mai, wie die Stimmung sich wieder dreht. Der Ifo-Index beispielsweise ist nun schon zum vierten Mal hintereinander gesunken. Seit Mai geht der Trend der Konjunktur wieder nach unten.
Was steckt dahinter? Was hat sich seit dem Frühjahr geändert?
Erst einmal ist es ein Realitätscheck. Der Optimismus aus dem Frühjahr war leider überzogen. Viele Leute wollten gerne, dass es besser wird. Insofern steckte Psychologie dahinter. Außerdem steckte inhaltlich die Hoffnung dahinter, die Weltwirtschaft – vor allem die chinesische Wirtschaft – könnte vielleicht doch ein bisschen besser laufen, als zum Jahreswechsel befürchtet worden war. Auch die US-Wirtschaft kam gut in Schwung. In Deutschland lief beispielsweise der Bausektor ein bisschen besser als befürchtet.
Was ist dann passiert?
Diese optimistische Analyse war sehr kurzsichtig. Denn es war die ganze Zeit abzusehen, dass sich die Konjunktur abkühlen würde. Es war auch klar, dass das, was wir an Erholung im Bausektor gesehen haben, sehr kurzfristig war, bedingt durch das Ende des Winters. Vor allem aber hatten im Frühjahr noch nicht alle verstanden, dass wir nicht nur konjunkturelle, sondern auch strukturelle Probleme in unserer Volkswirtschaft haben. Es herrschte noch immer die Idee vor, die Entwicklungen seien alle Teil des Konjunkturzyklus und es müsste ja irgendwann wieder besser werden.
Was sind das für strukturelle Faktoren, von denen Sie sprechen?
Was viele nicht gemerkt haben, ist, dass sich zum Beispiel die Rolle Chinas strukturell verändert. China ist zu einem Systemrivalen geworden. Unsere Exportwirtschaft profitiert nicht mehr so stark von China, egal was da konjunkturell passiert. Und auch von der US-Konjunktur profitieren wir nicht mehr in dem Maße wie in der Vergangenheit, wegen des zunehmenden Protektionismus dort. Unterschätzt haben die Optimisten auch die Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung. Geopolitische Unsicherheit kennen wir schon seit ein paar Jahren, aber nun kommt auch noch die politische Unsicherheit im Innern dazu, mangelnde Planungssicherheit bei Unternehmen und bei den Konsumenten. Das hat auch mit der Politik der Ampelkoalition - etwa dem Hin und Her beim Heizungsgesetz - zu tun. Die Konsumenten sind trotz steigender Einkommen vorsichtig geworden, etwa mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen steigt, ebenso die der Insolvenzen. Das ist alles noch nicht dramatisch, aber die Menschen spüren das und werden vorsichtiger beim Konsum.
Das ist insgesamt ein ziemlich düsteres Bild, das Sie zeichnen. Wie geht es nun weiter? Steuern wir auf eine tiefe Wirtschaftskrise zu?
Wir befinden uns in einer Krise. Aber diese Krise ist anders als die, die wir bisher kennen. Wir stecken nicht in einer Rezession. Ob das Wachstum einmal minus 0,1 Prozent oder plus 0,1 beträgt, das ist ziemlich egal. Wichtig ist: Wenn wir uns die Größe unserer Volkswirtschaft anschauen, sind wir aktuell ungefähr auf dem Stand von vor der Pandemie. Wir sind also im Schnitt über vier Jahre lang nicht gewachsen. Wir befinden uns in einer Stagnation, vergleichbar mit dem, was Japan in den vergangenen Jahren erlebt hat. Eine lange stagnierende Wirtschaft bekommt Probleme, die wir bisher nicht kannten. Sie bekommt Verteilungsprobleme zwischen Arm und Reich, zwischen Alt und Jung. Das sind strukturelle Veränderungen, die wir teils schon spüren und die zunehmen werden.
Gibt es wirklich keine konjunkturellen Hoffnungszeichen? Die Realeinkommen steigen beispielsweise so stark wie schon lange nicht mehr. Der Arbeitsmarkt steht trotz einer gewissen Verschlechterung gut da. Das könnte doch ein Fundament sein, um die Konjunktur in Gang zu bringen.
Es gibt zwei Joker für die Konjunktur. Der erste sind die Verbraucher, deren Einkommen steigt. Der zweite sind die Unternehmen, deren Lagerbestände auf einem untypischen, enorm hohen Niveau sind. Normalerweise müssten diese Bestände abgebaut werden, und dann wird wieder produziert. Das könnte jeden Monat passieren. Dann müssten nur noch etwas mehr Aufträge wieder reinkommen und die Industrieproduktion sollte wieder - ein bisschen - in Schwung kommen. Allerdings waren das auch unsere Joker für die erste Jahreshälfte - und sie haben leider nicht gezogen. Was die Konsumenten betrifft, darf man nicht vergessen, dass die auf etliche Jahre mit Kaufkraftverlusten aufgrund der hohen Inflation zurückschauen. Die Leute bauen erst mal wieder finanzielle Puffer auf, bevor sie ihr Geld ausgeben. Ich will nicht alles schlechtreden: Stagnation bedeutet einerseits nicht, dass jetzt alles den Bach runtergeht. Wir werden auch wieder irgendwann etwas Wachstum haben. Aber ein Wirtschaftswunder 3.0 werden wir in den nächsten Jahren sicher nicht feiern können.
Die Bundesregierung bringt doch regelmäßig Wachstumspakete, Wachstumsturbos und so weiter auf den Weg, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Oder sind wir diesen strukturellen Entwicklungen etwa in China und den USA einfach schutzlos ausgeliefert?
Diese Pakete der Ampel gehen schon in die richtige Richtung. Aber häufig fehlt diesem Turbo ausreichend Energie, sprich Geld. Diese Pakete sind zu klein, um das Wachstum wirklich zu beeinflussen. Die Rolle guter Wirtschaftspolitik ist vor allem, langfristig Sicherheit und Stabilität zu geben. Daran hapert es zum Beispiel bei der Energiepolitik. Das Problem aktuell ist nicht, dass die Energiepreise zu hoch sind, sondern dass die Unternehmen keine Planungssicherheit haben. Sie wissen nicht, auf welchem Niveau die Preise in den kommenden Jahren sein werden. Da wir in einer langfristigen Stagnation und nicht in einer kurzfristigen Rezession sind, hilft traditionelle Konjunkturpolitik nicht weiter. Die könnte höchstens Strohfeuer entfachen. Was wir brauchen, sind langfristige Investitionen in die Digitalisierung, in die Infrastruktur, in die Bildung. Wir brauchen eine langfristige wirtschaftspolitische Strategie, statt der einzelnen Mosaiksteine, hier mal eine Subvention, dort mal Milliarden für ein Halbleiterwerk. Und diese Strategie muss dann natürlich entsprechen kommuniziert werden. Denn Wirtschaft ist bekanntlich zu 50 Prozent Psychologie. So könnte eine Aufbruchstimmung entstehen, die uns wieder rausholt aus dieser Stagnation.
Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.