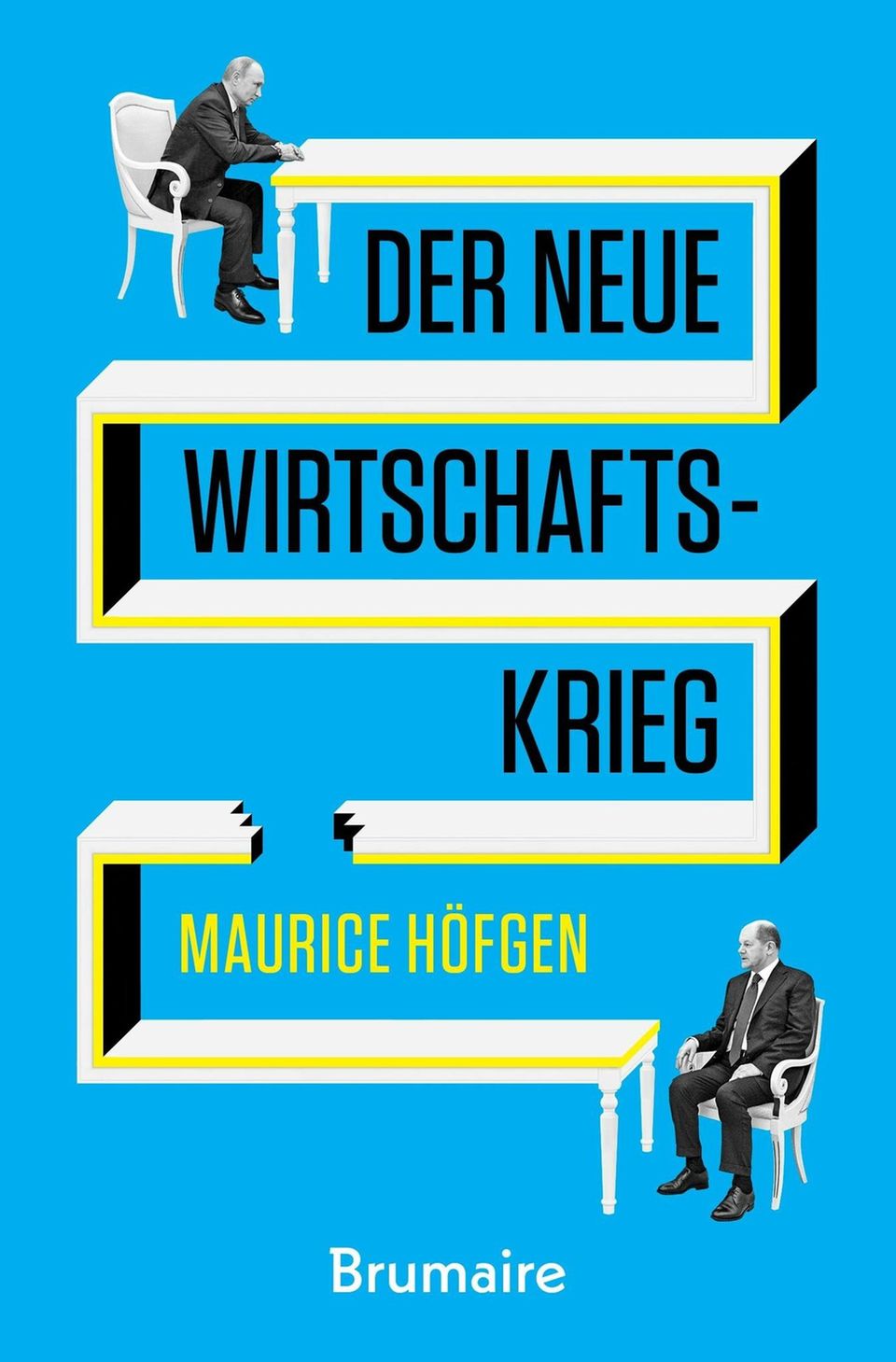Herr Höfgen, Sie sind einer der prominenteren Vertreter der umstrittenen Modern Monetary Theory (MMT) in Deutschland. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, in dem es um die Wirtschaftssanktionen gegen Russland geht. Darin spielt MMT kaum eine Rolle. Warum?
MAURICE HÖFGEN: Ja, es stimmt, dass MMT nur eine Nebenrolle spielt. Tatsächlich hilft MMT aber, um die Wirkung von Finanzsanktionen zu verstehen.
Das müssen Sie erklären…
Starten wir bei den Energiesanktionen, Stichwort: Gasembargo. Diese Debatte haben wir monatelang geführt und es ging immer darum: Verzichten wir auf russisches Gas, um Putins Krieg nicht weiter zu finanzieren? Das ist aus MMT-Sicht schräg, denn Putin finanziert seinen Krieg in Rubel, nicht in Euro. Und Rubel kann er theoretisch so viele drucken, wie er will.
Unterschätzen Sie da nicht da Abhängigkeit von Importen? Die muss Russland doch in ausländischen Währungen bezahlen.
Für die reine Kriegsführung ist Russland leider nicht sonderlich stark auf Importe angewiesen. Russland ist ein großer Waffenproduzent, hat eigene Soldaten und große Rohstoffreserven. Das kann Russland alles in Rubel bezahlen und ist daher sehr autark. Die gesamte Wirtschaft ist aber nicht autark. Russland ist zum Beispiel von Technologieimporten abhängig und hier können wir sie auch treffen. Die Sanktionen schaden also schon der russischen Wirtschaft, aber sie bewirken leider nicht, dass Putin das Geld für seinen Krieg ausgeht.
In Panzern und anderen modernen Artilleriegeschützen steckt doch westliche Technologie; es gab Berichte, dass die Waffenproduktion in Russland wegen der Sanktionen stockt. Ist Russland wirklich so autark, wie sie sagen?
Auf sehr lange Sicht sind sie natürlich auf solche Importe angewiesen oder müssen sich Lösungen einfallen lassen. Aber nicht kurzfristig. Das ist trotzdem ein gutes Beispiel, wie Sanktionen funktionieren können: Exportverbote von Kriegstechnologie, beispielsweise Antennen oder Navigationssysteme, sind viel zielführender als ein Angriff auf Putins Kasse.
Welche Sanktionen gegen Russland halten Sie für sinnvoll, und welche weniger?
Die Sanktionen gegen russische Banken treffen das Kreditgeschäft, die Exportverbote das Handelsgeschäft, die Oligarchensanktion Putins Machtzentrum. Das ist sinnvoll. Die Energiesanktionen erfüllen aus meiner Sicht nicht ihren Zweck.
Wirklich? Die meisten Experten sehen das doch komplett anders. Russland muss zum Beispiel enorme Abschläge auf sein Öl und Gas hinnehmen, die Devisenzuflüsse werden dauerhaft niedriger sein. Langfristig werden sich also die Schäden zeigen. Ist Ihre These nicht längst widerlegt?
Nein, das stimmt auch nur in Teilen. Bisher sind die Devisenzuflüsse sogar größer, wegen der hohen Preise. Mit der Zeit werden sich zudem viele Warenströme neu ordnen. Auch wenn Europa kein Gas und Öl mehr abnimmt – China, Indien und Co. werden einspringen. Damit binden wir nebenbei viele ärmere Länder an Russland, die ihr Öl jetzt dort vergünstigt einkaufen. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Und nicht zuletzt ändert das eben wenig an der Finanzierung der Kriegswirtschaft. Dafür muss Russland uns keine Energie verkaufen. Exportverbote sind hier deutlich zielführender.
Warum?
Exportverbote und die tausendfache Abwanderung von westlichen Firmen treffen Putins Wirtschaft deutlich schneller und zielgenauer. Das ist in den nackten Wirtschaftsdaten heute noch verschleiert, weil das BIP steigt, wenn Putin Soldaten bezahlt und in seine Kriegswirtschaft investiert. Das ist aber nichts, was Wohlstand schafft und die russische Volkswirtschaft voranbringt. Im Gegenteil: Das ist Verschwendung von Geld und Ressourcen. Dazu kommen noch die Sanktionen gegen russische Oligarchen.
Denen haben Sie ein komplettes Kapitel gewidmet…
Ja, und die Sanktionen sind an sich auch sehr sinnvoll. Sie treffen zielgenau die Personen, die Putins Machtregime stützen. Vor allem in Deutschland gibt es aber einige Probleme, da Ermittler nicht wissen, wem was hier gehört. Deswegen sind die Oligarchen-Sanktionen leider nicht so scharf, wie sie eigentlich sein könnten.
Bewegt man sich in die Facebook-Kommentarspalten, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Sanktionen uns viel mehr schaden als Russland. Was halten Sie davon?
Das ist eindeutig falsch. Russland schaden die Sanktionen deutlich stärker als uns. Klar ist aber auch, dass am Ende beide leiden und sogar noch Drittländer hinzuziehen, zum Beispiel in Afrika. Wie gesagt, ich halte ökonomisch nicht viel von den Energiesanktionen.
Einige Ökonomen um den in den USA forschenden Rudi Bachmann haben bereits im März etwas anderes prognostiziert und sich für ein Energieembargo ausgesprochen…
Ja, das muss man aber im Kontext sehen. Damals waren die Gasspeicher leer und Russland hat uns noch beliefert. Das waren die Annahmen. Jetzt hat Putin selbst entschieden, die Gaslieferungen einzustellen. Somit ist Studie einfach überholt.
Sie und Herr Bachmann sind zwei der prägenden Köpfe im Ökonomenstreit auf Twitter. Warum zoffen sie sich – und was macht das mit Ihnen?
Erstmal freue ich mich riesig über den tausendfachen Zulauf von jungen Leuten, die sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren. Das ist ein Wert für sich. Deswegen macht es mir auch nicht viel aus, wenn etablierte Professoren aus Amerika im Internet poltern. Was mich mehr ärgert ist, dass die Diskussionen meistens oberflächlich und destruktiv sind. Eine vernünftige Debatte wäre sicher spannender. Dafür scheint Twitter aber nicht der richtige Ort zu sein.
Sie teilen doch selbst gut aus.
Ja natürlich, das gehört dazu. Solange alles im Rahmen bleibt, finde ich das auch in Ordnung. Ich kann auch gut einstecken. Solche Zoffereien sind vielleicht kurz unterhaltsam, aber für mich nicht wichtig. Meine Erfahrung ist ohnehin: Offen für Neues sind die Jüngeren, nicht die Älteren. Mehr noch: immer mehr Studenten sind von der stockkonservativen VWL an den Unis genervt. Rudi Bachmanns Verhalten macht das nicht besser. Er betreibt Gatekeeping und vermittelt, dass nur etablierte Professoren legitime Beiträge zur Debatte beisteuern könnten. Dabei baut Twitter eigentlich genau solche Hürden ab.
Gibt es denn auch Ökonomen, für die Sie eine Empfehlung auf Twitter aussprechen?
Ja, auf jeden Fall. Ich lese Achim Truger, Sebastian Dullien und MMT-Ikone Stephanie Kelton genauso wie Lars Feld, Veronika Grimm oder Clemens Fuest. Ganz verschiedene Denkschulen also. Und dass diese Denkschulen sich untereinander streiten, ist normal und bringt die Wissenschaft voran. Es kommt immer auf den Umgangstons an.
In ihrem aktuellen Buch fordern Sie auch eine Art Gaspreisbremse, um die Inflation zu senken. Die ist in der Zwischenzeit gekommen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, die Gaspreisbremse ist ein Fiebersenker. Die Wirtschaft hat Fieber, das sieht man an der hohen Inflationsrate, und die Gaspreisbremse lindert die Symptome. An der Ursache ändert sie allerdings nichts. Dafür müsste man in zusätzliches Angebot investieren. Das macht die Bundesregierung auch, zum Beispiel mit den neuen LNG-Terminals oder mit der Windkraft.
Die 30 Mrd. Euro für die Gas- und Strompreisbremse sind also gut angelegtes Geld?
Ja. Man hätte sich zwar ein paar Milliarden sparen können, indem man eine Obergrenze für Superreiche einzieht, am Ende macht das aber nicht viel aus. Wichtig ist, dass die Preisschocks gelindert werden. Das ist übrigens auch gut für die Wirtschaft. Wir erleben gerade, dass aus der Energiekrise eine Nachfragekrise wird, weil die Menschen so viel für Benzin und Gas zahlen müssen. Am Ende gehen davon Bäckereien oder Kinos pleite, weil die Menschen hierfür weniger Geld ausgeben können – obwohl diese Läden eigentlich kerngesund sind.
Wo kann uns die Modern Monetary Theory bei der Inflationsbekämpfung helfen? Deren Kernthese lautet ja, dass man dem System unendlich viel Geld zuführen kann. Ändern würde das zunächst einmal nichts. Der ökonomische Mainstream sieht das komplett anders und sagt, es gebe einen positiven Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation.
Zunächst einmal kann sie uns bei der Analyse helfen. Wir erleben einen Angebotsschock auf den Energiemärkten. Das ist unstrittig. Einen Angebotsschock kann die Zentralbank aber nicht bekämpfen. Höhere Zinsen sind hier nicht nur sinnlos, sie sind sogar kontraproduktiv.
Hans-Werner Sinn würde spätestens jetzt Schnappatmung bekommen…
Ja, und Bundesbankpräsident Joachim Nagel wahrscheinlich auch. Aber höhere Zinsen verteuern nun einmal Investitionen. Wir brauchen aber gerade Investitionen, um aus dem Angebotsschock rauszukommen.
Die Zentralbank und die Bundesregierung versuchen es aktuell mit einem Mittelweg. Einerseits soll die Nachfrage durch die höheren Zinsen sinken, auf der anderen Seite investiert der Staat massiv ins Angebot. Ist das nicht der pragmatischere Weg, beide Seiten in Bewegung zu bringen?
Mir fällt es schwer, Herrn Lindner Pragmatismus zu attestieren. Noch eine Woche vor dem „Doppelwumms“ hat er in einem Gastbeitrag geschrieben, dass wir Inflation nicht mit Schulden bekämpfen können. Das ist natürlich ein Witz, denn Preisbremsen senken die Inflationsrate. Und für die Gas- und Strompreisbremse macht er jetzt Schulden. Da ist er also etwas unehrlich. Trotzdem sehe ich, dass Herr Lindner seine Meinung geändert hat. Über den Sommer hat er gemerkt, dass wir Schulden machen müssen, damit die Wirtschaft nicht zu stark abschmiert. Herr Lindner wollte kein Wirtschaftscrasher werden. Der Weg jetzt ist richtig, die Geschwindigkeit könnte aber noch höher sein. Die Schuldenbremse passt einfach nicht in die Zeit. Da ist es auch egal, ob er die Maßnahmen in Schattenhaushalten versteckt.
Welche Maßnahmen schlagen Sie sonst noch vor, um die Inflation abzudämpfen?
Es ist schon viel umgesetzt worden. Was ich noch vermisse, ist eine Entlastung bei Grundnahrungsmitteln. Die EU erlaubt hier, die Mehrwertsteuer zu streichen. Man könnte also Brot und Butter per Federstrich sieben Prozent günstiger machen. Das Gleiche könnte man auch noch für Bahnfahrten machen. Das würde die Verkehrswende beschleunigen.