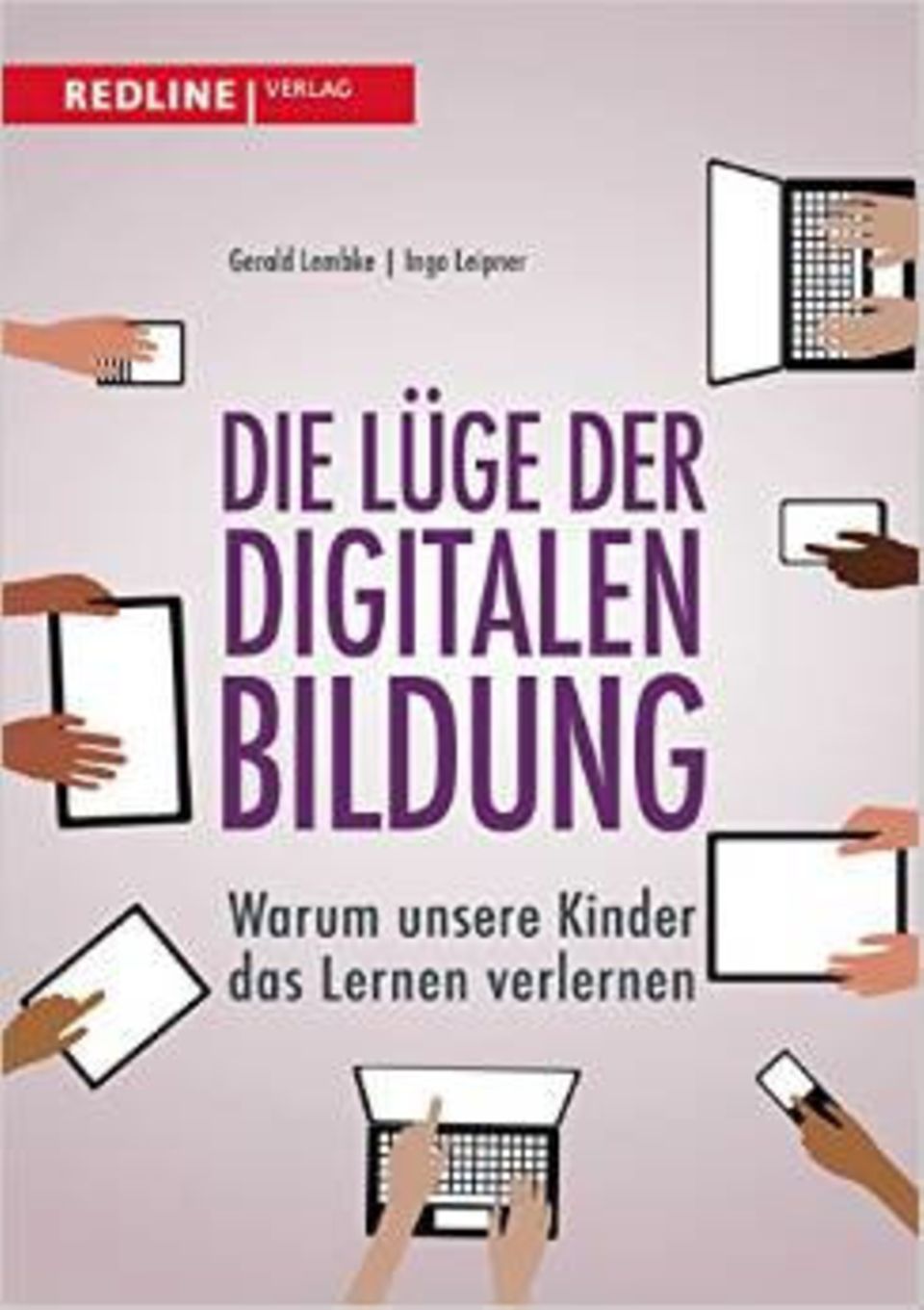Ingo Leipner ist Wirtschaftsjournalist. Er gründete 2005 die Textagentur EcoWords. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Unternehmenskultur, Ökonomie/Ökologie und Erneuerbare Energie. Kritisch verfolgt er die digitale Transformation von Bildung und Wirtschaft. Professor Gerald Lembke ist Studiengangsleiter für Digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und Präsident des Bundesverbandes für Medien und Marketing (BVMM).
Im Bundestag beschimpft zu werden … gibt´s Schöneres für Buchautoren? Der CDU-MdB Sven Vollmering warnte Anfang Juli, „panikmachenden Leuten hinterherzulaufen, die von der Lüge der digitalen Bildung sprechen“. Damit konnte er nur unser Buch „Die Lüge der digitalen Bildung“ meinen, mit dem wir bewusst einen Kontrapunkt zum üblichen Digital-Diskurs setzen. Und das mit gutem Grund, wenn wir uns die Reaktionen auf die aktuelle „ICILS 2013“-Studie ansehen. Thema: Computer- und Internetkenntnisse bei 13- bis 14-jährigen Schülern (8. Klasse).
Birgit Eickelmann leitete die deutsche „ICILS 2013“-Studie, sie sagte der FAZ: „Wir wissen, dass ein Drittel der Achtklässler gerade einmal in der Lage ist, einen Link anzuklicken, allenfalls noch, eine Datei zu speichern. Da kann man ja nicht von einem kompetenten Umgang mit neuen Technologien sprechen.“ Entsprechend kräftig war das Rauschen im Blätterwald: „Peinliches Studienergebnis für Deutschland“; „Ein Drittel der Schüler ist abgehängt“ oder „Deutschland ist digital nur im Mittelfeld? Kein Wunder!“
Und? Wer macht hier Panik? Uns erstaunte die Studie in keiner Weise, denn die Entwicklungspsychologie sagt ganz klar: Das kindliche Gehirn ist eine Großbaustelle, bis zum Alter von 12 bis 14 Jahren – und weit darüber hinaus. Allmählich reifen kognitive Funktionen, allmählich werden Kinder erwachsen und lernen, über sich und die Welt nachzudenken. Das haben wir von Jean Piaget (1896-1980) gelernt, der ein grundlegendes Modell der kognitiven Entwicklung von Kindern entworfen hat.
„Digital Natives“ sind ein Mythos
Wer 13- bis 14-jährige Schüler für Tests vor Rechner setzt, braucht sich über die ernüchternden Resultate nicht zu wundern. Denn die vielbeschworenen „Digital Natives“ sind ein Mythos, obwohl sie selbstverständlich mit Internet und Smartphone aufwachsen. Dazu die „KIM Studie 2012“: „Medienkompetenz umfasst zweifellos weit mehr als die technische Bedienfertigkeit. (…) Es ist also ein Trugschluss, dass Kinder die im Medienzeitalter aufwachsen, diese Technik auch automatisch bedienen können.“
Vor diesem Hintergrund ertönt immer wieder die Forderung nach „früher Medienkompetenz“! Vollmering, Bitkom und andere ziehen aus den mittelmäßigen „ICILS 2013“-Ergebnissen den Schluss: Wir müssen Bildung gründlich digitalisieren, damit Deutschland im internationalen Wettbewerb nicht zurückfällt. O-Ton Vollmering im Bundestag: „Die internationale ICILS-Computerstudie (…) hat den seit Jahren gefühlt vorhandenen Nachholbedarf bei der Digitalen Bildung empirisch belegt. Es wird daher Zeit, dass wir den Aufholprozess endlich beginnen!“
Und der IT-Verband Bitkom gab schon 2014 die Marschrichtung vor: „Jeder Schüler soll ein mobiles Endgerät wie einen Tablet Computer oder ein Notebook zur Verfügung haben, in jedes Klassenzimmer gehört ein Smartboard.“
Diesen Forderungen setzen wir die These entgegen: „Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter“. Gerade in Kindergärten und Grundschulen haben digitale Medien nichts verloren, weil Kinder eine starke Verwurzelung in der Realität brauchen, bevor sie sich in virtuelle Abenteuer stürzen.
Greifbare Erfahrungen aus der realen Welt
Ihr Gehirn entwickelt sich besser, wenn kein Tablet oder Smartphone reale Welterfahrung verhindert, etwa in der Zeit bis zur Pubertät. Daher wollen wir digital-freie Oasen in Kindergärten und Grundschulen, weil sich dort Bildungsinhalte in einem öffentlichen Diskurs gestalten lassen. Wie Eltern in dieser Frage mit ihren Kindern umgehen, liegt in deren Verantwortung.
Wichtig: Senso-motorische Erfahrungen sind für Kinder die notwendige Grundlage, um Denkstrukturen aufzubauen, die bei einer gesunden Entwicklung im Gehirn entstehen müssen. Gönnen wir ihnen doch ihre Kindheit - mit Toben, Purzeln, Malen und Singen. Das meint die Neurobiologin Gertraud Teuchert-Noodt, wenn sie einen „kognitiven Rucksack“ fordert, der gut gefüllt sein soll – mit greifbaren Erfahrungen aus der realen Welt. Und genau solche Erlebnisse gibt es vor keinem Bildschirm, der immer mehr Lebenszeit der Kinder frisst. Auch die Medienpädagogin Paula Bleckmann zeigt in ihrem lesenswerten Buch „Medienmündig“, wie Familien viel Freiheit und Lebensfreude gewinnen – ganz ohne Bildschirm-Medien.
Welche Kompetenzen sind nötig, um souverän mit digitalen Medien umzugehen? Unsere Antwort: Konzentrations- und Kritikfähigkeit sowie eine produktive Kompetenz beim Erstellen von Medieninhalten. Das sind hohe Anforderungen, denen mancher Erwachsener nicht gewachsen ist. Daher lautet unser Motto: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans viel besser! Oder hat jemand schon erlebt, wie Sechsjährige eine kritische Quellenanalyse durchführen?
Schüler müssen erst das Denken lernen
Konzentrationsfähigkeit: Ihr natürlicher Feind ist das Multitasking. Es führt zu flachen Erkenntnissen, reduziert auf ein Comic-Format. Oberflächlich wird die Wahrnehmung der Welt – und die Wahrnehmung der eigenen Arbeit. Dagegen sollten wir die Kunst der Konzentration erlernen. Nötig dabei: die Fähigkeit zur Selbstreflektion, die sich langsam ab der Pubertät entwickelt. Im Kindergarten geht es um basale Dinge wie Impulskontrolle, die digitale Medien eher untergraben, statt sie zu fördern.
Kritikfähigkeit: Wer Denkgewohnheiten in Frage stellt, kommt auch zu differenzierten Ergebnisse bei Internet-Recherchen. Der Blick für geeignete Quellen entscheidet – und nicht das blitzschnelle Eintippen von Suchbegriffen. Doch richtiges Denken lernen Kinder etwa ab 12 Jahren. Da ist es nutzlos, in Kindergärten Tablets auszuteilen.
Produktive Kompetenzen: Oft schlägt gerade in SchulWikis die Form den Inhalt. Es reicht nicht aus, mit Hilfe von „copy & paste“ fehlerhafte Beiträge in ein Content-Management-System hochzuladen. Dagegen verstehen wir unter produktiver Kompetenz die Fähigkeit, Texte, Bilder und Videos in einer hohen Qualität zu produzieren. Es kommt nicht auf den Upload ins SchulWiki an: Der Prozess davor entscheidet, ob Schüler Medienkompetenz erwerben, wozu sie in ihrer kognitiven Entwicklung reif genug sein müssen.
Fazit: Im Moment beginnt der Tanz um die goldene Medienkompetenz. Immer kreisen die Tänzer um die Frage: Wie werden unsere Kinder fit fürs digitale Zeitalter? Wir geben eine ganz altmodische Antwort: Schüler müssen erst das Denken lernen, um produktiv mit digitalen Medien umzugehen. Die Forderung nach „früher Medienkompetenz“ ist technik- und ökonomiegetrieben – sie dient nicht unseren Kindern, sondern nur den wirtschaftlichen Interessen der IT-Industrie.