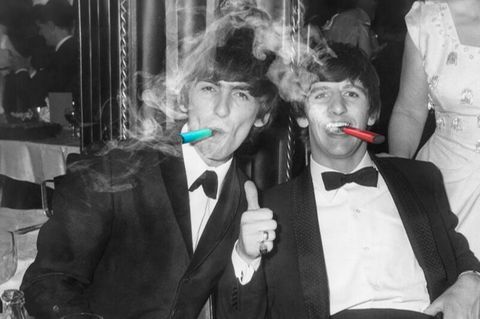Scheiden tut weh. Seitdem die Briten im Juni 2016 mit 52 Prozent zu 48 Prozent dafür gestimmt haben, der Europäischen Union den Rücken zu kehren, streiten sie sich darüber, welchen Brexit sie denn gerne hätten. Eine mehrheitsfähige Lösung ist nirgendwo in Sicht. Vor dem Brexit-Votum hatten sie es versäumt, sich ernsthaft über das Leben außerhalb des größten gemeinsamen Marktes der Welt Gedanken zu machen. Stattdessen waren manche Wähler auf Politclowns wie Boris Johnson hereingefallen, dessen Zahlen zum angeblichen Brexit-Gewinn sich als ebenso wirr wie seine blonde Haarpracht herausgestellt haben.
Die Briten sitzen in der selbst gestellten Falle. Die konservative Regierung kann und will den Brexit-Beschluss nicht überdenken. Die Konservativen werden kein neues Referendum ansetzen. Es würde ihre Partei zerreißen. Der halbgare „Chequers“-Plan, den sich Premierministerin Theresa May ausgedacht hat, wird von bis zu 80 konservativen Abgeordneten als zu weich abgelehnt. Auch die Europäische Union hat den Plan bereits abgelehnt, wonach Großbritannien in einer Art Zollverbund mit der EU verbleiben soll, dabei aber eigene Zollsätze erheben darf. Der Plan würde, so die EU, die einheitliche Zollunion der EU untergraben und wäre in der Praxis nicht umsetzbar.
Sofern May den bis Mittwoch dauernden Parteitag der Konservativen übersteht, was wahrscheinlich aber nicht ganz sicher ist, wird sie sich kurz danach entscheiden müssen: Nimmt sie eines der Angebote an, die die große EU dem kleineren Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit unterbreitet hat - oder nimmt sie einen ungeordneten Brexit in Kauf.
Drei Optionen liegen auf dem Tisch
Als Verbund von 27 souveränen Staaten, die sich oftmals nur schwer einigen können, neigt die EU27 dazu, sich an bekannten Mustern zu orientieren, die es bereits für den wirtschaftlichen Austausch mit befreundeten Nicht-Mitgliedern gibt. Sie hat deshalb den Briten die Wahl gelassen, nach einer Übergangsperiode von April 2019 bis Ende 2020 entweder ähnlich wie Norwegen im Binnenmarkt mit allen dazugehörigen Pflichten zu verbleiben, ähnlich wie die Türkei eine Zollunion mit der EU einzugehen oder ein weitreichendes Freihandelsabkommen wie mit Kanada abzuschließen.
Die Zeit wird knapp. Bis zu einem EU-Sondergipfel am 17. - 18. November soll das Ergebnis stehen, damit das Ergebnis bis zum formalen Brexit am 29. März 2019 noch ratifiziert werden kann. Notfalls könnten sich die Verhandlungen bis Anfang 2019 hinziehen. Aber viel länger kann die EU kaum warten, die zudem im Mai 2019 ein neues Parlament wählt und nicht den Wahlkampf mit diesem Thema belasten möchte.
Die Karten liegen weitgehend auf dem Tisch. Ein weiteres Hinauszögern der britischen Entscheidung wird Theresa May innenpolitisch kaum noch Luft verschaffen. Sie wird sich dazu durchringen müssen, eines der EU-Angebote in vermutlich leicht abgewandelter Form anzunehmen. Für keine Lösung wird sie sich die volle Unterstützung ihrer Partei sichern können. Auch ein harter Brexit ohne Abkommen mit der EU könnte zu einem Aufstand im Parlament führen.
Die schwierige (Nord-)Irland-Frage
Es steht nahezu Spitz auf Knopf. Wir sehen eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass May und die EU noch ein Abkommen verhandeln können. Um die Chancen zu erhöhen, dass die Briten das Abkommen ratifizieren, wird man viele Einzelentscheidungen über den künftigen Handel wohl auf weitere Verhandlungen während der 21-monatigen Übergangsphase bis Ende 2020 vertagen. Eine eher allgemeine Grundsatzerklärung können dann sowohl die Anhänger einer engen Bindung an den EU-Binnenmarkt als auch die Befürworter eines klaren Schnitts mit der EU in ihrem Sinne interpretieren. In späteren Detailgesprächen könne man das Ergebnis noch entsprechend hinbiegen.
Gerade bei einem eher vagen Grundsatzabkommen wird die EU aber wohl auf einer klaren Garantie bestehen, dass unabhängig vom späteren Gesamtergebnis zwischen Nord- und Südirland keinesfalls eine harte Zollgrenze mit Schlagbäumen entstehen darf. Sollte es keine andere Lösung geben, sollten die Briten also einen Verbleib ihres Landes im Binnenmarkt oder einer echten Zollunion weiterhin ablehnen und sollte sich keine andere technisch praktikable Möglichkeit finden lassen, müsste Nordirland laut EU notfalls im Gemeinsamen Markt für Güter verbleiben. Die Zollgrenze würde dann durch die irische See – zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel – aber nicht durch die irische Insel verlaufen.
Für die britische Regierung, die ohne Stimmen der nordirisch-protestantischen DUP über keine Mehrheit im Parlament verfügt, ist das mehr als heikel. Nur mit dem Argument, dass man während der Übergangsfrist bis Ende 2020 doch sicherlich eine bessere Lösung finden könne, wird Theresa May diese Garantieklausel vielleicht akzeptieren können.
Auch ein harter Brexit ist möglich
Sobald und sofern May ein Abkommen ausgehandelt hat, ändert sich die britische Debatte. Dann geht es nicht mehr darum, wer sich gerne welchen Brexit wünschen würde, sondern um eine einfache Wahl zwischen dem ausgehandelten Abkommen und dem Chaos. In dieser Situation sehen wir eine Chance von 60 Prozent, dass Theresa May schließlich eine Mehrheit im britischen Parlament für ein von ihr ausgehandeltes Abkommen überzeugen wird.
Es verbleibt ein hohes Risiko von 40 Prozent, dass es auch ganz anders kommen könnte. Darunter fällt ein Risiko von 20 Prozent eines ungeordnet harten Brexits zum 29. März 2019 ohne Übergangsperiode bis Ende 2020 und ohne Grundzüge eines Handelsabkommens für die Zeit danach. Selbst wenn dann mit heißer Nadel noch einige Mini-Abkommen geschlossen werden könnten, damit Flugzeuge weiter fliegen, Lkw weiter rollen und Arzneimittel weiter ausgeliefert werden könnten, dürfte der Schock die britische Wirtschaft in eine Stagnation oder Schlimmeres stürzen und der EU-Konjunktur ebenfalls einen erheblichen Schlag versetzen.
Denkbar ist auch, dass nach einem Sturz der Regierung May bei Neuwahlen die Labour-Partei an die Macht käme. Diese würde zwar einen weicheren Brexit anstreben und vielleicht sogar ein neues Referendum ansetzen, obwohl Labour-Chef Jeremy Corbyn die EU für eine kapitalistische Verschwörung zu Lasten der Arbeiterklasse zu halten scheint. Aber selbst wenn Labour den Brexit abmildern oder aufheben würde, wäre auch damit nicht viel gewonnen, wenn Corbyn gleichzeitig mit einer konsequent sozialistischen Wirtschaftspolitik das Land ruinieren würde. Großbritannien hat sich in eine Falle manövriert, aus der sich das Land, so oder so, wohl nicht ohne erhebliche Schäden befreien kann. Es geht jetzt nur noch darum, wie groß die Schäden ausfallen.