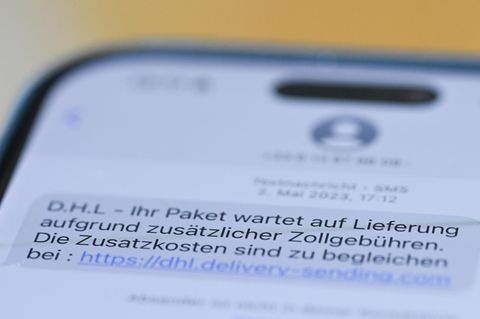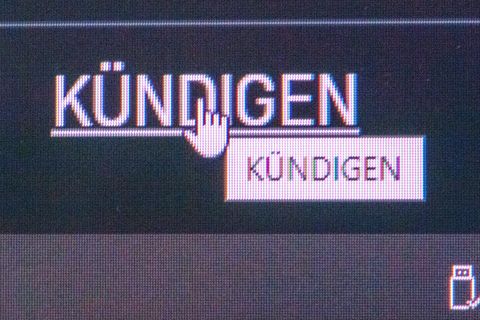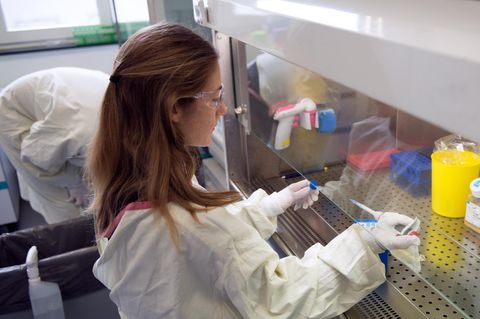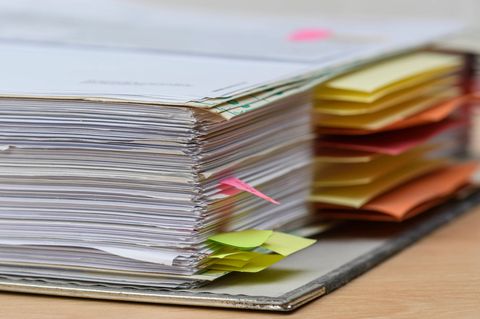„Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.“ (Paragraf 1, Absatz 1 Infektionsschutzgesetz)
Der eine „appellierte“ eindringlich, der andere „plädierte“ freundlich, Großveranstaltungen abzusagen oder zu meiden. Wer Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Deutschlands oberstem Seuchenschützer Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut (RKI) bei ihren frühen Krisenauftritten zuhörte, dem wurde angst und bange. Was so hilflos klang, bedingt die Rechtslage: Ob Schulen öffnen, Fußballspiele stattfinden oder die Deutsche Bahn fährt – nichts davon darf in der wohl größten Gesundheitskrise der Nachkriegszeit die Bundesregierung oder ihre oberste Seuchenschutzbehörde entscheiden.
So will es das Infektionsschutzgesetz, das Anfang 2001 in Kraft trat und das Bundesseuchengesetz ablöste. Das Bundesgesetz regelt die Maßnahmen „zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen“. So verschärfte es etwa die Meldepflicht für Krankheiten und Erreger und stärkte die Rolle des Robert-Koch-Instituts. Für die Umsetzung vor Ort aber sind die Länder zuständig, in vielen Fällen sogar das örtliche Gesundheitsamt. Sie entscheiden, ob Veranstaltungen ausfallen, Einrichtungen schließen, Menschen unter Quarantäne gestellt werden.
Eine Regelung, die in normalen Zeiten sinnvoll sein mag, die aber bei der Bekämpfung einer globalen Seuche an Grenzen stößt. „Der Föderalismus hat sehr viele Vorzüge. Aber hier ist das ein Nachteil“, so SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Nötig sei eine zentrale Ansage, wie etwa mit Großveranstaltungen umzugehen sei. Ähnlich sieht das Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Politik lasse die Ämter vor Ort zu oft allein – auch mit den verunsicherten Bürgern oder den Drohungen von Veranstaltern, die auf Entschädigung pochen.
Zumal die 400 Gesundheitsämter mit der Aufgabe ohnehin überfordert sind, da sie massiv unterbesetzt sind. So ist die Zahl der Amtsärzte in den vergangenen 20 Jahren um etwa ein Drittel zurückgegangen. Vielerorts schaffen diese rund 2500 Ärzte nicht mal mehr die Schuleingangsuntersuchungen, die zu ihren Standards zählen.
Dass ein zentrales Vorgehen im Fall von Corona besser ist, dämmert nun auch der Bundesregierung und dem RKI. Ein Gesetzesentwurf liegt bereits auf dem Tisch. Darin bekommt Spahn mehr Kompetenzen im Krisenfall. Doch noch sträuben sich die Länder.
Testurteil: Ausreichend
Der Beitrag ist in Capital 5/2020 erschienen. Interesse an Capital ? Hier geht es zum Abo-Shop , wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay