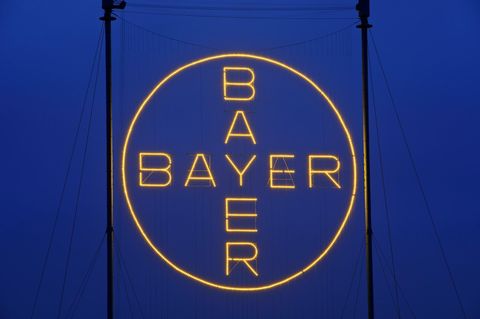BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller gehört zu den deutschen Managern, die Entscheidungsfreudigkeit nur allzu oft mit Kaltschnäuzigkeit verwechseln. Die böse Nachricht vom Verkauf der Konzerntochter Wintershall Dea erreichte die rund 3000 Beschäftigten ausgerechnet zwei Tage vor Heiligabend. Größere Erklärungen für den geplanten Kahlschlag im Management und die vollständige Schließung der beiden Verwaltungen in Hamburg und Kassel gab es von Brudermüller nicht. Selbst der Vorstandschef von Wintershall Dea, Mario Mehren, zeigte sich geschockt von der brutalstmöglichen Variante des Verkaufs an einen britischen Konkurrenten.
Jetzt, nur vier Wochen später, zeigt sich: Die Ankündigung des Verkaufs an einen Nicht-EU-Konzern war womöglich nicht nur besonders rücksichtslos inszeniert, sondern womöglich auch voreilig. Das „Handelsblatt“ berichtete am vergangenen Freitag, der Bund wolle den Deal sowohl nach außenwirtschaftlichen als auch nach kartellrechtlichen Kriterien prüfen. Und schon melden sich erste Stimmen aus der Regierungskoalition, die ein Verbot des Verkaufs fordern, beispielsweise der nicht gerade unwichtige energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse.
Nun kommt eine Prüfung bei einem Deal dieser Art keineswegs überraschend. Sie ist sogar vorgeschrieben. Die BASF muss auch in mehreren anderen Ländern, in denen die Tochter Förderlizenzen hält, auf Entscheidungen der Behörden warten. Frühestens Ende dieses Jahres könnte es zu einem rechtsgültigen Abschluss des Vertrags kommen – wenn es denn wirklich dazu kommt.
Es spricht viel für ein Verbot des Wintershall-Dea-Verkaufs
Wäre Großbritannien noch EU-Mitglied, dann wäre die deutsche Zustimmung ein kleines Stück leichter zu erhalten. So aber kollidiert der geplante Deal nicht nur mit den deutlich verschärften Regeln der deutschen Außenwirtschaftsverordnung, die einseitige Abhängigkeiten wie früher von Russland verhindern soll, sondern auch mit den Zielen einer abgestimmten europäischen Energiepolitik. Es wäre nicht das erste Mal, dass die BASF-Spitze nicht tief genug in die Gesetze blickt, sondern sich wieder einmal darauf verlegt, den politischen Widerstand gegen eigene Pläne einfach plattwalzen zu wollen.
In der Tat spricht mehr für ein Verbot des Deals als dagegen. Dass sich eine der größten Industrienationen der Welt selbst völlig blank macht in der Energieförderung kann man geostrategisch nur als sehr gefährlich bezeichnen. Wir leben nicht in normalen Zeiten, in denen man sich über solche Bedenken einfach hinwegsetzen kann. BASF schert sich aber seit Jahren nicht um die veränderte Großwetterlage, unterstützte bis zuletzt Putin und macht sich immer stärker abhängig von China.
Die maue Bilanz des scheidenden BASF-Chefs
Brudermüllers Entscheidung kam ganz offensichtlich unter selbstgemachtem Zeitdruck zustande. Der BASF-Chef wollte die ungeliebte Öl- und Gas-Tochter seit langem loswerden, aber viele öffentlich ventilierte Pläne wie zum Beispiel ein Börsengang lösten sich in Luft auf. Da Brudermüller sein Amt aber im Frühjahr mit der nächsten Hauptversammlung abgibt, sollte vorher noch unbedingt ein Deal her. Ohne die 11 Mrd. Euro Verkaufserlös sieht die Abschlussbilanz des äußerst selbstherrlichen Managers noch schlechter aus als ohnehin schon.
Sollte der Wintershall-Verkauf scheitern, fehlt dem Mutterkonzern schlicht das Geld für dringend notwendige Investitionen und die längst überfällige Umstrukturierung der großen Verbundwerke, vor allem am Stammsitz Ludwigshafen. Brudermüller wollte seinem persönlich ausgewählten Nachfolger gern eine etwas besser gefüllte Kasse hinterlassen, um selbst mit Applaus abzutreten. Daraus könnte nun nichts werden. Die nächste Hauptversammlung wird keinen Vollzug des Deals melden können – und auch sonst keine guten Nachrichten.