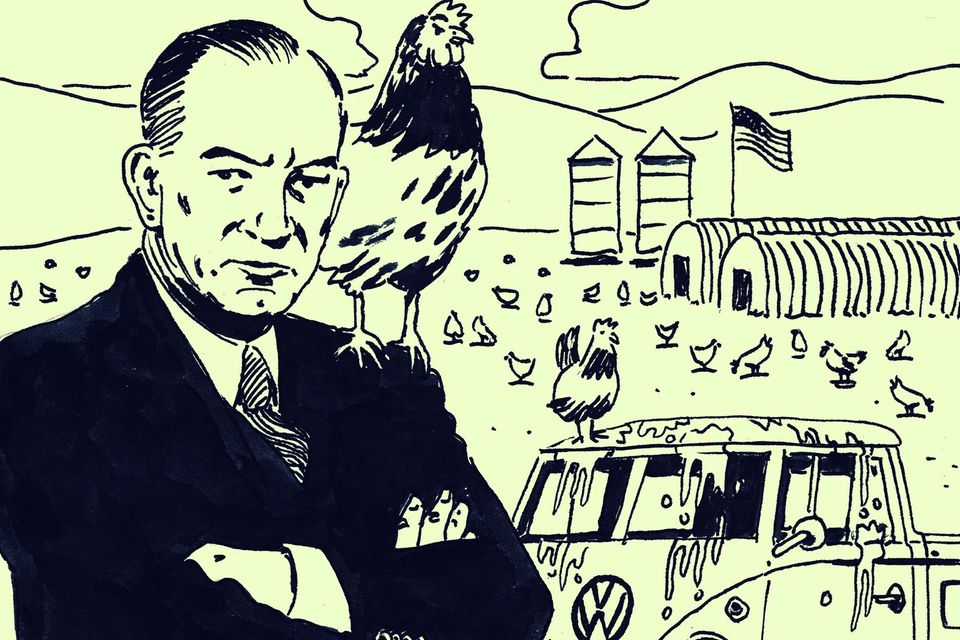Ja, wir sind manchmal schon ziemlich blöd. Längst nicht so klug und rational, wie wir eigentlich sein wollen und sein müssten, um unser eigenes Glück zu maximieren. Faul und entscheidungsschwach, impulsiv und eitel, deprimiert oder verliebt, strukturell beschränkt mit Tendenz zur gelegentlichen Unzurechnungsfähigkeit.
Ist es deshalb schon völlig in Ordnung, wenn die Politik uns ans Händchen nimmt und uns väterlich zeigt, wo es langgehen sollte?
Gegenfrage: Woher weiß die denn das eigentlich?
Wie vertrackt diese Sache mit dem staatlichen Paternalismus ist, lässt sich in den USA gerade sehr schön am Beispiel der sogenannten „Nudge“-Strategien studieren. Da wird einerseits mit Methoden gelenkt, die für sanfte Volkserzieher eine Freude sind. Aber da werden andererseits auch schon mal Ziele verfolgt, die deutschen Grünen Albträume bereiten.
Die populäre Idee des "Nudge" also des kleinen psychologischen „Stupsers“, kommt ursprünglich aus der Sozialwissenschaft: Menschliches Verhalten lässt sich schon allein dadurch steuern, dass Entscheidungssituationen in bestimmter Weise vorstrukturiert werden.
„Libertäre Paternalisten“
Steht der Salat in der Kantine ganz vorne oder hinten in der Ecke? Ist der Sparplan für die Rente eine hinzuwählbare Option - oder ein abwählbarer Standard? Muss die Bereitschaft zu einer Organspende explizit bekundet werden – oder reicht es schon, wenn wir nicht explizit widersprechen? All das hat einen erheblichen – und experimentell nachweisbaren - Einfluss darauf, wie wir entscheiden. Private Unternehmen manipulieren uns Verbraucher ständig mit solchen Tricks. Warum also sollte nicht auch die Politik die Methode nutzen, um uns ein wenig zu unserem eigenen Besten zu lenken? Immerhin bleibt uns dann mehr Freiheit als wenn immer neue Regeln und Vorschriften erlassen werden.
Die Theoretiker des „Nudge“, die sich selbst als „libertäre Paternalisten“ bezeichnen, sind heute einflussreicher denn je. Barack Obama hat soeben ein neues Beraterteam eingerichtet, das die Möglichkeiten für das „Stupsen“ der US-Bürger systematisch prüfen soll. Daniel Kahneman, der Psychologe und Wirtschaftsnobelpreisträger, der das Konzept des „Nudge“ wesentlich entwickelt hat, wird von Obama in diesem Jahr die Presidential Medal of Freedom erhalten, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Der Ökonom Richard Thaler, der den Ideen in der Wirtschaftswissenschaft zum Durchbruch verholfen hat, übernimmt demnächst den Vorsitz der American Economic Association, der weltweit wichtigsten Fachvereinigung der Volkswirte.
In der „New York Times“ hat auch deren Konservativer vom Dienst den „Stupsern“ vor ein paar Tagen seinen Segen erteilt. Die liberalen Anti-Paternalisten, die vor der Entmündigung der Verbraucher warnen, hätten zwar in der Theorie durchaus Recht. Die Empirie spreche aber klar für die sanfte Lenkung, meint David Brooks: „Es ist schwerlich als Beschränkung meiner Freiheit zu empfinden, wenn die Cafeteria das gesunde Obst an einer prominenten Stelle auslegt.“
Worüber man in der Tat nicht lange streiten muss: So lange wir uns alle einig sind, dass wir eigentlich viel öfter Obst statt Schokolade essen sollten, ist so ein kleiner Psychotrick zu unserem Besten. Aber was ist eigentlich, wenn die Entscheidung selbst umstritten ist? Was würde zum Beispiel Renate Künast sagen, wenn die prominent platzierten Äpfel gentechnisch verändert sind?
Bevor die deutschen Paternalisten demnächst begeistert zum „Stupser“-Brainstorming ausschwärmen, sollten sie unbedingt auch lesen, was Obamas langjähriger „Nudge“-Berater Cass Sunstein kürzlich zum Thema „Genfood“ geschrieben hat. Sunstein lehnt eine Kennzeichnungspflicht, wie sie in Europa gilt, für die USA ab, denn sie könne „die Konsumenten alarmieren und in die Irre führen“. Das Etikett schade im Ergebnis den Verbrauchern und den Produzenten, denn es erwecke den völlig falschen Eindruck, dass Behörden und Wissenschaft irgendwelche Zweifel an der Unbedenklichkeit gentechnisch veränderter Lebensmittel hätten. Solche wissenschaftlichen Zweifel gibt es aber nicht einmal in Europa.
Kurz gesagt: Wenn etwas nachgewiesen harmlos ist, dann ist es nicht die Aufgabe des Staates, unterschwellig Horrorpropaganda zu betreiben.
Die verdeckte „Stupserei“ ist eine clevere Lenkungsmethode. Aber sie ist kein Freibrief zur beliebigen Massenmanipulation. Die Ziele des Ganzen müssen immer wieder transparent und rational geklärt werden. Ohne mündige Bürger funktioniert das letztlich nicht.
Christian Schütte schreibt an dieser Stelle jeweils am Dienstag über Ökonomie und Politik. Seine letzten Kolumnen: Was erlaube Künast, Schäubles Schuldengriechisch und Staatsanwälte wählt man nicht
E-Mail: schuette.christian@capital.de
Folgen Sie Capital auf Twitter: @capitalMagazin