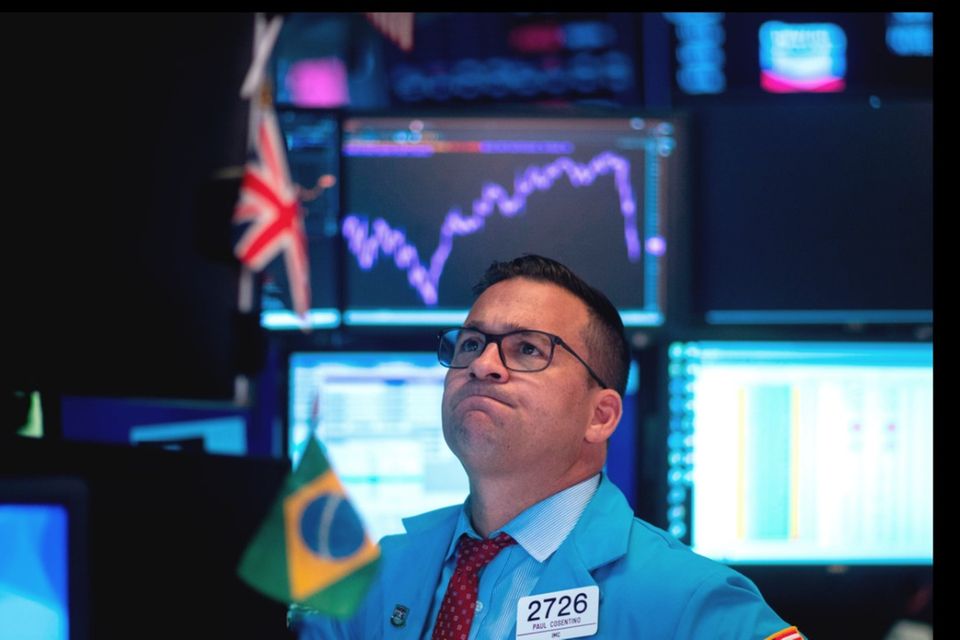Das Konsumklima, die Exportzahlen und die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe – immer mehr Indikatoren weisen auf eine Eintrübung der Konjunktur hin. Am kommenden Mittwoch veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal. Ökonomen rechnen mit einem Rückgang des deutschen BIP. Aber wie geht es dann weiter? Schrumpft die Wirtschaft auch im dritten Quartal, befände sich die Bundesrepublik in einer Rezession - zum ersten Mal seit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise.
Die Konjunkturampel des Wirtschaftsinstituts Kiel Economics hat zuletzt im Juni die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Rezession untersucht. Capital hat mit Geschäftsführer Carsten-Patrick Meier über die Ergebnisse der Analyse und die Entwicklung der deutschen Wirtschaft gesprochen.
CAPITAL: Zuletzt hat die Konjunkturampel von Kiel Economics angezeigt, dass sich die Rezessionswahrscheinlichkeit für Deutschland verringert hat. Was bedeutet dieser Befund?
CARSTEN-PATRICK MEIER: Eine Rezessionswahrscheinlichkeit von knapp 40 Prozent, wie sie unsere Ampel für Juni ausgewiesen hat, ist durchaus als hoch zu bewerten, auch wenn sie noch kein klares Rezessionssignal liefert und gegenüber der Berechnung von März etwas gesunken ist.
Welche Faktoren betrachtet die Konjunkturampel zur Berechnung der Rezessionswahrscheinlichkeit?
Die Variablen, die in die Konjunkturampel eingehen, drücken allesamt in irgendeiner Weise Erwartungen aus. Erwartungen können zum einen direkt bei Akteuren und Marktteilnehmern abgefragt werden, wie das vom Ifo-Institut im Rahmen des Konjunkturtests, von der GfK bei ihren Verbraucherumfragen und in vielen anderen Umfragen gemacht wird. Zum anderen lassen sie sich ableiten aus der Entwicklung von Finanzmarktpreisen und Transaktionsvolumina, die im weiteren Sinne alle Arten von Finanz- und Sachkapitalinvestitionen umfassen. Interessant sind darüber hinaus Indikatoren, die die Unsicherheit dieser Erwartungen beschreiben. Die Schwankungsintensität der Finanzmarktpreise ist ein solches Maß. Ein anderes ist die Streuung der Geschäftserwartungen der Unternehmen.
Warum ist die Streuung der Geschäftserwartung ein wichtiger Faktor?
Typischerweise ist in Rezessionen die Unsicherheit in den Unternehmen besonders groß. Ein starker Anstieg der Unsicherheit kann daher Vorbote einer Rezession sein. Im vergangenen Monat ist die Streuung der Geschäftserwartungen deutlich gestiegen, wenn auch weniger stark wie typischerweise vor Rezessionen zu beobachten. Zu denken gibt vor allem das Ausmaß der Erwartungsstreuung; eine Unsicherheit in diesem Ausmaß ist für gewöhnlich nur während einer Rezession zu beobachten.
Inwiefern sollte die Bundesregierung angesichts der wachsenden Sorge vor einer Rezession aktiv werden?
Finanzpolitischer Handlungsbedarf könnte sich im Falle einer Rezession für die Bundesregierung ergeben, weil die Zinsen im Euroraum schon unter null liegen, so dass jede Stabilisierung seitens der EZB mit Schwierigkeiten behaftet ist. Dies gilt umso mehr als Deutschland im Euroraum wahrscheinlich das Land mit dem größten finanzpolitischen Spielraum ist. Die schwarze Null im Haushalt macht in einer Rezession keinen Sinn.
Die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank hat zuletzt viele Anleger verunsichert. Wie wirkt sich die Entscheidung der Federal Reserve auf die deutsche Konjunktur aus?
Man kann theoretisch argumentieren, dass jede Zinssenkung den Dollar schwächt und den Euro stärkt. Das sehen wir aktuell aber nicht; der Dollar ist weiterhin stark. Wenn es der Fed gelingt, die amerikanische Wirtschaft zu stabilisieren, ist das gut für Deutschland.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist dagegen wesentlich deutlicher spürbar. Was würde eine Verschärfung des Konflikts bedeuten?
Eine aggressive amerikanische Handelspolitik ist grundsätzlich schlecht für die Weltkonjunktur, sie sorgt für Unsicherheit und reduziert Investitionen. Sollten die angedrohten Maßnahmen tatsächlich durchgeführt werden, kommt es zu einem weiteren Dämpfer für die Weltkonjunktur. Dann werden sowohl die amerikanischen als auch die chinesischen Firmen in Mitleidenschaft gezogen und am Ende trifft es auch die deutsche Industrie.
Inwiefern trifft die Verschärfung auch die deutsche Konjunktur?
Indem die USA und China nicht mehr miteinander handeln, kommt es zu Handelsumlenkungen. Für die betroffenen Exportgüter gibt es dann freie Kapazitäten, die wiederum an Drittmärkte gehen. Diese Waren kommen also entweder auf den deutschen Markt oder auf die Märkte von Abnehmern deutscher Produkte. Damit steigt dann wiederum der Wettbewerbsdruck für deutsche Unternehmen und es kommt zu einem zusätzlich dämpfenden Effekt für die deutsche Konjunktur.
Carsten-Patrick Meier ist Geschäftsführer des Wirtschaftsinstituts Kiel Economics, das 2009 als Ausgründung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) entstanden ist. Zwischen 1998 und 2008 leitete er am IfW die Forschungsgruppe „Deutsche Konjunktur“ und später den Forschungsbereich „Risiken im Bankensektor“. Meier ist außerdem Autor zahlreicher Fachaufsätze zur Entwicklung von Konjunktur, Kapitalmärkten und Banken sowie zu Fragen der makroökonomischen Modellierung und Prognose.