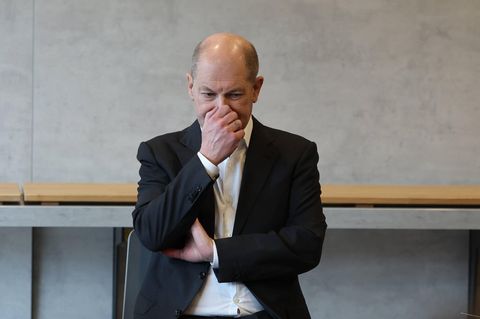Seit Beginn der Corona-Pandemie scheint möglich, was lange Zeit weit weg erschien: Eine längerfristige Rückkehr der Inflation . Im Januar dieses Jahres lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat bei einem Plus von einem Prozent , die Verbraucherpreise stiegen um 0,8 Prozent. Besonders stark legten die Preise für Energieprodukte zu: Im Vergleich zum Dezember stiegen die Preise für Kraftstoffe um Heizöl um jeweils zweistellige Prozentwerte.
Ein entscheidender Treiber der Inflation sind die Folgen der Coronapandemie. Hier spielen vor allem zwei Faktoren eine Rolle: Zum einen endete die im vergangenen Jahr zeitweise eingeführte Senkung der Mehrwertsteuersätze zu Beginn dieses Jahres wieder, Waren und Dienstleistungen wurden also wieder etwas teurer.
Zum anderen stieg die Sparquote im vergangenen Jahr in Deutschland deutlich an. Geschäfte und Restaurants waren zeitweise geschlossen, Reisen kaum möglich. Wird all das nach der Pandemie wieder möglich, so könnte es sein, dass Sparer Konsum aus der Corona-Zeit nachholen. Die dadurch steigende Nachfrage könnte zu höheren Preisen führen - zumindest zeitweilig. Auch Heizen und Tanken wurde zuletzt wieder teurer, vor allem aufgrund der seit diesem Jahr fälligen CO2-Abgabe.
Inflationsrate in Deutschland (monatlich)
source: tradingeconomics.com
Noch kein Trend – aber ein Preisschub
„Was wir jetzt erleben ist ein temporäres Anziehen der Inflationsrate“, sagt Peter Bofinger. Möglicherweise werde sie in diesem Jahr auch über die 3-Prozent-Marke hinausgehen. „Das würde ich aber nicht als Inflation bezeichnen“, sagt er. „Das ist ein Preisschock, der durch die Mehrwertsteuererhöhung, die CO2-Bepreisung und den enormen Einbruch der Energiepreise im vergangenen Jahr zu erklären ist.“
Der Anstieg der Inflation im Januar sei zu erwarten gewesen, sagt auch Stefan Kooths, Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Institut für Weltwirtschaft (IfW). „Das ist erst einmal kein Anlass, von einem Trend hin zu einer höheren Inflationsdynamik auszugehen.“ Kooths geht davon aus, dass nachgeholter Konsum zu einem Preisschub führen wird, der die Inflationsrate im Vorjahresvergleich über drei Prozent treiben wird. „Wir sehen im Zuge der Lockdown-Maßnahmen bei den privaten Haushalten eine aufgestaute Kaufkraft von etwa 200 Mrd. Euro. Das sind Konsumausgaben, die nicht wie gewohnt getätigt wurden – eine Corona-bedingte Extra-Ersparnis“, sagt er.
Diese Kaufkraft werde sich bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen zwar nicht gänzlich in zusätzlicher Nachfrage widerspiegeln, aber ein Teil davon. „Restaurants, die dann stärker genutzt werden, werden Spielräume für Preiserhöhungen nutzen“, so Kooths. Gleiches gelte auch für Tourismus- und Unterhaltungsangebote. „Stärkere Kaufkraft trifft dort im Zweifel auf ein kleineres Angebot, weil Unternehmen im Zuge der Pandemie ausgeschieden sind“, sagt Kooths.
Eine langfristige Rückkehr der Inflation?
Feststeht: Sollte die Inflation langfristig zurückkehren, hätte das wohl weitreichende Folgen. Denn damit könnte die Phase der Niedrig- und Negativzinsen ein Ende haben – was angesichts der hohen Schuldenstände durch die Kosten der Pandemiebekämpfung ungünstig wäre.
„Ob es zu einer dauerhaft höheren Inflation kommt, hängt davon ab, ob wir uns in Richtung einer dauerhaften Finanzierung von Staatsausgaben durch die Notenpresse bewegen und ob das Vertrauen in solide Staatsfinanzen und stabilitätsorientierte Geldpolitik beschädigt wird“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest. Er rechne nicht damit. Die EZB habe einen klaren Auftrag, für Geldwertstabilität zu sorgen, notfalls auch um den Preis steigender Zinsen und einer Belastung der Staatsfinanzen. „Ich gehe fest davon aus, dass sie diesen Auftrag ausführen wird“, so Fuest.
Kooths geht davon aus, dass es auch mittelfristig zu höheren Inflationsraten kommen wird als in den vergangenen zehn Jahren. Das habe mit drei Faktoren zu tun: den hohen Verschuldungspositionen insbesondere seitens der Staaten, den Reaktionen der Geldpolitik darauf und der demografischen Entwicklung.
„Die Geldpolitik wird wohl Rücksicht auf die hohe Staatsverschuldung nehmen und versuchen, die Finanzierungskonditionen für Staaten niedrig zu halten“, sagt Kooths. „Dann müssen sie immer weiter intervenieren und staatliche Papiere aufkaufen.“ Das treffe auf eine demografische Alterung, die dafür sorge, dass die Ersparnis zurückgehe. Das wiederum führe zu einer Zinssteigerung. „Wenn die Geldpolitik das nicht im gleichen Maße nachvollzieht, kann sich daraus ein höherer Inflationstrend ergeben“, so Kooths.
Für eine Entwicklung der Inflation, wie es sie in den 70er-Jahren gab, sieht Peter Bofinger derzeit keine Anzeichen. Dazu brauche man deutlich steigende Löhne und eine sehr positive Arbeitsmarktlage. Das sei angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der Transformation der Industrie unwahrscheinlich. Hinzu komme eine „Post-Corona-Welt, in der Menschen weniger Geschäftsreisen machen, seltener in die Städte fahren, in der es weniger stationären Handel gebe. All das könne sich negativ auf die Beschäftigung auswirken. „In den 70er-Jahren gab es eine Lohn-Preis-Spirale und gleichzeitig ein permanentes Ansteigen der Energiepreise“, sagt er. „Beides sehe ich heute nicht.“
„Das freundliche Szenario überwiegt“
„Nach vier Jahrzehnten rückläufiger Inflation wendet sich langsam das Blatt, zumindest in der entwickelten Welt“, sagt Florian Hense von der Berenberg Bank. „Mehrere Faktoren zyklischer und struktureller Natur deuten darauf hin, dass die Inflation in den kommenden Jahren zulegen wird.“ Eine allmähliche Rückkehr der Inflation zu den Zentralbankzielen von circa 2 Prozent könne neutral oder sogar leicht positiv für die Volkswirtschaften und realen Vermögenswerte wie Aktien sein. In einem solchen Szenario, so Hense, müssten die Zentralbanken ihre Stimulierungsmaßnahmen nur langsam zurückfahren und somit die wirtschaftliche Erholung nicht gefährden.
„Ein schneller, nachhaltiger Anstieg der Inflation über ein Niveau hinaus, das die Zentralbanken dulden können, würde sie jedoch irgendwann dazu zwingen, kräftig auf die Bremse zu treten“, sagt Hense. Zügig, stark steigende Finanzierungskosten und ein damit einhergehender Einbruch des Wirtschaftswachstums wären seiner Ansicht nach „ein Rezept für einen großen Ausverkauf an den Aktienmärkten“. Doch für 2021 und 2022 werde erwartet, dass das freundliche Szenario überwiege.
„Letztlich kann die entwickelte Welt allmählich zur alten Normalität vor der Globalen Finanzkrise von 2008/2009 zurückkehren: weniger gedämpfte Inflation, schnellere Zuwächse beim Pro-Kopf-BIP und der Produktivität sowie höhere Zentralbankzinsen und Anleiherenditen“, sagt Hense.
Zusätzliche Belastung der Staatshaushalte möglich
Ob die Inflation – auch langfristig in der Eurozone wiederkehre, hänge von dem weiteren Verlauf der Pandemie und der möglichen fiskalpolitischen Reaktion ab, sagt Alexander Kriwoluzky, Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).
„Falls die Inflation zurückkehren würde, hätte das zum einen zur Folge, dass sich die Geldpolitik im Euroraum wieder normalisieren würde, das heißt, dass keine Ankaufprogramme von Anleihen mehr nötig wären“, sagt Kriwoluzky. „Das wäre eine große Erleichterung.“ Zum anderen – so der Ökonom – würde die Inflation die reale Schuldenlast senken und damit verschuldeten Haushalten, Firmen und Staaten helfen.
„Andererseits würden höhere Inflationszahlen mit höheren nominalen Zinsen Hand in Hand gehen“, sagt er. „Die höheren Nominalzinsen zusammen mit einem Ende der Ankaufprogramme der EZB können zu einer zusätzlichen Belastung der Staatshaushalte führen und das Risiko einer untragbaren Schuldenlast, zum Beispiel in Italien, erhöhen“, sagt Kriwoluzky. Er rechne langfristig mit einer Inflationsrate zwischen einem und drei Prozent.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden