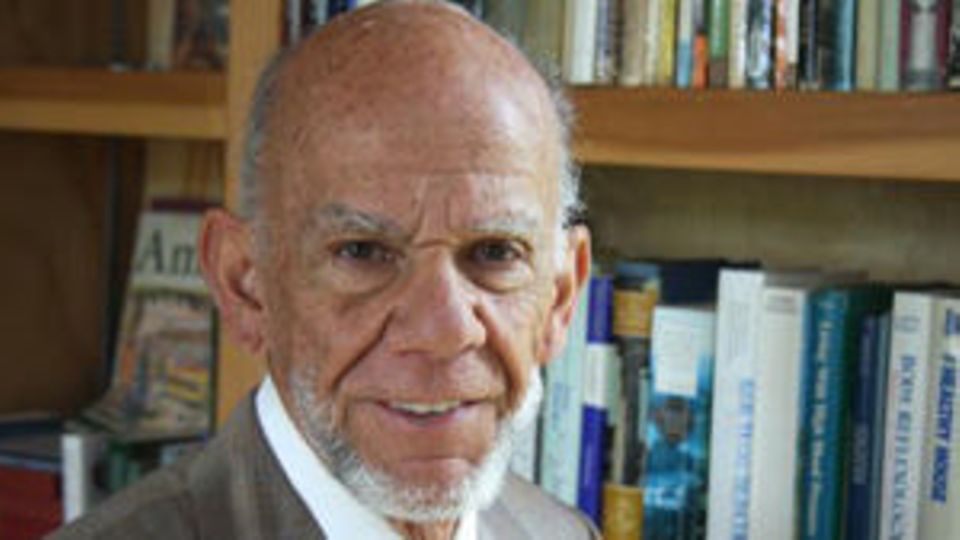In der bunt gescheckten Welt der internationalen Finanzen, können gute Nachrichten schlechte Nachrichten sein - vor allem, wenn sie als Zeichen wahrgenommen werden, dass der Anfang vom Ende der süchtig machenden quantitativen Lockerung gekommen ist.
Die Weltfinanzmärkte begrüßten vergangene Woche Äußerungen von Fed-Chef Ben Bernanke als gute Nachricht, wonach die Abwärtsrisiken für die US-Wirtschaft abgemildert worden seien durch die Haltung der Fed Anleihen und Aktien zu verkaufen, zu verkaufen und nochmals zu verkaufen.
Das Ende der quantitativen Lockerung (Aufpumpen der Geldmenge durch den Kauf von Staatsanleihen) ist eindeutig viel härter für die Federal Reserve als der Auftakt – und das ist keine gute Nachricht für Europa oder andere davon betroffene Länder.
Im Übergang zur Normalität ist Bernanke bereit, den internationalen Finanzmärkten weit mehr unerwünschte Volatilität zuzumuten als die EZB, wenn sie ihre Nicht-Standardmaßnahmen verlässt, die sie im Kampf gegen die Krise verhängt hat.
“Abenomics” in Japan hat die quantitativen Erleichterungen durch die Abwertung des Yen als Starthilfe für die japanische Wirtschaft benutzt, hat aber auch die Weltwirtschaft ins Rotieren gebracht.
Anfangs glaubten die Märkte an das Programm und der Yen fiel steil gegen alle Währungen einschließlich Euro und US-Dollar. Dann haben sich Zweifel über das Programm eingeschlichen und alles umgekehrt.
Jetzt ist der Yen weiter gefallen - wie alle Währungen gegenüber dem US-Dollar in Reaktion auf Bernankes "Gute-Nachricht"-Kommentar.
Die Volatilität durch die Kombination von amerikanischen Ausstieg aus und japanischem Einstieg in die Welt der quantitativen Lockerung hat die internationalen Finanzmärkte mit einer doppelten Dosis Volatilität aufgewühlt.
Vor diesem Hintergrund können sich die Europäer glücklich schätzen, dass sich ihre Zentralbank standhaft geweigert hat, auf das Instrument der quantitativen Lockerung in der Krise zurückzugreifen. Die EZB ist die Verantwortungsvolle bei einer Party, wo alle anderen schon durchdrehen.
Ja, es hat einige gegeben, die das Verhalten der EZB für idiotisch halten, weil sie nicht dem japanischen und amerikanischen Beispiel bei der quantitativen Lockerung gefolgt ist. Dies habe zu Überbewertung des Euro, deflationärem Druck auf die europäische Wirtschaft in Zeiten der Rezession und einer schlappen wirtschaftlichen Performance geführt.
Eine starke Währung ist aber kein Problem für eine stabilitätsorientierte Zentralbank wie die EZB, die sich selbst nach dem Vorbild der alten Bundesbank gestaltet hat. In seiner Stellungnahme vor dem Karlsruher Gericht, argumentierte der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, dass die Bilanz der EZB bei der Inflation sogar besser sei als die der Bundesbank.
Die EZB mag umstrittene unkonventionelle Maßnahmen wie das Anleiheaufkaufprogramm OMT zur Bekämpfung von Krise und Ansteckung gefasst haben – aber die europäischen Steuerzahler sollten dankbar sein, dass sie die Finanzmärkte beruhigt und nicht aufgewühlt haben wie die Fed und die Bank of Japan mit ihren Programmen zur quantitativen Lockerung.
Willkommener und kostenloser Stabilitätsanker
Auch während der aktuellen Zitterpartie auf den Finanzmärkten sind die Spreads zwischen Schuldenkrisenländern an der Peripherie und den deutschen Bundesanleihen stabil geblieben. Solange Zentralbanken weltweit weiterhin fortfahren mit ihren Volatilitätsexzessen, kann OMT ein willkommener und kostenloser Stabilitätsanker für Europas Anleihemärkte an der Peripherie sein.
Während sich Bernankes erster Ausstiegsversuch aus der quantitativen Lockerung als traumatisch für die Weltwirtschaft erwiesen hat, war der Ausstieg aus der wichtigsten EZB-Nicht-Standardmaßnahme in der Krise - das LTRO-Programm (Long-Term Refinancing Operation) zur Versorgung der Eurozonen-Banken mit kurz- bis mittelfristiger Liquidität - relativ gutartig.
Die EZB-Bilanz schrumpft automatisch, da die Banken die Liquidität freiwillig zurückzahlen, die sie von der Zentralbank unter dem LTRO-Programm geliehen haben, wenn sie überschüssige Reserven haben. Im Gegensatz zur Fed, die Wertpapiere entweder verkaufen oder bis zur Fälligkeit halten muss, um ihre Bilanz zu schrumpfen, lieh die EZB den Banken einfach Liquidität, das sie jetzt aus freien Stücken zurückzahlt.
Tatsächlich wurde mehr als die Hälfte des Geldes, das sich die Banken der Eurozone von der EZB geliehen haben zurückerstattet, bevor Bernanke die Märkte mit seinen zuspitzenden Äußerungen erschreckt hat – und die Welt nahm kaum Notiz davon. Das ist der Beweis: Die EZB macht es besser.
Melvyn Krauss ist emeretierter Professor für Volkswirtschaft an der New York University
Foto: © Getty Images; University of New York