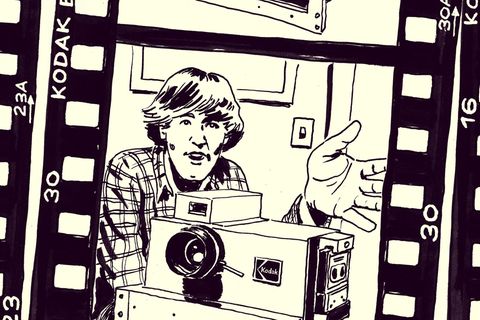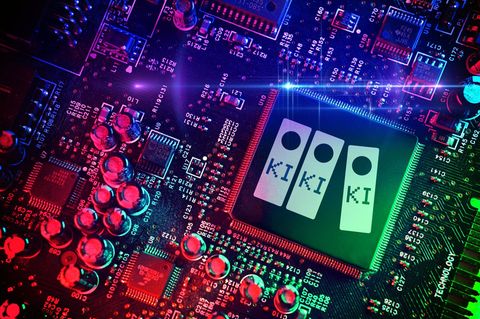In meiner Heimatstadt Gütersloh haben Sie die Möglichkeit, bei einem Café oder einem schönen Essen Ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Im „Bankery“ tritt der klassische Service-Schalter in den Hintergrund. An seiner Stelle stehen iPads und Online-Portale. Banking wird zum Erlebnis. Ein Phänomen, das auch für viele andere Bereiche gilt: Die Arbeit wird sich durch die Digitalisierung in Zukunft massiv verändern . Das lesen Sie tagtäglich in etlichen Magazinen und Zeitungen. Und doch haben nur wenige Menschen eine Idee davon, welche Konsequenzen die Digitalisierung in der Gesamtwirtschaft und gesellschaftlich tatsächlich haben.
Diese digitale Entwicklung hat sicherlich viel Gutes – im Silicon Valley ist dank ihr geradezu eine Goldgräberstimmung ausgebrochen –, aber sie bringt auch eine Gefahr mit sich: Unsere Gesellschaft droht zu entzweien. Auf der einen Seite stehen die, die ihre Jobs an Computer verlieren, und auf der anderen Seite der Kluft die, die ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, die Technik weiterzuentwickeln, die eben dies zu verantworten hat.
In den USA ist die Kluft schon deutlich erkennbar. Die Menschen, die sich abgehängt und vergessen fühlen, haben Ende letzten Jahres all ihre Hoffnung in Donald Trump gesteckt, der versprach, dass alles wieder wird wie früher. Sein großes Wahlversprechen wird er wohl kaum halten können, denn auch ein US-Präsident wie er kann die Digitalisierung nicht aufhalten.
Das Gefühl abgehängt zu sein , ist unterdessen auch in Europa eingezogen – gut ablesbar am Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Wie also schaffen es die Deutschen, dass sich hierzulande ein solcher gesellschaftlicher Zerfall nicht ausbreitet?
Der Grundpfeiler für sozialen Frieden
Ich bin der Überzeugung, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diesen Super-GAU zu verhindern: ein bedingungsloses Grundeinkommen . Der von Götz Werner geprägte Begriff steht für viele Sichten – sei es finanziell, sozial oder gesellschaftlich. Ich sehe es vor allem als Unternehmer, der mit Standorten in den USA, Deutschland und China ganz nahe am Wandel dran ist, der sich mit der Digitalisierung vollzieht, und das Privileg hat, ihn mitzugestalten. Ich sehe, wie Produkte von renommierten Unternehmen plötzlich alt werden, überholt und nicht mehr wettbewerbsfähig – auch nicht mehr anpassbar, weil die Digitalisierung nach ganz anderen Antworten fragt. Und Sie müssen nicht in die Welt der fortschrittlichsten Künstlichen Intelligenz schauen, um diesen Wandel wahrzunehmen. Denken Sie nur zurück an die Autotelefonie. Wer hat heute noch ein Autotelefon? Alle klinken doch längst ihr Smartphone in die Konsole ein und haben damit ihr Navigationsgerät und den Musikplayer gleich mit an Bord.
Was passiert also mit den Arbeitsplätzen, was machen die Menschen, die von solchen disruptiven Veränderungen am Markt betroffen sind? Werden nun, sagen wir, 20 Prozent der Menschen zur Randgruppe? So wie in Deutschland schon 20 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht sind? Die Wirtschaftsweisen sagen aktuell ein gutes wirtschaftliches Wachstum voraus, das will ich ihnen gar nicht nehmen. Doch gerade jetzt ist die Zeit, den Wandel zu planen und in die Wege zu leiten.
Und das Grundeinkommen wird der künftige Grundpfeiler für sozialen Frieden und die Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen sein.
Wenn Geld zur Brücke wird
Wenn alle Menschen eine gemeinsame finanzielle Basis haben, kann die Zweiteilung der Gesellschaft abgewendet werden. Nur so zerbricht die deutsche Gesellschaft nicht in das Lager der Gestalter auf der einen und das Lager der Vergessenen auf der anderen Seite. Mit einem Grundeinkommen wäre die Gesellschaft gewappnet, wenn die Digitalisierung mit all ihren Automatisierungsprozessen etliche Jobs hinfällig macht. Spätestens dann wird ein Grundeinkommen geradezu unumgänglich.
Sicher: Manche Arbeiten werden so oder so digitalisiert. Wenn Busse und Autos in Zukunft alleine fahren, wer braucht da noch Fahrer? Und wenn Drohnen Pakete ausliefern, wer benötigt da noch einen Auslieferer? Diese Jobs –und höchstwahrscheinlich noch viele weitere – werden obsolet, daran würde auch ein Grundeinkommen nichts ändern. Korrekt.
Was all den arbeitslosen Fahrern und Lieferanten aber bleiben würde, wäre das Grundeinkommen. Sie wären abgesichert. Sie müssten keine Angst haben, mit einem minimalen Arbeitslosengeld klarzukommen und dann langsam in den sozialen Abgrund zu rutschen. Genau dieser Aspekt ist auch die Brücke über die drohende Kluft. Die Brücke, die unsere Gesellschaft zusammenhalten wird. Es gibt nicht „die Unterschicht“, die von der „Elite“ mitgezogen werden muss. Keiner muss den anderen mitziehen, wenn alle über ein Grundeinkommen versorgt sind. Fatale Ungleichheiten wie beim Länderfinanzausgleich, wo allein Berlin fast die Hälfte des Geldes empfängt, das Baden-Württemberg und Bayern erwirtschaften, würde es in der deutschen Gesellschaft nicht mehr geben. Jeder Einzelne hätte sein Auskommen. Wie viel oder wenig sich nun jeder noch dazuverdient – das ist eine individuelle und freie Entscheidung.
Stehen bleiben heißt Sterben
Das Gegenargument kenne ich zur Genüge: Was wenn sich mit dem Grundeinkommen einfach alle auf die faule Haut legen? Da kann ich nur sagen: Sollen sie doch!
Selbstverantwortung ist das Prinzip. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass die meisten Menschen etwas tun und leisten wollen. Mit dem Grundeinkommen gewinnt jeder die Zeit, sich auf den digitalen Wandel einzustellen und damit zu beschäftigen.
Denn die Zahl der Menschen ohne Arbeit wird, wenn auch derzeit noch nicht sichtbar, aufgrund des digitalen Wandels stetig steigen. Deshalb ist es für viele Berufsgruppen unumgänglich, sich in Fort- und Weiterbildungen neue Qualifikationen anzueignen, um den neuen Ansprüchen gerecht zu werden. Deutschland wird eine neue Gründerkultur brauchen, in der es leicht fällt, neue Geschäftsideen und Modelle auszuprobieren. Gerade das würde uns Deutsche stark machen, die wir aufgrund der Historie ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und eine sehr geringe Risikobereitschaft besitzen.
Das Grundeinkommen erleichtert und ermöglicht geradezu erst solche Schritte. Verliert beispielsweise jemand seinen Job, so besteht nicht der Druck, schnellstmöglich eine neue Arbeit zu finden, um nicht zum Sozialfall zu werden. Das Grundeinkommen würde es ermöglichen, etwas Neues zu lernen oder ein neues Geschäft zu gründen. Auch Weiterbildungen und akademische Abschlüsse rücken so eher in den Fokus des Machbaren.
Neuerfindung an der Spitze
Ein wertvoller Schritt, denn nicht nur jeder Einzelne, sondern auch hochtechnisierte Unternehmen müssen sich permanent neu erfinden: In meinem Unternehmen haben wir für die weltweite Pharmaindustrie einen neuen De-facto-Standard entwickelt – quasi das MP3 für Forschungsdaten. Sie wissen, was das MP3 mit dem Musikmarkt gemacht hat.
Während zuvor jeder Software- und Instrumentenhersteller seinen eigenen „Standard“ gebaut hat, mit dem Ziel ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen, werden mit dem neuen Standard Systeme leichter austauschbar. Individuelle Schnittstellen werden zu einer Sprache mit einem „Stecker“ zusammengefasst. Metadaten können mit künstlicher Intelligenz ausgewertet werden.
Durch die Entwicklung dieses Standards kannibalisieren wir uns als Systemintegrator quasi selbst. Aber um uns neu zu erfinden, braucht es Vordenken, es braucht Zeit und Geld. Einige Unternehmen haben dafür Rücklagen geschaffen, vorgesorgt, sich auch organisatorisch fit gemacht für den Wandel. Sie dürfen den Wandel vielleicht auch selbst mitgestalten und das schafft Sicherheit. Eben diese Sicherheit brauchen auch die Menschen in unserer Umgebung – Menschen, die den Wandel miterleben, aber nicht vorne dabei sind in der Gestaltung. Je schneller der Wandel, desto größer das Sicherheitsbedürfnis bei jedem Einzelnen und auch in der Gesellschaft.
Wie viel leichter fiele diese Herausforderung, wenn wir in der Folge der Weiterentwicklung nicht permanent um unser Auskommen, um unsere Existenz fürchten müssten?
Umdenken!
Mit einem Grundeinkommen würden endlich die Diskussionen darum verstummen, wer viel arbeitet, leiste auch viel. Wie sagte mal einer meiner Professoren in meinem Maschinenbaustudium: Leistung ist Arbeit pro Zeit. Und das hatte er nicht physikalisch gemeint. Doch was denken wir? Wer die meiste Zeit im Büro verbringt, hat die höchste Anerkennung: „Wow, ich habe die Uhrzeit auf deiner Mail heute Morgen gesehen …“
Ich habe Respekt vor den Menschen, die erfolgreich sind mit der Vier-Stunden-Woche, auch wenn sie mir nicht entspricht. Mit der Entkopplung des Grundeinkommens von der Arbeit(-szeit) hätte jeder die gleichen finanziellen Voraussetzungen und die Gesellschaft somit eine gemeinsame Basis. Für mich ist das Grundeinkommen deshalb etwas zutiefst Solidarisches. Damit würden das gegenseitige Vertrauen und die eigene (Selbst-)Verantwortung in den Fokus rücken – das Vertrauen auf eine Gemeinschaft, zu der jeder sein Bestes beiträgt, um einen Nutzen für das große Ganze zu erzeugen.
Dieses Vertrauen und diese Selbstverantwortung können Deutschland dabei helfen, nicht in einzelne Lager zu zerbrechen, sondern zusammenzuwachsen statt zu trennen.