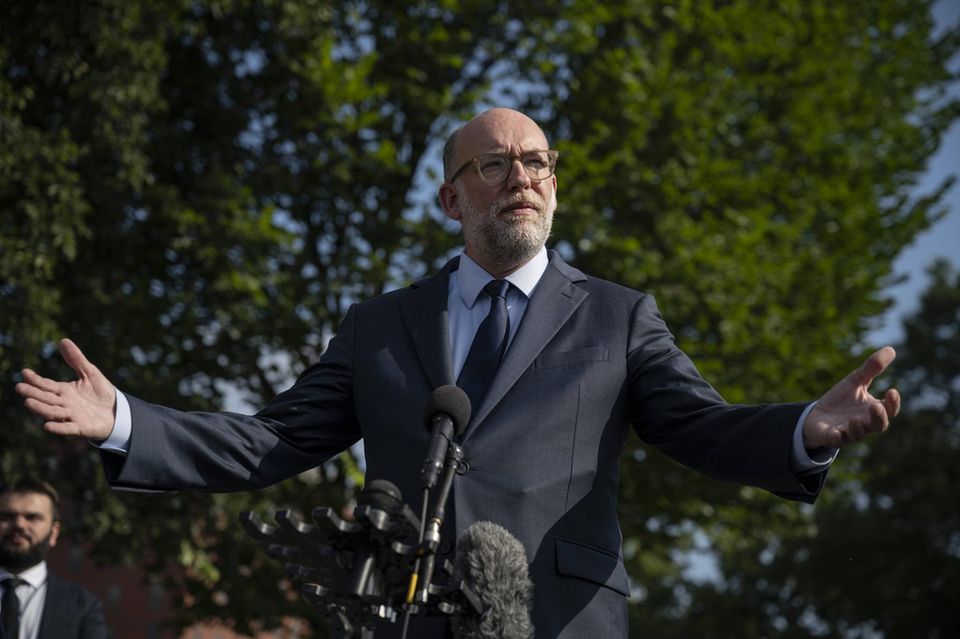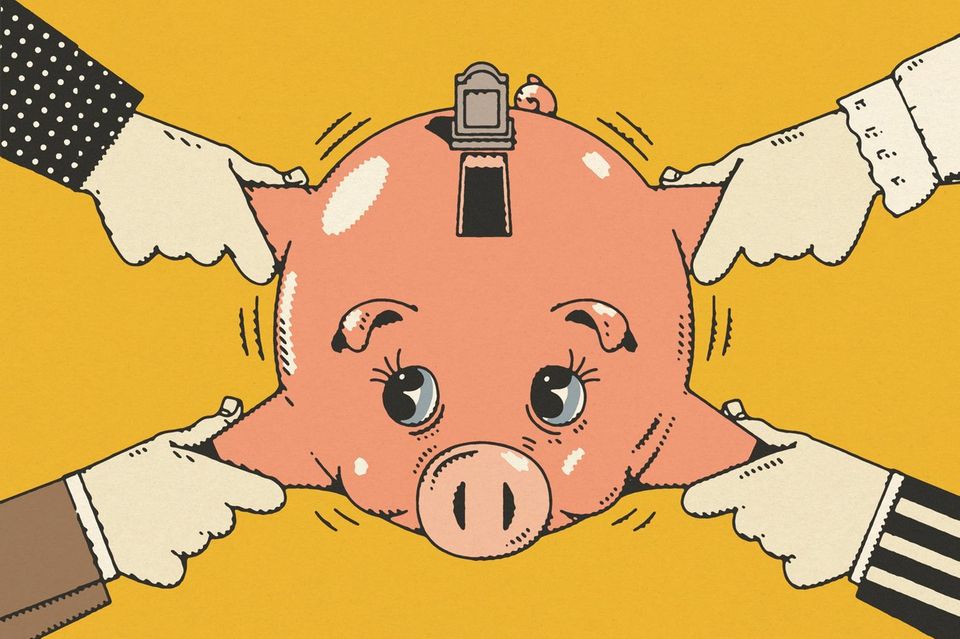Das bedingungslose Grundeinkommen entwickelt sich zum Evergreen, ohne je ein Hit gewesen zu sein. Seit rund 15 Jahren wird in Deutschland immer wieder über diese sozialpolitische Utopie diskutiert. Die Grundidee hat sich dabei kaum verändert: Jeder Bürger eines Landes soll vom Staat einen monatlichen Geldbetrag erhalten, mit dem er zumindest seine Grundbedürfnisse finanzieren kann, ohne dafür jemals eine Gegenleistung erbracht zu haben oder erbringen zu müssen. Auch die Bedürftigkeit spielt für die Auszahlung keine Rolle.
Die Befürworter sehen im Grundeinkommen wahlweise ein von Bürokratie und staatlichem Zwang befreites Instrument zur Absicherung gegen Armut, ein Fördermittel für künstlerische oder anderweitig wertvolle Arbeit oder einen Beitrag zu einer von gegenseitigem Vertrauen geprägten Gesellschaft. Auch könnte die Sorge der Menschen, wegen der Digitalisierung den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, durch die Aussicht auf ein Grundeinkommen gemildert werden. Während der Corona-Krise bekam die Idee erneut Rückenwind, weil vielen Selbstständigen und Beschäftigten unverschuldet Einkommen weggebrochen ist.
Auch wenn das Grundkonzept klar ist, gibt es sehr unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten: Wie hoch soll das monatliche Grundeinkommen sein? Soll es die bestehenden Sozialleistungen ganz oder teilweise ersetzen? Wie würde es steuerpolitisch flankiert? Insbesondere sind aber zwei grundsätzliche Fragen zu klären, sofern das Grundeinkommen wirklich bedingungslos und in einer Höhe ausgezahlt werden soll, dass daraus ohne jeden Hinzuverdienst das sozial-kulturelle Existenzminimum abgedeckt wäre.
- Wie passt ein bedingungsloses Grundeinkommen, das die Arbeitsanreize je nach Ausgestaltung empfindlich stören würde, in eine Zeit des Fachkräftemangels und des absehbar sinkenden Arbeitskräftepotenzials?
- Wie sollen die durch das Grundeinkommen drastisch steigenden Staatsausgaben finanziert werden?
Zur ersten Frage: Anreize spielen in einer Marktwirtschaft eine zentrale Rolle. Wenn sie verzerrt oder gestört werden – etwa durch Steuern, Sozialabgaben, üppige Sozialleistungen oder ein Grundeinkommen –, gibt es Fehlentwicklungen am Arbeitsmarkt und in der Volkswirtschaft insgesamt. Das bedingungslose Grundeinkommen würde im unteren Lohnsegment das Lohngefüge durcheinanderwirbeln, weil die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer gestärkt würde und für unangenehme, belastende oder langweilige Tätigkeiten wohl deutlich höhere Löhne verlangt würden. Höhere Löhne für Geringverdiener sind durchaus wünschenswert, wobei der Mindestlohn schon heute besonders krasse Fälle von Lohndumping verhindert.
Die Folgen wären aber auch steigende Kosten für die Unternehmen und steigende Preise für die Verbraucher. Arbeitsplätze könnten ins Ausland abwandern, in denen weiter das alte Lohngefüge vorherrscht. Teile der Arbeit würden ganz einfach liegen bleiben, wenn niemand mehr bereit ist, die nun höheren Löhne zu zahlen. Davon betroffen wären sicher auch haushaltsnahe Dienstleistungen, die wegen der höheren Lohnforderungen oft unerschwinglich wären. Für den einzelnen Bürger könnte es in vielen Bereichen wieder heißen: Do it yourself! Die arbeitsteilige Wirtschaft würde beschädigt.
Anreize dürften nicht unterschätzt werden
Finanziert werden soll ein bedingungsloses Grundeinkommen durch höhere Steuern. Das wiederum würde vor allem die Leistungsanreize derjenigen stören, die ohnehin schon hohe Steuern zahlen. Sie könnten Aufträge ablehnen, weniger arbeiten und Unternehmen könnten ins Ausland ausweichen. Auch würden durch die höhere Steuerlast die Anreize gestärkt, verstärkt in der Schattenwirtschaft zu arbeiten. All das ließe die Steuerbasis erodieren, aus der das Grundeinkommen finanziert werden müsste.
Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens bezweifeln die Rolle von Anreizen. Sie argumentieren, dass Menschen auch dann arbeiten würden, wenn ihr Lebensunterhalt bereits gesichert ist. Etwaige Fehlanreize werden als unbedeutend eingestuft. Sicher spielt die intrinsische Motivation für die Arbeitskräfte auch eine Rolle und der Arbeitseinsatz wird nicht allein über finanzielle Anreize gesteuert. Bei einem ausgeprägten Arbeitsethos können Anreize zumindest für eine gewisse Zeit in den Hintergrund treten, sodass einzelne Menschen auch dann arbeiten, wenn sie davon finanziell nicht profitieren. Von solchen vorübergehenden Ausnahmefällen abgesehen nehmen finanzielle Anreize aber eine zentrale Rolle bei der Arbeitszeit-Freizeit-Entscheidung ein.
Zudem ist zu berücksichtigen: Das Arbeitsethos der Menschen ist vielleicht auch nur deshalb so hoch, weil ihnen von Anfang an beigebracht wurde, dass jeder für seinen Lebensunterhalt zunächst selbst verantwortlich ist. Was wäre aber, wenn jeder mit der Gewissheit aufwächst, auch ohne eigene Anstrengung einigermaßen bequem durchs Leben zu kommen?
Beobachtungen aus mehreren Pilotprojekten im Ausland haben gezeigt, dass Bezieher eines zeitlich befristeten Grundeinkommens vielfach trotzdem weiterarbeiten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat nun kürzlich in Kooperation mit dem Verein „Mein Grundeinkommen“ eine experimentelle Studie gestartet , mit der ab dem Frühjahr 2021 ermittelt werden soll, wie sich durch die Zahlung eines bedingungslosen Grundeinkommens das Verhalten und die Einstellung der Probanden verändern. Dafür sollen 120 Personen drei Jahre lang 1200 Euro pro Monat erhalten – bedingungslos und mit allen Hinzuverdienstmöglichkeiten.
Immense Kosten
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Aussagewert der Ergebnisse – wie bereits bei den Pilotprojekten in anderen Ländern – nur gering sein wird. Die Teilnehmer haben schon deshalb einen erheblichen Anreiz weiterzuarbeiten, weil das Projekt zeitlich begrenzt ist. Nach drei Jahren muss der Lebensunterhalt wieder aus eigener Erwerbsarbeit bestritten werden. Die Teilnehmer dürften also auch während der Projektphase am Erhalt ihres Marktwertes interessiert sein. Eine dreijährige Pause im Lebenslauf macht sich nicht überall gut. Wenn Menschen trotz der Zahlung eines Grundeinkommens weiterarbeiten, dann taugt das kaum als Beleg für dessen Anreiz-Unschädlichkeit, sondern eher für die Existenz von Mitnahmeeffekten. Aufschlussreicher als die Analyse der befristeten Experimente wäre es, die Verhaltensänderungen der Lotterie-Gewinner einer lebenslangen Sofortrente zu untersuchen. Meines Wissens gibt es dazu aber noch keine wissenschaftliche Analyse.
Zur zweiten Frage der Finanzierung: Die Kosten werden von den Befürwortern eines bedingungslosen Grundeinkommens wahlweise kleingeredet und mit etwas kuriosen Methoden nach dem Motto „Was nicht passt, wird passend gemacht“ schöngerechnet. Oder die Kosten werden gar nicht erst berücksichtigt.
Doch die Kosten wären in der Praxis wohl immens, wenn das Grundeinkommen mindestens das sozial-kulturelle Existenzminimum abdeckt. Es könnte auch nicht einfach alle anderen heutigen Sozialleistungen wie zum Beispiel die erworbenen Rentenansprüche ersetzen, die Sozialausgaben würden also deutlich steigen. Und schließlich hört man recht wenig über die internationalen Migrationsbewegungen, die von einem im deutschen (oder europäischen) Alleingang eingeführten Grundeinkommen ausgelöst würden. Das ist aber ein entscheidender Punkt. Wenn ein Land allein ein derartiges Grundeinkommen einführt, wären die internationalen Sogwirkungen für Zuwanderer so groß, dass die Landesgrenzen wohl streng gesichert werden müssten. Gleichzeitig würden die Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern, sodass die Finanzierungsbasis erodiert. Das System würde also schnell kollabieren, sofern das Grundeinkommen nicht international koordiniert und in vielen Ländern gleichzeitig eingeführt wird – was reichlich unrealistisch ist.
Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens entspringt sicherlich einer guten Absicht. Doch der Weg von einer guten Absicht zu einem guten Ergebnis ist oft lang und steinig. Auch wissenschaftlich begleitete, zeitlich begrenzte Experimente dürften kaum weiterhelfen. Zumal Deutschland bereits ein großes sozialpolitisches Experiment hinter sich hat, bei dem die Anreizwirkungen großzügiger Sozialleistungen nicht ernst genommen wurden und hohe Arbeitslosenzahlen die Folge waren – bei gleichzeitig ausgeprägter Schattenwirtschaft. Erst die Sozialreformen der Regierung Gerhard Schröder haben die Fehlanreize korrigiert und die positive Trendwende am Arbeitsmarkt gebracht – und den Anteil der Schattenwirtschaft von knapp 17 Prozent im Jahr 2003 auf gut 9 Prozent des offiziellen BIP sinken lassen. Auch wenn im bestehenden System nicht alles perfekt ist und es gerade im Bereich der Hinzuverdienstmöglichkeiten Verbesserungsbedarf gibt, ist Deutschland mit diesem aktivierenden Sozialstaat gut aufgestellt und braucht für die absehbare Zukunft keine waghalsigen sozialpolitischen Experimente.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden