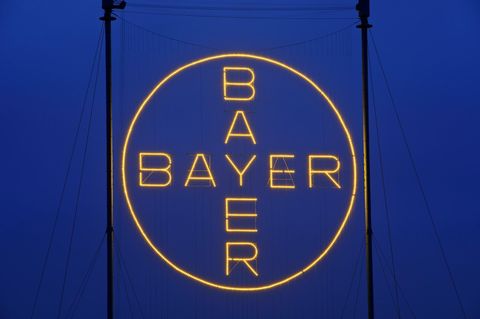Viele Jahre lang galt für viele deutsche Konzerne die Erfolgsdevise „Weiter so“. Man redete in den Chefetagen zwar immer wieder von „großen Herausforderungen, aber im Kern lief alles nach bewährtem Muster. Nun geht diese Zeit für mindestens vier große Industrieunternehmen zu Ende: 2024 entscheidet sich für BASF, Bayer, Thyssenkrupp und Volkswagen, ob sie endgültig den Anschluss an die Besten ihrer jeweiligen Branche verlieren oder ob ihnen doch noch ein Befreiungsschlag gelingt. Da alle vier eine wichtige Rolle für die Gesamtwirtschaft spielen, geht diese Frage nicht nur die Beschäftigten und die Aktionäre dieser Konzerne an, sondern am Ende uns alle.
Bei BASF steht ein Geschäftsmodell zur Disposition, das über 100 Jahre lang den Erfolg des Unternehmens garantierte. Der Konzern nennt es das „Verbundprinzip“: Man baute erst in Ludwigshafen, dann in Belgien, in den USA und China gewaltige Kombinate, die BASF durch intelligente Verknüpfung von chemischen Anlagen und Energieflüssen zum „Weltmeister der Effizienz“ machen sollten, wie es in der offiziellen Unternehmensdarstellung heißt. Der Konzern blieb ein Generalist, während fast alle Konkurrenten einen anderen Weg gingen und sich spezialisierten. Nun lässt sich mit vielen Chemikalien, die im Verbund bei BASF entstehen, nicht mehr genug Geld verdienen. Und weil der Konzern nebenbei auch noch sehr viele unternehmerische Fehlentscheidungen in den letzten 25 Jahren traf (zum Beispiel den Einstieg in die russische Erdöl- und Erdgas-Förderung), fehlt nun auch das Geld für weitere Rieseninvestitionen in die Verbundstandorte. Der neue BASF-Chef Markus Kamieth kann nicht weiter machen wie bisher, ohne die Zukunft des Konzerns zu verspielen.
Das Gleiche gilt für Bayer: Der Konzern hat die größte Investition seiner Geschichte, die Milliarden-Übernahme von Monsanto, so gründlich in den Sand gesetzt, dass nun der der weitere Fortbestand des ganzen Unternehmens in Gefahr gerät. Bayer schleppt eine Verschuldung von fast 40 Mrd. Euro mit sich herum und wird durch verlorene Gerichtsverfahren in den USA immer weiter belastet. Weil auch die Pharmasparte nicht mehr rund läuft, fehlen Bayer an allen Ecken und Enden Mittel für Investitionen. In seiner jetzigen Gestalt – mit den drei Sparten Agrar, Pharma und Konsumenten – kann der Konzern nicht mehr global an der Spitze mitmarschieren. Auch in Leverkusen liegt eine ungeheure Last auf den Schultern des neuen Chefs Bill Anderson, der die fatalen Fehler seines Vorgängers ausbaden muss.
Thyssenkrupp und das Stahl-Problem
Besonders eng wird es mittlerweile für Thyssenkrupp, wo ebenfalls ein neuer Mann seit einigen Monaten sein Glück versucht: Miguel López. Nach zahllosen Organisations- und Strategiewechseln, immer weiteren Verlusten und der fast völligen Aufzehrung des Finanzpolsters, das durch den Verkauf der hochprofitablen Aufzugssparte entstanden war, geht der unternehmerische Spielraum für den Konzern als Ganzen gegen null. Bisher ist ein Befreiungsschlag für die Stahlsparte, den Kern aller Probleme im Konzern, nicht in Sicht. Am Schluss bleibt vermutlich nur die Zerschlagung – oder Lopez gelingt ein Wunder.
Und was macht Volkswagen in dieser Reihe? Auf den ersten Blick kann sich der Wolfsburger Konzern noch am ehesten ein „Weiter so“ leisten. Durch Porsche kommt immer noch viel Geld in den Konzern, von einer Überschuldung kann keine Rede sein, die Umsätze steigen und als globaler Anbieter kann sich das Unternehmen mit seinen Rivalen durchaus messen. Aber das wichtigste Kerngeschäft – die Marke VW – wirft kaum noch Geld ab und kann sich die gewaltigen Investitionen in das E-Auto nicht mehr leisten, wenn es so weiter geht. Zudem hat sich der Konzern so stark vom Geschäft in China abhängig gemacht, dass jede Erschütterung auf dem größten Absatzmarkt sofort zu einer tiefen Krise führen würde. Deshalb wird auch für die Wolfsburger 2024 zum Entscheidungsjahr.