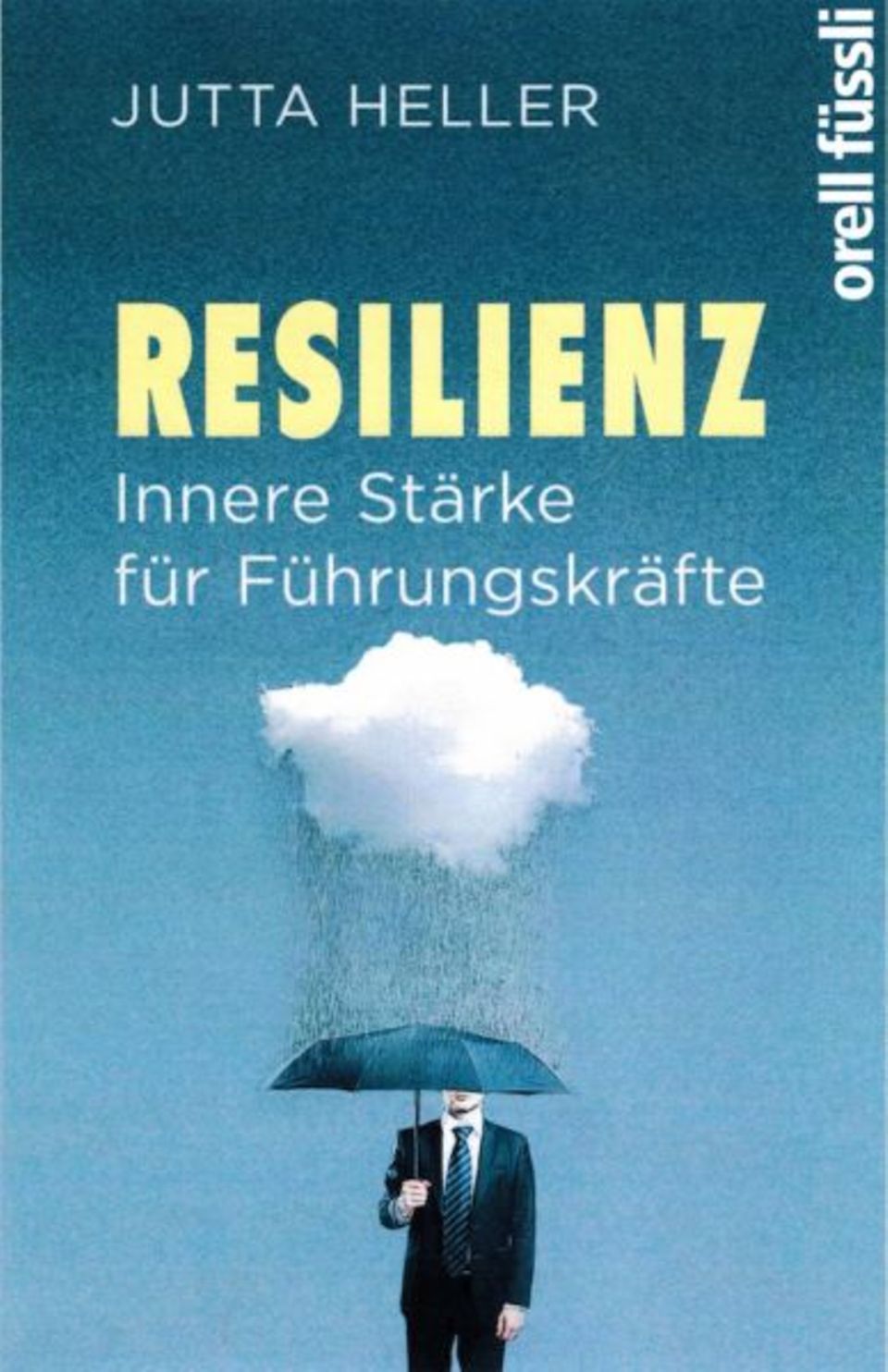Jutta Heller ist Expertin für Resilienz und Veränderungskompetenz. Sie arbeitet als Beraterin und Coach. Außerdem ist sie Professorin für Training & Business-Coaching an der Hochschule für angewandtes Management und Autorin mehrerer Bücher über Resilienz.
In manchen Teams klappt's einfach: Schwierige Aufgaben werden gemeinsam gemeistert, man kann sich aufeinander verlassen, und Erfolge werden am liebsten gemeinsam gefeiert. Bei anderen hakt es ständig – Getuschel hinter dem Rücken der anderen, Aufgaben werden bewusst verschleppt und Informationen nicht weitergegeben, und im Grunde hoffen alle darauf, möglichst bald woandershin versetzt zu werden.
Und dann gibt es die Konstellation, die man am häufigsten findet: Das Team kommt erfolgreich durch den Firmenalltag, scheint ganz gut zu funktionieren - bis es zur Krise kommt. Vielleicht wird ein wichtiger Kunde störrisch, vielleicht wird ein zentraler Prozess im Unternehmen umgestellt – so oder so, das Team muss sich als Ganzes einem unvermeidlichen Problem stellen und plötzlich entstehen Konflikte, Streitigkeiten, bis hin zu Handlungsunfähigkeit.
So plötzlich, wie es scheint, treten diese Reibungspunkte natürlich nicht auf. Effiziente Teams, die auch große Herausforderungen erfolgreich meistern, arbeiten nämlich schon in guten Zeiten an einer wichtigen Eigenschaft: Resilienz.
Elastisch auf Herausforderungen reagieren
Resiliente Teams unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise erst einmal nicht von anderen. Gutes Projektmanagement, gute Zusammenarbeit – das gibt es auch in anderen Teams. Resiliente Teams zeigen ihre Stärke besonders in Belastungssituationen: Da reagieren sie nämlich wie eine Sprungfeder, die dem Druck zwar nachgibt, aber ganz schnell wieder in ihre ursprüngliche Position zurückfindet. Dieses Bild veranschaulicht gut die zwei Kernelemente der Resilienz: Flexibilität, um elastisch auf unvorhergesehene und neue Situationen reagieren zu können – und Stärke, um so schnell wie möglich wieder in eine arbeitsfähige Form zu finden und die Krise sogar positiv nutzen zu können. Aufstehen, Krone zurechtrücken, weitergehen – das ist der Königsweg der Resilienz nach dem Hinfallen.
Der Schlüssel zur Teamresilienz liegt in einer Vielzahl von Eigenschaften und Handlungsmustern, die jedes Team trainieren kann. Dazu zählen eine gemeinsame Wertebasis, eine funktionierende Teamkommunikation und die Konzentration auf eigene Stärken.
Gemeinsame Werte finden
Für viele Teams der Super-GAU: Der wichtigste Kunde kündigt an, abspringen zu wollen. Er kann dieselbe Lösung von einem anderen Unternehmen wesentlich günstiger erhalten und fordert einen empfindlichen Preisnachlass – sonst ist er raus.
Wie reagiert das Team? Kann sich der Produktmanager darauf verlassen, dass die Vertrieblerin die äußerste Grenze des Machbaren respektiert und den Preis nicht zu weit senkt? Kann umgekehrt die Vertrieblerin darauf zählen, dass alle mit Biss und Entschlossenheit für den wichtigen Kunden kämpfen?
Grundlage dafür, in schwierigen Situationen schnell und geschlossen zu einer tragfähigen Lösung zu kommen, ist eine gemeinsame Wertebasis. Wenn sich alle Teammitglieder klar darüber sind, nach welchen Werten sich ihre Entscheidungen richten, sind die Entscheidungswege kurz und die Akzeptanz für einmal getroffene Entscheidungen groß.
Gemeinsame Werte in einem Team entstehen nicht nebenbei. Jedes Team, das effizient auch in Krisenzeiten zusammenarbeiten will, muss seine Wertebasis erst definieren und die wirklich wichtigen Werte, die späteres Handeln leiten, auswählen. Das geht am besten im Rahmen eines Teamentwicklungsworkshops, in dem oft hart verhandelt werden muss, um einen Konsens der wichtigsten Werte zu finden. Ganz abgesehen davon, dass die Definition der einzelnen Werte erst erarbeitet werden muss – die fällt von einem Teammitglied zum anderen oft sehr unterschiedlich aus!
Orientierungsmuster erkennen
Missverständnisse treten nicht nur bei der Definition gemeinsamer Werte auf, sondern auch in jeder anderen Kommunikation zwischen Menschen. Eine funktionierende Teamkommunikation ist essenziell dafür, dass Teams flexibel und situationselastisch reagieren können – gerade in schwierigen Situationen.
Die Grundlagen einer guten Kommunikation sind wohl inzwischen in jedem Unternehmen angekommen: Aktives Zuhören, Kommunikation durch Körpersprache und das Vier-Ohren-Modell sind längst keine Zauberworte mehr. Dennoch bleibt ein großer Schritt von der Theorie in die Praxis! Außerdem ist es hilfreich, wenn sich alle Teammitgliedern immer wieder klarmachen, dass Botschaften nicht nur unterschiedlich ankommen, sondern dass auch alle Sender unterschiedlich sind. Soll heißen: Wir handeln, kommunizieren, denken in unterschiedlichen Orientierungsmustern, die wie ein Filter die Wahrnehmung unserer Umwelt beeinflussen. Ob jemand das große Ganze sieht oder die wichtigen Details, ob er/sie sich auf die Gemeinsamkeiten aller möglichen Lösungen konzentriert oder darauf, was jede von ihnen einmalig macht, das macht einen großen Unterschied in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Wenn Teammitglieder lernen, solche Orientierungsmuster zu erkennen und zu beachten, wird die Teamkommunikation effizienter und vermeidet Missverständnisse gerade in Stresssituationen.
Team-Ressourcen nutzen
Auch wenn viele Probleme neu sind: Oft macht es Sinn, wenn ein Team sich darauf besinnt, wie es andere Probleme bereits erfolgreich bewältigt hat. Jedes Team hat seine ganz spezielle Art, mit Herausforderungen umzugehen. Wenn es gelingt, diese Art zu identifizieren und zu erkennen, welche Stärke ihr zugrunde liegt, hat das Team eine wichtige Ressource für zukünftige Herausforderungen gefunden. Wo eine gemeinsame Wertebasis ermöglicht, schnell konsensfähige Entscheidungen zu treffen, da eröffnet das Wissen um die spezifischen Teamstärken die Möglichkeit, diese Stärken gezielt auszubauen und effizienter zu arbeiten. Ein Beispiel: ein Team stellt fest, dass seine besondere Stärke darin liegt, neue Informationen schnell in bestehende Arbeitsprozesse einzubeziehen. Das Team arbeitet daraufhin daran, die Prozesse noch weiter zu flexibilisieren, um Handlungsspielräume zu schaffen. Sein Fokus bei der nächsten Krise liegt darauf, möglichst viele Informationen über die Situation zu erhalten und so die Abläufe ideal der geänderten Situation anzupassen.
Innere Stärke für Teams
Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder, und gemeinsam kann ein Team innere Stärke entwickeln, mit der es Herausforderungen und Krisen trotzen kann. Ein Umdenken ist notwendig, um den Fokus von der Widerstandskraft jedes Einzelnen auszuweiten auf die Widerstandskraft der inneren Strukturen eines ganzen Unternehmens. Denn: starke Teams sind wichtiger denn je – die nächste Krise kommt bestimmt.