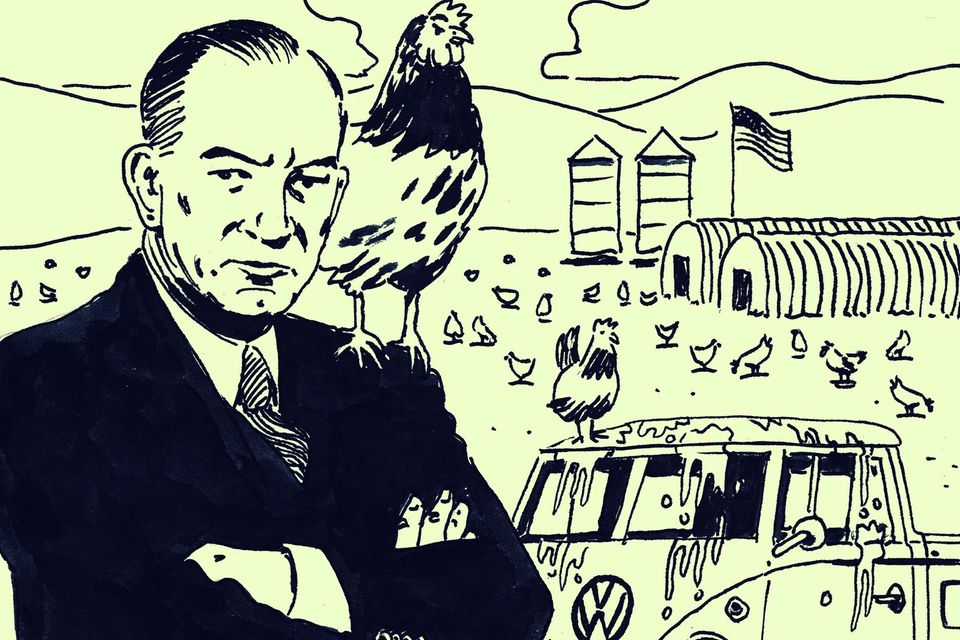Unter westlichen Ökonomen, Investoren und Politikern gehört es zum guten Ton, die offiziellen chinesischen Wirtschaftsdaten in Frage zu stellen. Wer die Zahlen ernst nimmt, macht sich rasch lächerlich. Man gilt im besten Fall als naiv und im schlimmsten Fall als Handlanger der kommunistischen Propaganda.
Doch diese Sichtweise ist trügerisch. Abgesehen von der politisch sensiblen realen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die unter scharfer Beobachtung steht, sind viele andere Zahlen durchaus plausibel. Sie zeichnen ein genaues Bild der Drosselung in der chinesischen Wirtschaft, von der die Skeptiker behaupten, sie werde geheimgehalten. Wenn sich tatsächlich jemand verschworen hat, das Ausmaß der Krise in China zu verbergen, dann bleibt diese Verschwörung doch weitgehend an der Oberfläche.
Als China Mitte August überraschend seine Währung abwertete, war dies Wasser auf die Mühlen derer, die den offiziellen Angaben misstrauen. Die Entscheidung galt als Beleg dafür, dass die Regierung zu drastischen Maßnahmen greift, um eine schwer angeschlagene Wirtschaft zu stützen.
Tricksen mit der Inflationsrate
Doch was war genau geschehen? Für das erste Halbjahr 2015 verkündete Peking ein reales BIP-Wachstum von sieben Prozent, was exakt dem von Ministerpräsident Li Keqiang für das Jahr vorgegebenen Ziel entsprach. Aus Sicht der Skeptiker wirkte die Zahl unglaubwürdig, auch weil andere Daten eine deutliche Abkühlung in der Produktion und im Bausektor zeigten – und damit bei den üblichen Wachstumstreibern des Landes.
Experten sind sich weitgehend einig, dass die vierteljährlich veröffentlichten realen Wachstumszahlen politisch "geglättet" werden, um den Eindruck scharfer Umschwünge in der Wirtschaft zu vermeiden. Es ist dies eine Lehre aus der Asienkrise von 1998 und der globalen Finanzkrise zehn Jahre später. Genutzt wird dabei vor allem der Faktor der Preisbereinigung, der den Unterschied zwischen nominalem und realem Wachstum ausmacht. Indem Chinas Statistiker bei der Inflationsrate untertreiben, erwecken sie den Eindruck, dass die Wirtschaft real stärker wächst.
Doch das Manko bei dieser einen Zahl hindert uns keineswegs daran, die Trends in der chinesischen Wirtschaft zu verstehen. Es reicht schon ein Blick auf das nominale BIP-Wachstum, bei dem die Inflation nicht berücksichtigt wird, um zu sehen, in welch problematischem Zustand sich die wichtigsten Wirtschaftszweige Chinas befinden. "Das reale BIP-Wachstum Chinas ist eines der am wenigsten volatilen der Welt", schrieb Wei Yao, China-Expertin der Société Générale, unlängst. "Doch die nominalen BIP-Werte sind in vielerlei Hinsicht plausibler."
Lieber nominal als real
Die chinesische Industrie, darunter Maschinenbau, Bergbau und öffentliche Versorger, wuchs im zweiten Quartal dieses Jahres um 1,2 Prozent – ein mickriger Wert im Vergleich zu den durchschnittlich erreichten fünf Prozent vom Jahr 2014. Der Bausektor legte um 4,1 Prozent zu, fast sechs Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Am stärksten wächst mittlerweile die chinesische Dienstleistungsbranche.
Diese nominalen Wachstumszahlen sind in der Praxis deutlich wichtiger als die preisbereinigten. So kann ein Unternehmen, das seinen Umsatz kalkuliert, mit realen Wachstumsdaten wenig anfangen. Das gleiche gilt für Rohstoff-Exporteure in Lateinamerika und Afrika, die einen Rückgang der chinesischen Einfuhren sowohl bei den Volumina als auch bei den erzielten Erlösen beobachten.
Behörde unter Druck
Ein überzeugter Verteidiger der offiziellen chinesischen Daten ist Carsten Holz, Wirtschaftsprofessor an der Universität in Hongkong, der auch in Harvard und Stanford gelehrt hat. Aus seiner Sicht ist die Schummelei mit der Preisbereinigung "ausgesprochen ärgerlich für detailversessene Analysten aber für praktische Zwecke kaum relevant". Holz glaubt nicht, dass Li oder seine Stellvertreter dem Nationalen Statistikamt den Befehl erteilen, eine bestimmte Wachstumszahl zu veröffentlichen. Allerdings stehe die Behörde unter dem Druck, bestimmte Planziele zu erfüllen und sie dürfe eine schlechte ökonomische Stimmung nicht noch befeuern.
Darüber, wie die Preisbereinigung für das BIP berechnet wird, gibt das Statistikamt nur wenig Aufschluss. Holz geht davon aus, dass nur die fünfköpfige Parteizelle in der Behörde eine abschließende Entscheidung fällen kann. Dazu gehören Kommissar Ma Jiantang und seine drei Stellvertreter, darunter Xu Xianchun, der die Abteilung für volkswirtschaftliche Gesamtrechnung leitet. "Xu Xianchun sitzt da und weiß, er muss die Zahlen ein bisschen nach oben drücken", sagt Holz. Dann schaue er sich seine Unterlagen an und entscheide sich für den BIP-Deflator, der die Wachstumsrate ein kleines bisschen größer erscheinen lässt.
Ein solches Szenario ist nicht geeignet, das Vertrauen in die chinesischen Daten zu stärken, aber Holz sieht trotzdem keine brauchbaren Alternativen. Der Ökonom hat die offiziellen Angaben einem Stresstest unterzogen, bei dem er mehrere unterschiedliche Indizes zur Preisbereinigung einsetzte. Das Ergebnis war, dass das durchschnittliche Realwachstum Chinas zwischen 1978 und 2011 irgendwo zwischen 9,1 und elf Prozent gelegen haben muss. Damit erscheint die offizielle Zahl von 9,8 Prozent für diesen Zeitraum immer noch als ganz brauchbar. "Ich halte die offiziellen Angaben für das beste, was auf dem Markt ist", sagt Holz. "Aber natürlich gibt es eine Bandbreite möglicher Zahlen für das Realwachstum, die alle ihre Berechtigung haben. Der Wert von sieben Prozent für 2015 könnte bis 6,5 Prozent nach unten abweichen, aber auch bis 7,2 nach oben."
Streit um die Zahlen
Völlig anders als Holz sieht Harry Wu die Lage. Der Wirtschaftsprofessor an der Hitotsubashi-Universität in Tokio lieferte schon 1995 erstmals eine abweichende Einschätzung zu Chinas BIP-Zahlen und hat seine Analyse in den letzten 20 Jahren stetig verfeinert. Er kommt zu dem Schluss, dass das durchschnittliche Realwachstum Chinas zwischen 1978 und 2014 bei 7,1 Prozent lag und damit 2,5 Prozentpunkte niedriger als in der offiziellen Schätzung. Im vergangenen Jahr betrug das Wachstum danach nur noch 3,9 Prozent, eine erhebliche Abweichung von den sieben Prozent, die die Statistikbehörde angegeben hatte.
Wu und Holz haben sich im Disput über diese Zahlen sogar überworfen und zeitweise nicht mehr miteinander gesprochen. Ein Streit unter Fachleuten. Doch je mehr Sorgen sich die Welt um Chinas Wirtschaft macht, desto mehr Leute machen sich mittlerweile Gedanken über die Verlässlichkeit der chinesischen Daten. Ein Beispiel ist Michael Parker, Volkswirt bei Bernstein Research in Hongkong, der mit den Skeptikern wenig anfangen kann. "Die Vorstellung, dass irgendjemand Zehntausende von chinesischen Statistikern dazu bringt, über ein Jahrzehnt oder länger gefälschte Daten abzuliefern, ist aus unserer Sicht nicht plausibel", sagt Parker.
Wer die Debatte zwischen Wu und Holz verfolgt, begibt sich in ein Dickicht aus Indizes, Input-Output-Tabellen und unterschiedlichen Hypothesen über das Produktivitätswachstum im Dienstleistungssektor. Es ist ein Wettstreit, der im einzelnen kaum noch nachzuvollziehen ist. Interessant aber ist, dass die Kontrahenten in vielem durchaus übereinstimmen. So verweisen beide auf Probleme bei der Beurteilung des Industriesektors durch die Statistikbehörde NBS. Seit 2008 veröffentlicht die NBS keine Rohdaten für die Industrieproduktion mehr, weil die Zahlen die Behörde in Erklärungsnöte gstürzt hatten. Die von Großunternehmen gemeldeten monatlichen Produktionsziffern waren im Jahr 2007 höher als die gesamte Industrieproduktion, die aus den Quartalsangaben für das BIP hervorgingen. Ein Ding der Unmöglichkeit also.
Märchen aus der Provinz
Der Grund für derart paradoxe Statistiken liegt vermutlich darin, dass Unternehmen und lokale Behörden übertriebene Produktionsziffern melden. Es ist seit jeher üblich, dass die Kommunistische Partei interne Beförderungen ihrer Kader-Funktionäre vom lokalen BIP-Wachstum in deren Regionen abhängig macht – eine Praxis, die sich nur allmählich wandelt.
Der große Unterschied zwischen Holz und Wu besteht in der Frage, wie man auf diese offenkundigen Mängel reagieren sollte. Holz vertraut darauf, dass das NBS wie ein Filter funktioniert und bei der Zusammenstellung der Ziffer für den Industrieoutput die gröbsten Übertreibungen aussortiert. Aus seiner Sicht sind die Angaben für das nominale BIP größtenteils korrekt, weshalb nur die Preisbereinigung ein Problem darstellt. Wu hingegen hält die gesamte Industrie-Komponente im BIP für unbrauchbar, weil Beamte in der Provinz unter dem Druck stehen, bestimmte Zielvorgaben zu erfüllen.
Beide Wissenschaftler halten die Art der Datenerhebung in China für problematisch. Wus Berechnungen aber weichen vor allem für Krisenphasen deutlich von den offiziellen Angaben ab. Sein Schluss: Fehler entstünden "nicht vorrangig wegen methodischer Defizite, sondern aufgrund politischer Einflussnahme". Aus Misstrauen gegenüber den offiziellen Daten entwickelte Wu eigene Statistiken mit einer jährlichen, sowjetisch anmutenden Liste von in China produzierten Waren – von Stahlrohren bis hin zu Toastern. "Lokale Regierungen können Mengenangaben aus der Produktion nicht manipulieren", sagt Wu. "Dazu sind es zu viele, und es ist zu kompliziert. Dazu müsste man ein Profi sein."
Wus Daten tragen im Detail zur Prüfung der realen Wachstumszahlen für China in den vergangenen Jahrzehnten bei. Holz aber glaubt nicht, dass diese Zahlenreihen besser sind als die offiziellen Angaben. Das Grundproblem aus seiner Sicht: Der industrielle Output lasse sich nicht verlässlich bestimmen, weil verbesserte Produktqualität und der inflationsbereinigte Wert neuer Waren nur schwer geschätzt werden könnten. Die Frage nach der Qualität ist dabei zentral: Sie entscheidet darüber, ob ein Preisanstieg tatsächlich auf einen gestiegenen Output zurückgeht oder einfach nur die Inflation reflektiert.
Zu viel Interesse an einer Zahl
Wu besteht darauf, dass seine Methode auch verbesserte Produkte und Neuentwicklungen berücksichtige. Trotzdem wirkt seine Ablehnung der chinesischen Angaben zur Industrieproduktion gerade jetzt merkwürdig. Die monatlichen Angaben, die lange mit Skepsis betrachtet wurden, zeigen einen deutlich stärkeren Rückgang als er sich in der allgemeinen Wachstumsrate widerspiegelt. Es ist gerade dieser Widerspruch, der das Misstrauen hinsichtlich der BIP-Wachtumsrate am stärksten befeuert.
Natürlich zeigt die mögliche Manipulation der Wachstumsziffern eine Schwäche der Institutionen und vor allem, dass es der Statistikbehörde NBS an Unabhängigkeit mangelt. Doch kurioserweise wird die Kritik der Skeptiker auch zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wäre die Aufmerksamkeit für diese eine Zahl nicht so groß, dann sänke auch der Anreiz daran herumzudoktern. Je eher also das reale BIP-Wachstum seine Fetisch-artige Bedeutung verliert, desto eher können wir mit verlässlichen Daten rechnen.
In China und anderen Staaten, deren Regierungen ihre politische Legitimation vor allem aus wirtschaftlichem Wachstum beziehen, wird die Führung immer vor der Versuchung stehen, Zahlen zu manipulieren. Doch wenn es um Chinas Wirtschaft wirklich so schlimm bestellt ist, dass die Stabilität des Landes bedroht ist, wird eine einzelne Ziffer kaum jemanden davon überzeugen, dass alles in Ordnung ist.
Dienstleistungen legen zu
Wer dieser Tage in der Debatte um Chinas Wachstum einen möglichst klugen und scharfzüngigen Eindruck machen will, sollte sich auf den sogenannten Li Keqiang-Index berufen. Dieser Indikator stützt sich auf ein Gespräch, das angeblich 2007 zwischen dem heutigen Premier Li und dem damaligen US-Botschafter Clark Randt stattfand und später von der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht wurde. Li, der damals Parteisekretär in der Provinz Liaoning war, sagte demzufolge, die Angaben zum BIP würden von "Menschen fabriziert" und seien daher nicht verlässlich. Er nutze stattdessen drei Indikatoren wirtschaftlicher Aktivität, die weniger stark beeinflusst würden: den Stromverbrauch, das Aufkommen an Bahnfracht und die Kreditvergabe der Banken.
Dieser Li Keqiang-Index ist mittlerweile Indiz Nummer Eins für die Behauptung, dass die Quartalszahlen für das BIP die wirtschaftliche Abkühlung verschleiern. Zusätzlich angeführt werden monatliche Werte wie die Anlageinvestitionen, die Industrieproduktion und die Verkäufe im Einzelhandel, die im vergangenen Jahr allesamt weniger zunahmen als das reale BIP.
Doch diese Zahlen lassen eines außer Acht – den Dienstleistungssektor, der mittlerweile von allen Wirtschaftsbereichen am schnellsten wächst. "Die Stahlproduktion zum Beispiel ist deutlich energieintensiver als die Unterhaltungsbranche", sagt Nicholas Hardy, China-Experte am Peterson Institute for International Economics. "Die Stromnachfrage nimmt also stark ab, weil sich die volkswirtschaftliche Struktur weiterentwickelt." Den Strommarkt als Messlatte für die allgemeine wirtschaftliche Expansion Chinas zu benutzen sei so, "als ob man ein Auto fährt und dabei nur in den Rückspiegel schaut".
Abgesehen vom Strukturwandel in der Wirtschaft trugen im Frühjahr 2015 auch Einmaleffekte in anderen Sektoren dazu bei, dass der Rückgang in der alten Schwerindustrie aufgefangen werden konnte. So führte der Boom auf dem Aktienmarkt dazu, dass die Finanzdienstleistungen in zweiten Quartal aufs Jahr gerechnet um 27 Prozent zulegten. Ein Aufschwung, der sich allerdings abgeschwächt haben dürfte – seit die Börsen Ende Juni ihren Sinkflug starteten.
Copyright: The Financial Times Limited 2015