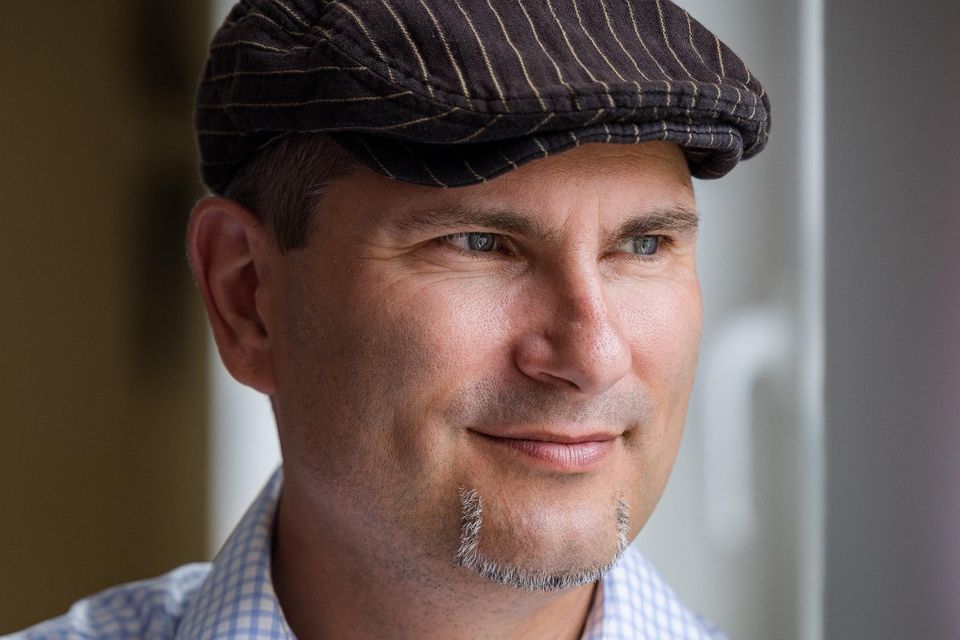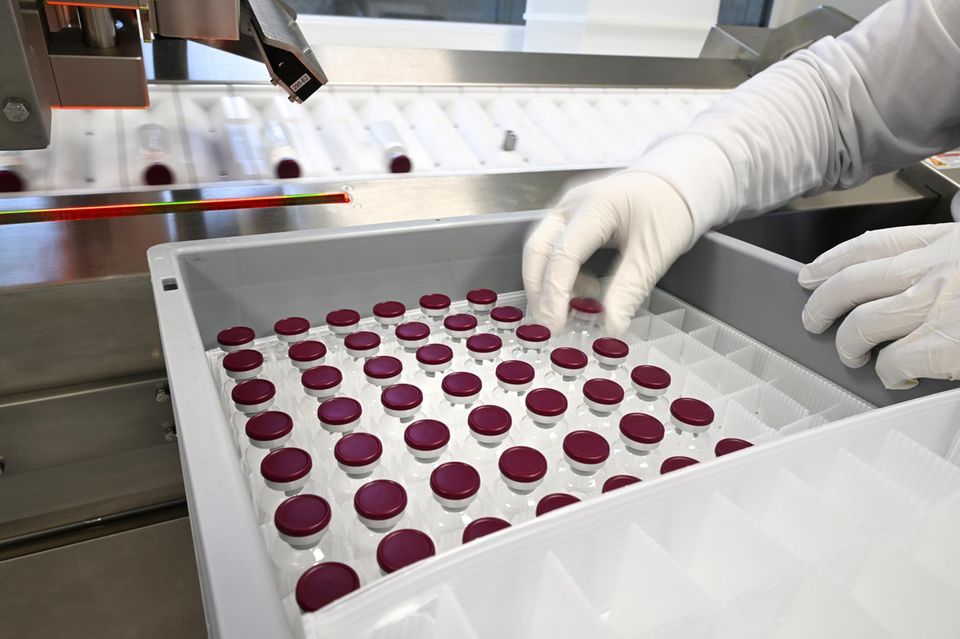Der gesellschaftliche Zeitgeist trägt seit längerem Eigenverantwortung. Die entsprechenden Aufrufe liegen voll im Trend, egal ob es um das Klima geht, die Gesundheitsversorgung oder den Verzicht auf Plastikstrohhalme.
Auch in Unternehmen wird fleißig an die Eigenverantwortung der Mitarbeiter appelliert, insbesondere wenn es wirtschaftlich mal drunter und drüber geht – so wie derzeit. In jedem Meeting seufzt mindestens einer: „Wenn hier jeder einfach nur seinen Job machen würde, wäre alles in Ordnung.“
Ich habe ja die Vermutung, dass in einem Unternehmen gar nichts mehr läuft, wenn alle nur ihren Job machen. Aber darum soll es in dieser Kolumne nicht gehen. Es sind diese fruchtlosen Appelle an die Eigenverantwortung, die mir sauer aufstoßen.
Sitzen im Park
Aktueller Ausgangspunkt meiner Überlegungen war eine Beobachtung, die ich vor ein paar Tagen in meiner Heimatstadt des Herzens gemacht habe. Ich saß in meinem Lieblingspark in Barcelona. Dieser kleine Park gehört zum Gelände des ehemaligen olympischen Dorfs. Hier haben sich 1992 die Athleten getummelt, erholt oder ein paar Leibesübungen gemacht. Aus dieser Zeit stammt auch noch das gläserne Security-Häuschen mitten im Park. Es ist klugerweise unter einem Baum platziert, damit der Sicherheitsmitarbeiter in seiner Box im Sommer nicht dampfgegart wird.
Tatsächlich ist dieses Häuschen auch heutzutage noch regelmäßig besetzt – nach welcher Regel, habe ich allerdings noch nicht herausgefunden.
Schützen im Park
Auf den ersten Blick scheint diese Überwachung absolut albern, denn außer mir ist praktisch nie jemand hier. Einzig am Sonntag werden ab und zu die Tischtennisplatten am Eingang zum Kuchenbüfett für einen Kindergeburtstag umfunktioniert, aber spätestens nach zwei Stunden ist die Sause wieder vorbei und die Ruhe wiederhergestellt.
Warum überträgt die Stadtverwaltung die Verantwortung für die Wahrung dieser Idylle dennoch an einen Wachmann – wo doch offensichtlich keiner da ist, der sie stört? Die Stadt könnte doch genauso gut an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren und sich die Ausgaben für die Security sparen. Übermäßig gut gefüllt ist schließlich auch Barcelonas Stadtsäckel nicht.
Eigenverantwortung adressieren
Von diesem Gedanken ausgehend fiel mir der Schweizer Autor Felix Frei ein. Er dekonstruiert in einem seiner Bücher ganz wunderbar den Begriff der Verantwortung im Kontext von Wirtschaft und Gesellschaft. Und er beobachtet scharf, dass Verantwortung und Eigenverantwortung ganz offenbar nicht das gleiche sind.
Wer von Eigenverantwortung spricht, adressiert in der Regel seine Mitarbeiter oder die Bürger: Sie mögen doch bitte mehr davon übernehmen. In diesen Worten schwingt stets ein gewisser moralischer Vorwurf mit, dass diese Eigenverantwortung von jedem erwartet werden könne, und zwar genau so, wie der Appellierende sich diese vorstellt.
Die Wortwahl in der Praxis ist sehr aufschlussreich, um nicht zu sagen verräterisch.
Verantwortung kassieren
Da fordert der Vertriebsleiter Schulze mehr Eigenverantwortung von seinen Leuten, weil das Abteilungsziel von 180 Mio. Euro Umsatz in Gefahr ist. Er selbst würde aber nie von sich sagen, dass er die Eigenverantwortung für 180 Millionen trägt. Er würde vielmehr formulieren: „Ich habe die Verantwortung dafür.“
Sein Vorgesetzter wiederum würde Herrn Schulze durchaus auf dessen Eigenverantwortung für die Erreichung des Ziels hinweisen. Bei sich selbst spräche dieser Chefchef dagegen vermutlich von seiner „Gesamtverantwortung“.
Sie sehen: Die Präfixe vor dem Begriff „Verantwortung“ scheinen im betrieblichen Alltag sehr deutlich mit dem Hierarchieverständnis zu korrelieren.
Zu viel verlangt?
Deshalb wird „mehr Verantwortung übernehmen“ im Unternehmen oft auch mit Karriere und mehr Gehalt gleichgesetzt – mehr Verantwortung wird also als etwas verstanden, was besser entlohnt werden muss.
„Mehr Eigenverantwortung übernehmen“ dagegen ist etwas, was ein Mitarbeiter unentgeltlich zu leisten hat. Das ist ja wohl das Mindeste, was erwartet werden darf.
Wann aber werden solche Appelle überhaupt erst laut?
Höflich belangt
Mein Eindruck ist, die Eigenverantwortungskarte wird immer dann gezückt, wenn der Laden nicht rund läuft und eigentlich keiner so recht weiß, warum. In dieser Situation ist es ein sehr menschlicher Reflex, die Ursache für das Knirschen zu personifizieren. Und weil es natürlich nicht mehr opportun ist, seinen Mitarbeitern auf den Kopf zuzusagen, dass sie zu blöd sind, spricht die Führungskraft von heute davon, dass ihre Leute den „falschen Mindset“ haben oder – noch ein bisschen höflicher formuliert – „nicht das nötige Maß an Eigenverantwortung“ zeigen.
Ich möchte an dieser Stelle den Mainzer Organisationsphysiker Gerhard Wohland zitieren: „Wer Helden oder Schuldige braucht, um ein Problem zu beschreiben, hat das Problem noch nicht verstanden.“ Das lässt sich zwanglos auf die Appelle an die Eigenverantwortung übertragen.
Einfluss verkannt
Ich will selbstredend nicht behaupten, dass der Einzelne gar keinen Einfluss auf das Gelingen oder Nicht-Gelingen einer Unternehmung hat. Aber ich wage mich schon aus der Deckung und behaupte: In mindestens 80, eher 90 Prozent der Fälle besteht bei genauem Hinsehen hinter dem Vorwurf der mangelnden Eigenverantwortung ein Problem in den Rahmenbedingungen. Der institutionelle Rahmen hat den weitaus größeren Einfluss darauf, wie Menschen handeln.
Menschen tun das, was sie tun, nahezu immer aus gutem Grund – und im Unternehmen findet sich dieser Grund meist in dessen unausgesprochenen oder ausgesprochenen Spielregeln. Denen sollten Sie auf die Spur kommen, wenn Sie ein Problem wirksam lösen wollen. Auch wenn es vordergründig ein Verhaltensproblem ist.
Problem benannt
Appelle an die Eigenverantwortung sind also eigentlich Hilferufe: „Achtung, hier stimmt etwas nicht!“
Führungskräfte, Organisationsentwickler und gerne auch Berater dürfen sie deshalb aus meiner Sicht als Arbeitsauftrag verstehen, tiefer zu bohren, um das wahre Problem zu finden. Das kann in mühsame Detektivarbeit ausarten. Dafür aber eröffnet sich die realistische Chance auf Veränderung.
Diese Chance besteht nicht, solange sich die ergriffenen Maßnahmen auf Appelle an die Eigenverantwortung beschränken. Wie auch, wenn zum Beispiel gar keine Verantwortung übrig ist, die die Mitarbeiter sich aneignen könnten …
Sauer appelliert
Das ist der Fall, wenn der Chef die eine Hälfte der Verantwortung für sich beansprucht und die andere Hälfte an das Regelhandbuch delegiert hat. Für die Mitarbeiter bleibt entsprechend kein Handlungsspielraum, in dem sie ihre Eigenverantwortung entfalten könnten. Und ich finde es nachvollziehbar, dass sich die Appelle des Chefs für sie wie Hohn anhören.
Wenn also die Mehrzahl der Probleme aus den Rahmenbedingungen erwachsen, müssen diese Appelle wirkungslos bleiben, was sich in der Realität auch fast immer beweist. Und sie müssen auf Dauer die Frustration und den Zynismus in der Belegschaft befördern.
Das muss einem doch sauer aufstoßen, oder?
Noch nichts kapiert
Am Ende dieser Überlegungen saß ich immer noch in meinem Park. Mein Blick fiel wieder auf die gläserne Box: Sie war immer noch leer.
Ich habe anschließend noch länger darüber nachgedacht, ob die zeitweise Anwesenheit des Security-Menschen an diesem friedlichen Fleckchen Erde Sinn macht oder nicht – vergeblich. Ich tippe darauf, dass das daran liegt, dass ich s noch nicht verstanden habe.