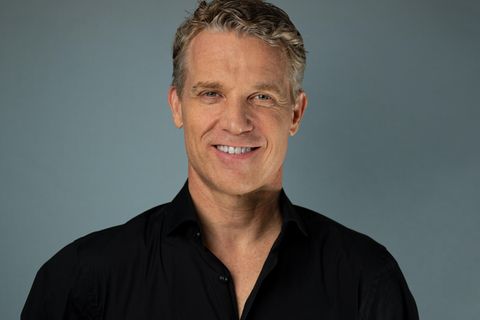In meiner letzten Kolumne ging es um Komplexität und wie sie unser Gehirn überfordern kann. Speziell was Führen und Entscheiden angeht, kommen wir unter Umständen schnell in Stress-Situationen. Wie kommen wir da im beruflichen Setting raus? Ich schrieb: „Soziales Lernen erhöht die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten in komplexen Situationen. Das bedeutet für Führungskräfte: weg vom einsamen Feldherrnhügel, runter in die Ebene. Verantwortung und Entscheidungsmacht verteilen, den Menschen vertrauen, die man für teuer Geld eingestellt hat. Räume des sozialen Lernens schaffen und die Ergebnisse dieser Räume tatsächlich in der Organisation weiterverarbeiten.“
Es gibt sie noch: die Feldherrn-Situation
Diese Idee ist immer noch richtig; allerdings kommt man hier manchmal auch an seine Grenzen. Nämlich dann, wenn es erstens keine objektiv richtige Entscheidung gibt; und zweitens, wenn man die Entscheidung auch nach reiflichem Nachdenken lieber allein treffen will.
Genau in dieser Situation war ich kürzlich. Ich steckte in einer Führungssituation, in der ich merkte: Hier kommst du mit Diskussionen nicht weiter. Das ist eine Sache, die musst du allein entscheiden. Gleichzeitig wusste ich, dass es hier keine „richtige“ Entscheidung gibt – unabhängig davon, ob die Gruppe nun beteiligt war oder nicht. Alleinige, dazu „subjektive“ Entscheidungen: In einer solchen Situation kann die Führungskraft eigentlich nur verlieren.
Durchziehen, auch wenn's weh tut: Auch das kann Führung sein
Nicht-Führungskräften fällt es mitunter schwer, die Dilemma einer Führungskraft nachzuvollziehen. Das liegt auch daran, dass sich in einer hierarchischen Organisation die Komplexität tendenziell reduziert, je weiter nach unten man kommt. „Einfache“ Mitarbeiter müssen weniger komplexe Entscheidungen treffen als ihre Teamleiter, Teamleiter weniger komplexe Entscheidungen als ihre Abteilungsleiter und so fort. Das heißt in der Konsequenz, dass hinter Pressemeldungen, ein CEO habe so oder so entschieden, eine Komplexität stecken kann, die man von außen gar nicht beurteilen kann, geschweige denn selbst erleben möchte.
Ich kann Führungskräfte gut verstehen, die Dinge gern selbst entscheiden. Man spart sich unter Umständen viele Diskussionen, reduziert gefühlt die Komplexität und den eigenen Stress. Doch das ist gleichzeitig die Gefahr des Feldherrnhügels: Man zieht sich dahin zurück, auch wenn die Entscheidung möglicherweise mehr Spielraum ließe und sie von der „Weisheit der Vielen“ profitieren könnte.
Mit diesen drei Ideen verbessern Sie Ihre Entscheidungssituation
Wie kann eine Führungskraft nun damit umgehen, dass es möglicherweise keine „richtige“ Entscheidung gibt oder sie das Gefühl hat, sie müsste das Team an der Entscheidung beteiligen?
Erstens gilt es, routiniert den Impuls des Feldherrnhügels zu hinterfragen. Unser Gehirn möchte sowieso in der Regel da hinaufrennen, sich zurückziehen, Überblick gewinnen. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und fragen Sie sich: Gewinnt meine Entscheidung wirklich an Qualität, wenn ich sie allein treffe? Oder möchte ich mich einfach keinen anstrengenden Diskussionen aussetzen?
Zweitens ist es angebracht – wenn Sie Entscheidungen auf dem Feldherrnhügel treffen – Ihrem Team zu erläutern, warum Sie diese Entscheidung allein und nicht im Team getroffen haben. Zumindest eine solche Begründung verdient ihr Team. Es braucht diese Erläuterung übrigens auch, um seinerseits Komplexität im Kopf zu reduzieren (sonst wabert immer die Frage in den Team-Köpfen herum: Warum so und nicht anders?).
Drittens sollte Sie die Qualität der Gruppenentscheidungen verbessern. Nutzen Sie dafür prozessorientierte Methoden und Mini-Workshops wie die Liberating Structures. Diese schaffen eine gleichmäßige Beteiligung aller an der Entscheidung, produzieren ein echtes Ergebnis und verhindern das oft befürchtete „Gelaber“ bzw. die „Sitzkreis-Situation“.
Die einsame Entscheidung ist nicht mehr die erste Wahl
Zur Wahrheit moderner Führung gehört auch, dass es die Situation der „Einsamen Entscheidung“ durchaus noch gibt. Sie muss nur besser begründet werden – und sie sollte nicht die erste Wahl sein. Es gehört zur Kompetenz von Führungskräften, einzuschätzen, welche Entscheidungen sie selbst treffen wollen, an welchen Entscheidungen das Team beteiligt werden soll oder welche Entscheidung das Team sogar autonom treffen soll.
Und noch eins: Werben Sie bei Ihren Mitarbeitern um Verständnis für Ihren Umgang mit Komplexität. Sie sind auch nur ein Mensch, und Ihre Mitarbeiter wissen das. Daher sollten Sie weder Unfehlbarkeit simulieren noch ins brütende Schweigen verfallen. Kommunikation ist auch hier der Schlüssel. Probieren Sie daher die eben genannten drei Ideen einfach mal aus. So kann mit Glück eine ganz neue Entscheidungskultur in Ihrem Team wachsen – mit mehr Transparenz, besseren Entscheidungen und ruhig auch mal den einen oder anderen Feldherrnhügel.