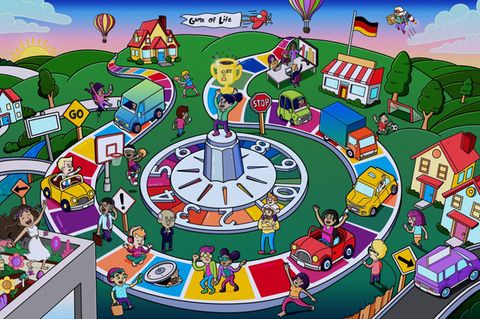„Meinst du, ich bin mit Mitte 30 zu alt, um mich beruflich noch einmal neu zu orientieren?“ Diese Frage stellte mir kürzlich eine Bekannte und brachte mich zum Nachdenken.
Nicht darüber, ob das zu alt ist oder nicht. Denn nein, das ist es nicht. Auch Mitte 40 oder Mitte 50 ist nicht zu alt, um sich beruflich neu zu orientieren.
Was mich viel mehr nachdenklich gemacht hat, ist, dass sich so eine Frage im Jahr 2024 in Deutschland überhaupt stellt. In einer Phase, in der die Wirtschaft stagniert, die Bevölkerung immer älter wird und das Problem des Fachkräftemangels noch nicht zufriedenstellend gelöst ist (KI wird es wohl auch nicht so schnell richten). Tatsache ist, dass sie mit dieser Unsicherheit nicht allein ist, im Gegenteil – sehr viele Menschen in Deutschland glauben wie vor 30 Jahren, dass eine einmal eingeschlagene Karriere ein Leben lang verfolgt werden muss.
Spaß im Job ist wichtiger als der gerade Karriereweg
Ich halte das für ein Problem. Für den einzelnen Menschen, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Auf individueller Ebene ist diese Festlegung doch eine erschreckende Vorstellung: Wir sollen uns mit spätestens 20 Jahren für eine berufliche Richtung entscheiden, mit spätestens 30 für einen konkreten Beruf, und das ist dann unser Schicksal bis zur Rente? Also für Jahrzehnte? Da bleibt wenig Raum für Veränderung, für Richtungswechsel, für Selbsterkenntnis – denn nicht wenige von uns merken erst nach dem Studium und den ersten Berufsjahren, dass wir ein völlig falsches Bild von unserem Wunschberuf hatten, oder dass wir den Wünschen unserer Eltern gefolgt sind, oder dass wir einfach auf dem Weg neue Interessen und Werte entwickelt haben.
Für die Wirtschaft ist so eine frühe, starre Festlegung auch ein Desaster. Denn das Ergebnis ist ja, dass zu viele Menschen in Jobs sind, die ihnen keinen Spaß (mehr) machen. Und zugleich gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels zu viele Stellen unbesetzt bleiben, auch wenn es eigentlich sehr gute Talente gibt, die darauf passen würden – die aber vielleicht nicht den „richtigen“ Lebenslauf mitbringen.
Und für die Gesellschaft ist diese Sichtweise ein Problem, weil sie ein merkwürdiges, rückwärtsgewandtes Menschenbild verkörpert. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der man Angst vor jeder beruflichen Entscheidung hat, weil sie ein „Für Immer“ ist? Wo ein „Ich halte an meinen Zielen fest, egal wie wenig sie noch zu mir passen“ ein Wert an sich ist und nicht ein „Ich habe Lust, mich auszuprobieren und immer wieder neue Wege zu gehen“?
Nicht zu vergessen: Viele Berufe verändern sich mit der Zeit, und neue Jobs entstehen. Den Job zu Beginn der beruflichen Laufbahn wird es mit zunehmender Wahrscheinlichkeit bis zur Rente nicht mehr geben. Der Veränderungswille ist also alternativlos.
In Kompetenz-Clustern denken statt in starren Karrierepfaden
Natürlich sind wir in Deutschland nicht von vorgestern. Viele Menschen haben heute schon berufliche Laufbahnen, die nicht schnurgerade und vorhersehbar sind. In vielen Kreisen gilt man als exotisch, wenn man zwanzig Jahre oder mehr im selben Unternehmen bleibt. Das sollte aber nicht vom Problem ablenken: Dass wir in Deutschland immer noch stark auf klassische „Karriere-KPIs“ wie das Studium, auf Job-Titel und einen stringenten Lebenslauf abzielen, in dem jede berufliche Station auf ein großes Ziel hinarbeitet.
Ich halte das für geradezu gefährlich veraltet. Wie soll man – und mit „man“ meine ich einzelne Personen wie auch Arbeitgeber – so auf die Schnelligkeit unserer Welt reagieren?
In den USA ist sicher nicht alles besser als bei uns, aber eines hat man uns dort voraus: Eine freiere Karrieregestaltung. Man denkt dort mehr in so genannten „Kompetenz-Clustern“, die die Bausteine einer Berufslaufbahn bilden, anstelle eines schnurgeraden Pfades. Der Begriff Kompetenz-Cluster meint Gruppen aus zusammengehörigen Kompetenzen, die sich für einen Beruf gut ergänzen. Ein Beispiel:
Mit der zunehmenden Anzahl an entwickelten Software-Produkten hat sich der Karriereweg von Designern erheblich verändert. Viele Grafik-, Kommunikations- und sogar Modedesigner haben sich zu UX-/UI-Designern weiterentwickelt. Diese Experten sind in Software-Teams eingebettet und gestalten digitale Produkte wie Websites und Apps. Die Kompetenz-Cluster umfassen hier beispielsweise die Nutzung von anderen oder neuen Tools oder Methoden wie agile Entwicklung und agiles Arbeiten in Sprints.
In den USA sind nicht alle, aber viele Studiengänge viel generalistischer als bei uns und es ist keine Schwäche, wenn Absolventen dort nach dem Studium eine Richtung einschlagen, die mit dem abgeschlossenen Bachelorstudium nichts mehr zu tun hat. Das steht im deutlichen Gegensatz zu Deutschland, wo junge Talente mit einem geisteswissenschaftlichen Studium – auch eher Berufs-unspezifisch – oft immer noch etwas bemitleidet werden. Deutsche Unternehmen öffnen sich zwar seit ein paar Jahren aus der Not heraus schon mehr gegenüber Quereinsteigerinnen, aber das beschränkt sich bisher größtenteils auf einzelne Branchen und Berufsbilder. Und gerade kleinere und mittelständische Unternehmen stellen noch selten Quereinsteiger sein.
Unternehmen und Mitarbeiter müssen offener werden
Was muss passieren, damit wir auch in Deutschland mehr Offenheit für ganz verschiedene Karrierepfade entwickeln? Ich denke, dafür müssen wir an verschiedenen Punkten ansetzen. An erster Stelle appelliere ich hier an die Unternehmen und Organisationen: Wagt etwas Neues (dank des Fachkräftemangels ist das sowieso bald die einzige Option) und achtet neben Fachkompetenzen auch auf die Einstellung und Persönlichkeit des Einzelnen.
Ob jemand erfolgreich im Beruf ist, hängt oft vielmehr von der Haltung und dem Willen ab, sich Neues anzueignen, als (vor vielen Jahren antrainierten) Hard-Skills. Seid offen für Quereinsteigerinnen, für Talente ohne zehn Jahre Berufserfahrung in exakt einem Berufsfeld, für Menschen mit einer großen Bandbreite an Erfahrungen. Um als Führungskraft oder Personalverantwortlicher einschätzen zu können, ob eine Person in der Lage ist, eine Aufgabe in einem neuen Kontext erfolgreich zu meistern, kann es helfen, nach den konkreten Aufgaben und Herausforderungen zu fragen, die sie in früheren Positionen bewältigen musste. Dies gibt euch oft mehr Aufschluss als eine identische Rollenbezeichnung beim letzten Arbeitgeber.
Und seid auch offener dafür, eure Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen und neue Wege zu beschreiten. Damit sorgt ihr auch für viel mehr Zufriedenheit und Motivation.
Ich appelliere aber auch an alle Menschen in der Arbeitswelt: Habt mehr Mut. Über die Deutschen heißt es, sie seien traditionell eher vorsichtig und scheuen Risiken wie den Quereinstieg in neue Berufe. Das ist schade, und jetzt gerade ist eigentlich eine hervorragende Zeit, beruflich Neues zu wagen. Denn die Wirtschaft schwächelt zwar, umso dringender braucht es aber Ideen, frischen Wind und Energie. Durch den Fachkräftemangel gibt es in vielen Branchen jetzt mehr Möglichkeiten als noch vor einigen Jahren, auch mit einer unkonventionellen beruflichen Laufbahn und als Quereinsteiger in interessante Positionen zu kommen.
Viele Unternehmen suchen explizit nach Quereinsteigerinnen, und für Selbständige und Freelancer gilt das natürlich auch – da ist die Gestaltungsfreiheit ja sowieso meist schon größer. Und wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, das euch grundsätzlich gut gefällt, aber ihr gern neue Kompetenz-Cluster entwickeln und die Inhalte eurer Arbeit verändern möchtet: Sprecht mit den Verantwortlichen, macht ruhig auch etwas Druck.
Überlegt euch, was ihr gut könnt und wohin ihr euch entwickeln möchtet. Was sind eure Stärken und Talente? Um diese zu erkennen, gibt es renommierte Online-Tests, die für jeden zugänglich sind und dabei helfen, das Bewusstsein über sich selbst zu stärken. Sprecht mit vielen Leuten über eure Karriere und fragt sie, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt stehen. Oft war das nicht geplant, denn viele Karrieren lassen sich nicht im Voraus planen und man kann verschiedene Wege einschlagen, um an sein Ziel zu gelangen. Seid offen für Möglichkeiten. Dafür müsst ihr neugierig sein und mit Leuten sprechen. Ich persönlich hatte ursprünglich nicht vor zu gründen, sondern bin eher zufällig bei meinem damaligen Arbeitgeber auf eine Initiative gestoßen, die sich mit der Gründung eines Start-ups innerhalb des Unternehmens befasste.
Klar ist: Im 21. Jahrhundert können wir in Deutschland nicht mehr so weitermachen, wie es sich im 20. Jahrhundert bewährt hat, denn die Welt ist heute eine andere. Wir sollten das als Chance begreifen.