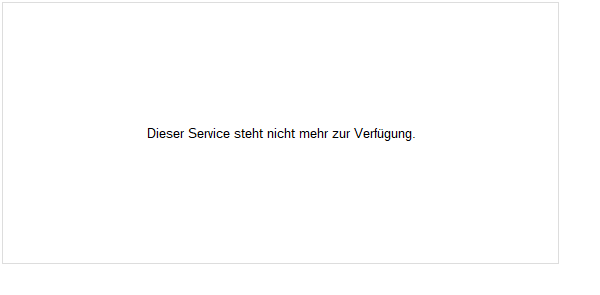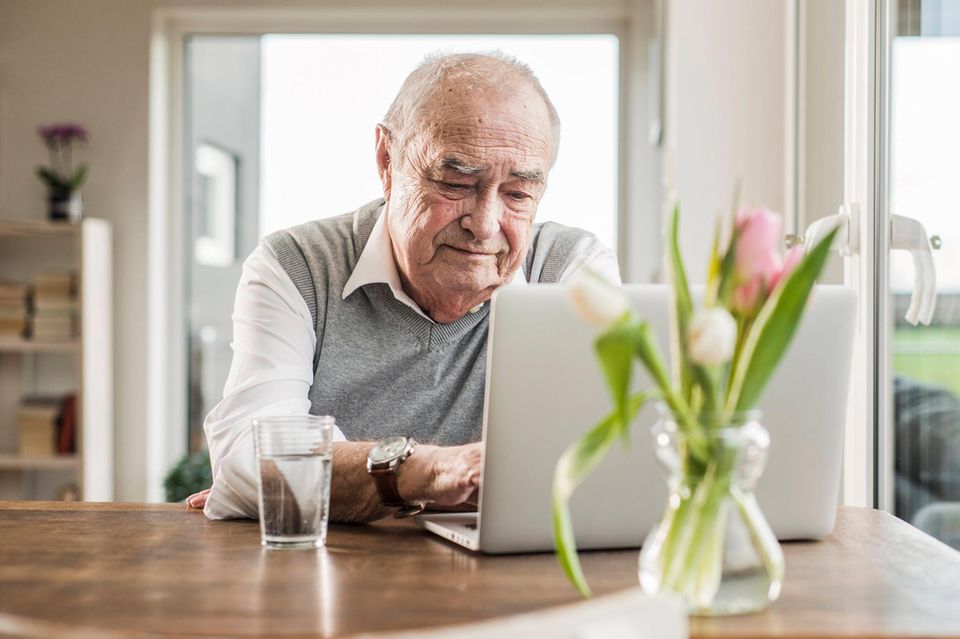Christian Kirchner ist Frankfurt-Korrespondent von Capital. Er schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Geldanlagethemen. Hier können Sie ihm auf Twitter folgen
Eine meiner Lieblingsstellen im Buch „Der schwarze Schwan“ von Nassim Nicholas Taleb ist jene Passage, in der Taleb dem Leser die Lächerlichkeit von raschen Markteinschätzungen vorführt: Unmittelbar nach der Ergreifung Saddam Husseins waren US-Staatsanleihen zunächst gestiegen. Kommentatoren hatten das darauf zurückgeführt, dass auch Husseins Ergreifung den Terrorismus nicht bändigen könne. Anschließend brachen die Staatsanleihen ein, was – Sie ahnen es – Kommentatoren ebenfalls auf Saddams Ergreifung zurückführten: Schließlich bestünde nun die Chance, dass der Terror im Irak ende und Aktien wieder kletterten.
Die Stelle geht mir immer wieder durch den Kopf, wenn Strategen nach Erklärungen für den aktuellen Kursverfall an den Märkten suchen (wahlweise sind der Ölpreis, China, die US-Konjunktur, die Deflationssorgen Schuld). Oder wenn anhand ein und derselben Zahl aus der Volkswirtschaft erläutert wird, warum Aktienkurse einbrechen (weil die Zahl auf eine Rezession hindeutet), beziehungsweise warum die Kurse klettern (weil die Zahl auf noch mehr billiges Notenbankgeld hindeutet).
Angst vor Konjunktureinbruch
Ich würde Ihnen daher an dieser Stelle zur Lage gerne guten Gewissens eine der üblichen Durchhalteparolen geben. Das wäre allerdings ähnlich hilflos wie die merkwürdigen Erklärungsversuche vieler Strategen. China-Schwäche, Ölpreisverfall, Deflation usw. sind alle schon hinreichend durchgekaut, sie können niemanden mehr kalt erwischen. Letztlich ist es nur das typische Hinterherklappern einer Kursbewegung. Nein, hinter den Kurseinbrüchen steckt etwas anderes, etwas Fundamentaleres:
Erstens die Sorge, dass wir in eine starke Wirtschaftseintrübung weltweit – ganz gleich, welche Ursache sie auch haben mag – schlittern könnten, obwohl die Notenbanken weltweit bereits alle verbalen und monetären Register gezogen haben, um die Wirtschaft mit Null- oder gar Strafzinsen und Anleihenaufkäufen zu stützen. Denn welche fiskalischen und monetären Impulse sind überhaupt noch drin, wenn man bereits als Antwort auf die Finanzkrise 2008 mit neuen Schulden und laxer Geldpolitik „all in“ gegangen ist? Genau darin steckt die Unsicherheit, die Anleger derzeit aus riskanten Anlagen treibt, ganz unabhängig von den unmittelbaren Auslösern. Denn wenn EZB-Chef Mario Draghi schon 2012 gesagt hat, er werde „alles“ tun, um den Euro zu retten – wie steigert man „alles“ in der nächsten Krise? Mit noch mehr Anleihenaufkäufen, noch höheren Strafzinsen? Mit Ölkäufen, wie kürzlich jemand vorschlug?
Und zweitens steckt hinter dem Einbruch die Tatsache, dass sich nun allmählich (aber auch nicht völlig unbeobachtet) die Schattenseiten jener Maßnahmen zeigen, mit denen man auf die Finanzkrise 2008/2009 reagiert hat.
Regulierung fördert den Herdentrieb
Zu diesen Schattenseiten gehört zum Beispiel der diabolische Pakt zwischen Politik und Notenbanken auf der einen und den europäischen Großbanken auf der anderen Seite. Einerseits wurden Banken gerettet und rekapitalisiert, es galt die Losung, dass nie wieder ein Staat erpressbar sein dürfe von seinen Banken. Andererseits änderte man die Regulierung der Banken – und übrigens auch der Versicherer –dahingehend, dass ihnen eine entscheidende Rolle in der Rettung des Euro zukam: Sie sogen sich, finanziert mit extrem billigen Geld, regelrecht voll mit regulatorisch privilegierten Euro-Staatsanleihen. Das ließ die Zinsen sinken, zur Freude fast aller. Die Abhängigkeit der Eurozone von ihren Banken ist so aber nicht gesunken, auch nicht im Transmissionsmechanismus der Geldpolitik.
Zu den Schattenseiten gehört auch, dass die Regulierung seit Ende der Finanzkrise ein prozyklisches Agieren an den Kapitalmärkten stark gefördert hat – also ziemlich genau jenes Herdenverhalten, das uns unter anderem in die Finanzkrise von 2008 geführt hat: Risiken einzugehen, sobald nur ein „Triple A“ auf einem Wertpapier steht.
Das ist auf den ersten Blick schwierig zu verstehen und hat eher technische und psychologische Gründe, sie sind aber wichtig: Verbietet man Banken, Risiken einzugehen, verschwinden diese Risiken nicht einfach. Sie verlagern sich nur. So hat man Banken den Eigenhandel – umgangssprachlich: Zockerei genannt – regulatorisch so erschwert, dass sie die Lust daran verloren haben. Dafür gibt es viele gute Gründe, wir müssen aber auch mit den Folgen leben: etwa die, dass die Liquidität in vielen Märkten stark gesunken ist, besonders am Anleihenmarkt.
Niemand geht mehr Risiken ein
In steigenden Märkten stört das niemanden. Im Gegenteil, dann führt die geringe Liquidität in einem seit der Finanzkrise insgesamt sehr stark gewachsenen (!) Markt wie dem von Staats- und Unternehmensanleihen oder auch am Aktienmarkt dazu, dass sich sehr viele Akteure um sehr wenige Papiere prügeln. Samt willkommener Wohlstandseffekte für Menschen mit Finanzanlagen. Am europäischen Aktienmarkt sind etwa die Firmengewinne in den letzten fünf Jahren auch nicht gestiegen, sehr wohl aber die Aktienkurse (etwas, das Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn man Ihnen nun erklärt, der Kurseinbruch sei „fundamental unbegründet“ – der Anstieg war es, zumindest in der Breite der Eurozone, leider auch nicht.)
Doch wehe, der Wind dreht. Dann fehlen Akteure, die einmal dagegen halten und auf Schnäppchenjagd gehen, wenn die Kurse kollabieren. Dann verschärft die gesunkene Liquidität natürlich Krisen, sorgt für größere Ausschläge, einer der Kernprognosen unseres Ausblicks auf 2016 (Capital 1/2016) – und das erst recht in Zeiten extrem niedriger Zinsen. Denn konnte man früher mit einem Tausch riskanter Anlagen in mit drei, vier oder gar fünf Prozent verzinsten, sicheren Staatsanleihen Verluste rasch wieder aufholen, funktioniert das Spiel heute nicht mehr (hier etwas ausführlicher erklärt). Vereinfacht gesprochen sind heute weit mehr Gäste auf der Party als noch vor der Finanzkrise 2008 – aber die Ausgänge sind kleiner geworden, also verdrückt man sich lieber etwas früher oder steht in der Nähe der Tür.
Jene tückische Prozyklik, das Trampeln mit der Herde, wird nicht nur regulatorisch, sondern spätestens seit der Finanzkrise auch organisatorisch und psychologisch in der Finanzbranche gefördert. Risiken will gerade dann niemand eingehen, wenn alle darüber reden und umgekehrt. Euro-Staatsanleihen flogen zu Renditen nahe zehn Prozent massenhaft aus den Portfolios – inzwischen finden sie auch zu Nullzinsen Käufer.
Das ist kein Zufall. Zu den typischen Beschwerden von Fondsmanagern mit Milliardenvermögen in vertraulichen Gesprächen gehört, dass sie einerseits langfristig gute Ergebnisse für Anleger erwirtschaften sollen – andererseits aber bei den geringsten Marktturbulenzen schon das hauseigene Risikomanagement oder den Vorstandschef am Telefon hätten. Die drängelten zu einer Reaktion, die Risiken doch bitte zu reduzieren, die Kunden zu beruhigen. „Ich soll über fünf Jahre gut abschneiden, soll aber nach spätestens zwei Tagen Risiken reduzieren, wenn es mal kracht an den Märkten“, klagte kürzlich einer.
Markttiming funktioniert nicht
Manchen Gesellschaften ist dieses Denken und die Angst vor skeptischen Kunden bereits so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie sich – um hier zwei aktuelle Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zu nennen – lieber gleich „Risk Manager“ nennen. Oder tatsächlich glauben, indem man auf einem Neujahrsempfang die Marktturbulenzen völlig ignoriert, ja so tut, als sei da draußen gar nichts besonderes los, einen Beitrag zur Beruhigung zu leisten.
Was heißt all das nun für eine Geldanlage in solchen turbulenten Zeiten? Gelegentliche Leser dieser Rubrik dürften zumindest die Risiken nicht völlig neu sein, wir hatten sie hier ausführlich Ende November gewürdigt, bereits gewarnt und ermüdet vom Dauersound der angeblich „alternativlosen Aktien“ auf den Jahresausblicken.
Allerdings gilt weiterhin die Regel, dass Sie Ihr Geld nehmen und weglaufen sollten, sobald Ihnen jemand versucht zu erklären, er sei in der Lage, Kursabstürze mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtzeitig zu antizipieren.
Genau das – also Markttiming betreiben – hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren. Und dennoch wird auch dieser Einbruch wieder Gaukler hervorbringen, die alles kommen gesehen haben und Kultstatus erringen werden. Die werden Ihnen aber leider auch nicht langfristig helfen. Denn die Trefferquote, die Sie benötigen, um einen geduldigen Investor, der kauft und hält, abzuhängen – die hat vielleicht ein George Soros, aber nicht Ihr Berater und auch nicht ein Capital-Redakteur. Weshalb Ihnen auch nun niemand sagen kann, wie tief der Dax noch fällt oder wann er dreht – und Sie ihre Anlageentscheidungen auch nicht von genau solchen Prognosen abhängig machen sollten.