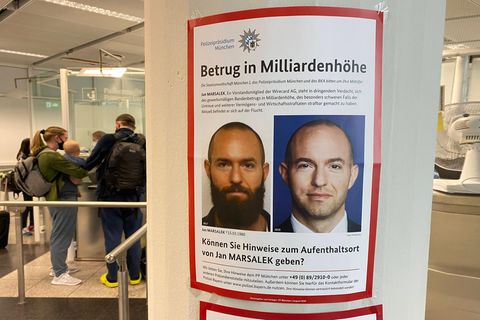Dieses Interview ist erstmals in Capital-Ausgabe 12/2018 erschienen. Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay .
Aschheim, vor den Toren Münchens, ein Gewerbegebiet. Ein Schild weist den Weg: Rewe, Lidl, DM, NH Hotels, Diebold Nixdorf – und Wirecard. Fast versteckt sitzt hier ein Dax-Konzern. Und weil die Mitarbeiterzahl so rasch wächst, hat Wirecard gerade ein paar Räumlichkeiten vom Modeunternehmen Escada übernommen.
Herr Braun, im September ist Wirecard in den Dax aufgestiegen und an der Börse nun wertvoller als die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Was hat sich in Ihrem Leben seither verändert?
In unserer Strategie und im operativen Geschäft: überhaupt nichts. Der Dax-Aufstieg ist natürlich eine Auszeichnung – auch für Deutschland, denn so sind mehr Tech-Werte im Dax. Es gab ein kurzes mediales Aufflammen, aber inzwischen hat sich alles normalisiert.
Aber Sie stehen doch stärker im Fokus. Nehmen wir nur die Aktie, die oft wilde Kapriolen schlägt.
Ich habe nie etwas auf kurzfristige Börsenbewegungen gegeben, sondern glaube an langfristige Strategien. Was sich geändert hat: Ich musste aus der Komfortzone heraus, ich führe solche Gespräche wie dieses. Das wird offen gestanden nicht mein Hobby werden. Das gehört zur Position dazu. Es hat aber auch etwas Spannendes. Alles, was man als neues Thema für sich akzeptiert, eröffnet Perspektiven. In der Technologie und auch persönlich.
Der Aufstieg von Wirecard in den Dax war sehr symbolisch: Commerzbank raus, Wirecard rein. Für viele kam das ziemlich überraschend: Da ist plötzlich ein zweites großes deutsches Tech-Unternehmen …
Wir sind nur die Speerspitze einer breiten Entwicklung und Transformation. In den nächsten zehn Jahren werden noch andere aufsteigen. Und: Tech-Unternehmen werden bald keine eigene Kategorie mehr bilden. Ich vergleiche das mit der Elektrifizierung, die hat auch alle Branchen getroffen. Ähnlich werden Handelsunternehmen, Autohersteller und auch Banken zu Tech-Unternehmen.
Die Banken auch? Derzeit hat man den Eindruck, sie würden gern, bekommen es aber nicht hin.
Das wäre vorschnell geurteilt, das gilt auch für deutsche Banken wie die Commerzbank. Natürlich haben viele klassische Banken früher Software, Entwicklung, IT und Plattformen nicht als Kernthema angesehen. Das heißt aber nicht, dass Banken heute nicht Stärken haben. Zum Beispiel die starke Kundennähe. Wenn sie anfangen, in Plattformen zu denken, geschickt Kooperationen eingehen und ihr technologisches Herz gut genug ist, können sie starke Spieler bleiben.
Ihre Höflichkeit ehrt Sie. Aber sind Sie nicht in Wahrheit ein „Bankenschreck“?
Ich akzeptiere solche medialen Zuspitzungen, aber ich sehe uns nicht so. Wirecard agiert unter einem neuen Paradigma: Wir sind ein offenes Plattformunternehmen. Das heißt, wir kooperieren mit vielen Firmen, mit Banken wie der Crédit Agricole, Tech-Firmen aus den USA wie Apple. Auch in China haben wir Kooperationen mit Alibaba und Tencent – es gibt keinen Dualismus: Freund oder Feind. Man kann kooperieren und in anderen Feldern Wettbewerber sein.
Banken haben Geschäfte liegen gelassen, die Sie nun übernehmen: den Payment-Markt oder das Kreditkartengeschäft etwa. Dessen Akteure sind an der Börse nun wertvoller als Geldinstitute. Haben die Banken geschlafen?
Diese Bereiche waren nie die Kernkompetenz von Banken und immer ausgelagert. Die technologischen Ansprüche sind aber drastisch gestiegen, seit Bezahlungen quasi in Echtzeit vollzogen werden müssen. Das ist etwas anderes als eine Kredit- oder EC-Karte mit PIN-Nummer. Deshalb sind ganz neue Geschäftsmodelle entstanden.
Gab es einen Heureka-Moment, als Sie erkannt haben, welche disruptive Welle auf uns zukommt?
Ich könnte keinen speziellen Moment nennen. Ich habe eher unterschätzt, wie lange die Entwicklung bis zur vollständigen Akzeptanz dauert. Wir haben rund 15 Jahre lang fast autistisch unsere Strategie verfolgt. Mit der Überzeugung, dass irgendwann der Markt kommt. Wir haben viele Rückschläge erlebt. Viele Entwicklungen – virtuelle Kreditkarten, kanalübergreifender Handel und Bezahlen – haben wir technologisch antizipiert. Und dann dauert es fünf bis zehn Jahre, bis sich manche Dinge durchsetzen. Es ist eher so, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, die Entwicklungen von außen zu beurteilen, ich beschäftige mich schon so lange damit.
Wenn der Payment-Markt so rasch wächst und profitabel ist: Erwachsen Ihnen da neue Wettbewerber?
Das sehe ich entspannt. Wenn jemand kurzfristig auf diesen Trend aufspringt, steht er vor unglaublichen technischen Herausforderungen. Ich nenne das immer das Eisberg-Paradigma. Sie sehen nur die Spitze. Aber weltweit und in Echtzeit Bezahlungen abwickeln, das ist hochkomplex.
Fürchten Sie nicht, dass auch hochprofitable US-Banken, chinesische Internetriesen oder Bezahlfirmen wie Paypal perspektivisch in Ihr Geschäft eindringen?
Warum? Der Markt ist noch embryonal, es ist Raum für Wachstum für noch viel mehr Akteure. Gerade mal 20 Prozent aller Bezahlvorgänge laufen weltweit elektronisch, vielleicht zwei Prozent voll digital. Wirecard hat im vergangenen Jahr Transaktionen im Wert von 91 Mrd. Euro abgewickelt. Was ist das in Relation zu einem Weltmarkt, auf dem dreistellige Billionensummen pro Jahr fließen? Selbst Amazon ist, wenn man den Handel insgesamt betrachtet, noch klein. Das Thema Digitalisierung ist zwar gefühlt schon lange da, greift aber jetzt erst richtig.
Die Payment-Industrie setzt stark auf das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone und Karten. Wird sich das im bargeldtreuen Deutschland durchsetzen?
Ja, vor allem, wenn die Menschen intuitiv den Mehrwert erkennen. Wenn Sie eine Technologie erklären müssen, haben Sie ein Problem. Das war im Onlinehandel genauso: Alle bestellen heute online, weil sie wissen, dass es funktioniert, bequem und sicher ist. Vor zehn Jahren war es kompliziert, das meiste ging auf Rechnung oder Vorkasse, die Angst vor Betrügern war groß. Beim mobilen Bezahlen stehen wir vermutlich da, wo der Onlinehandel etwa im Jahr 2005 stand. Es gibt Angebote, die Early Adopter nutzen. Mit Wallets wie Google Pay und Apple Pay aber, die in Kombination mit unserer Mobile-Payment-Lösung Boon bankenunabhängig funktionieren, wird der Nutzen für die breite Masse immer klarer. Auch wenn noch nicht alles reibungslos klappt.
Wann werden wir flächendeckend kontaktlos bezahlen?
Ich bin vorsichtig mit Jahreszahlen geworden. Aber wenn Sie mich fragen, ob wir in zehn Jahren noch Plastikkarten im Portemonnaie haben, dann sage ich: Entscheidend ist nicht die Karte, sondern die Technologie dahinter. Also wird das Plastik verschwinden. Wir werden künftig mit einem digitalen Gerät unsere Transaktionen vollziehen. In Echtzeit, in Verbindung mit Biometrie.
Wir erleben die technologischen Umbrüche an vielen Stellen: Was waren für Ihre Branche die wichtigsten Treiber? Und warum passiert der Umbruch gerade jetzt?
Auslöser für das Tempo sind ganz klar die Kombination aus größerer Bandbreite und die Verbreitung von Smartphones. Dadurch sind das mobile Zahlen und Prozesse in Echtzeit Realität geworden. Es geht nicht mehr um online versus stationär. Es geht drum, den stationären Handel in die digitale Echtzeitwelt hineinzuholen und alles zu verschmelzen. Der Kunde bekommt den dynamischen Rabatt vor Ort, er finanziert in Echtzeit, er bezahlt beim Rausgehen automatisch.
Sie haben eine „Strategie 2025“, darin schildern Sie mit einer fiktiven Kundin namens Julia den Einkauf der Zukunft: Julia wird erfasst, sobald sie sich einem Geschäft nähert; der Laden weiß, dass sie online nach einer grünen Handtasche gesucht hat; also bekommt sie eine angeboten. Im Hintergrund greifen ein dynamisches Pricing, werden individuelle Rabatte errechnet, Zusatzgeschäfte bei Finanzierung und Versicherung angeboten – das ist der blanke Horror für Datenschützer.
Alles, was wir entwickeln, auch diese Vision mit Julia, ist in jeder Form mit dem Datenschutz konform. Datenschutz darf aber keine Ausrede sein, nicht innovativ zu sein. Um in dem Beispiel zu bleiben: In einem Smartphone müssen Sie einen solchen Service ein- und ausschalten können. Ich behaupte aber: Die Mehrwerte werden so stark sein, dass sich das durchsetzt.
Trotz Datenschutzverordnung?
In der Debatte haben wir in meinen Augen einen Punkt vergessen: Es geht um den persönlichen Mehrwert für Konsumenten. Haben die Nutzer ihr Verhalten in sozialen Netzwerken verändert? Nein. Menschen nutzen freiwillig Facebook oder Whatsapp. Beim Bezahlen wird es genauso sein. Der Kunde entscheidet, welche Dienste er an- und ausschaltet.
Wo ist der Anreiz für Kunden, sich überwachen zu lassen und „dynamische Preise“ zu bekommen?
Ein dynamischer Preis kann ja auch bedeuten, dass man dem Kunden einen individuellen Rabatt einräumt. Durch ein flexibles Modell werden Preise günstiger. Die ganze Werbung ist heute nur „push“ – wenn man den Kunden aber sonst unbehelligt lässt, etwa auf der Fernsehcouch, weil man ihn gezielt erreicht, ist das doch eine Verbesserung.
Vielleicht, aber es ist das Ende des „Erlebnisses“, von dem Händler gern sprechen.
Das Erlebnis bieten eine gute Wein- und Käseabteilung nach wie vor. Der Einkauf hochpreisiger Güter wird noch stärker zu einem Erlebnis, bei dem Verkäufer mit Tablets zum Kunden kommen und beraten und gegebenenfalls online liefern. Alles, was Standard ist, der klassische Großeinkauf, wird automatisiert.
Was sind aus Ihrer Sicht weitere Trends und Entwicklungen?
Wir glauben, dass wir in den kommenden zehn Jahren mit unserer Stimme bestellen werden. Da entsteht ein ganz neuer Vertriebskanal. Wenn man einem Voice-Assistenten sagen kann: „Ich möchte am Wochenende nach Venedig, such mir Flüge am Freitagabend bis 300 Euro raus, schau nach guten Hotels bis 200 Euro, möglichst im Zentrum, und nach einem guten Restaurant“ – und das klappt, wird das ein evolutionärer Bequemlichkeitsschritt sein.
Zum Beispiel für Kinder, die dann allein zu Hause eine Playstation bestellen?
Solche Geschichten gibt es. Aber es ist normal, dass sich die Diskussion zunächst auf das konzentriert, was schiefgeht. Wir sind natürlich noch meilenwert davon entfernt, das ist hochkomplex – aber es wird kommen, und dann wird der Konsument es nutzen. Und es wird dem Händler nutzen: mit mehr Umsatz, höheren Margen. Es geht nicht nur um Bezahllösungen, wir verkaufen Mehrwert.
Sie haben nach dem Dax-Aufstieg große Ziele angekündigt: Der Börsenwert sollte von 20 auf 100 Mrd. Euro steigen, der Umsatz von 1,5 Mrd. auf 10 Mrd. Euro. Würden Sie heute den Mund immer noch so voll nehmen?
Unsere Umsatzziele sind keine Hybris, wir sind eher konservativ in den Zielen. Über unsere Bewertung entscheiden Investoren. Ich sage nur: Wenn unser Wachstum so weitergeht, wieso soll die Bewertung diesem nicht folgen? Unser Gewinn vor Zinsen und Steuern ist im ersten Halbjahr um fast 40 Prozent gewachsen, wir haben Neugeschäft mit einem potenziellen Volumen von 30 Mrd. Euro abgeschlossen. Das sind rund 180 Prozent Zuwachs.
Anfang November ist eine Analyse von Merrill Lynch erschienen, die die Nachhaltigkeit Ihrer Wachstumsdynamik anzweifelt. Der Befund: Auf dem deutschen Markt sei Wirecard bei nur fünf der größten E-Commerce-Händler der Anbieter.
Unsere Aktie wird von 29 Analysten beobachtet, 23 empfehlen uns zum Kauf. Grundsätzlich kommentieren wir Analystenmeinungen ja nicht, aber um Ihnen eine Größenordnung zu geben: 2017 nutzten in Deutschland 18 000 Händler unsere Plattform, mit einem Transaktionsvolumen von 18,9 Mrd. Euro. Sie haben immer Psychologie im Markt, gerade bei Tech-Werten.
Warum sagt Merrill Lynch, dass Wirecard im deutschen E-Commerce kaum eine Rolle spielt?
Das ist nicht der Punkt. Die Analyse hatte ein bestimmtes Kriterium: Wer von den Top-100-Händlern nutzt unsere Dienste – und das Ergebnis lautete fünf. In Wirklichkeit sind es 18. Ich kann andere Zahlen nicht nachvollziehen. Außerdem bieten wir eine Fülle von Mehrwertdiensten wie etwa Kundenbindung oder die Herausgabe digitaler Karten an, die diese Analyse gar nicht berücksichtigt. Im Übrigen kommen unsere Kunden nicht nur aus dem Handel, sondern aus allen Industrien – aus der Touristik oder dem digitalen Bereich, darunter Kunden wie zum Beispiel Sky Deutschland und Teamviewer.
Wirecard polarisiert offenbar, auch bei Investoren. Einige große Fondsgesellschaften wie Jupiter, Comgest und Alken halten große Positionen, andere sagen: Das ist mir zu intransparent. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Tech-Unternehmen polarisieren oft. Nehmen Sie etwa Netflix. Auch Amazon hat die Gemüter entzweit. Ich treffe seit Jahren auf Roadshows Investoren, die bei einem Kurs von 4 Euro gesagt haben: Das ist mir zu teuer. Heute stehen wir bei 150 Euro. Ich kann nur sagen: Wir haben in den vergangenen zehn Jahren unseren Aktionären einen großen Gewinn gebracht.
Sie selbst sind durch den Aufstieg reich geworden, Ihr Anteil ist 1,4 Mrd. Euro wert. Wann nehmen Sie ein paar Chips vom Tisch?
Warum? Ich bin davon überzeugt, dass ich in einem der sich am besten entwickelnden Tech-Werte der nächsten zehn Jahre investiert bin. Und es macht mir großen Spaß. Ich halte ja sieben Prozent an Wirecard. Es ist ein großes Privileg, hier zu arbeiten, die Umwälzgeschwindigkeit ist hoch. Es tritt niemals diese Phase der Saturiertheit ein. Ich bin jetzt 49. Ich finde, das ist noch sehr jung.
Sind die Gewinne in der Firma wirklich besser aufgehoben als bei den Aktionären?
Wir sind ein Wachstumswert. Die Dividende steht nicht im Vordergrund. Wir sind mit unserem Cashbestand von mehr als 300 Mio. Euro über alle Fristen sehr zufrieden, aber unsere Nachricht an Aktionäre ist: Kauft uns dann, wenn ihr langfristig an unserer Wachstumsstory partizipieren wollt, nicht für eine Dividende.
Wollen Sie das Geld für weitere Zukäufe nutzen?
Wir haben stark expandiert und sind jetzt auf allen fünf Kontinenten vertreten. Heute investieren wir lieber in Forschung und Entwicklung. In einem Wachstumsmarkt, der noch klein ist und stark durch Innovationen getrieben ist, kann man besser organisch wachsen.
Welcher Wettbewerber bereitet Ihnen Sorgen?
Wir respektieren viele und fürchten niemanden. Wir haben schon 2006 eine Bank übernommen, da haben klassische Payment-Anbieter nicht mal an eine Banklizenz gedacht. Wir sehen früh Trends und setzen sie selbstbewusst um. Aber wir sind keine Magier und keine Alchemisten.