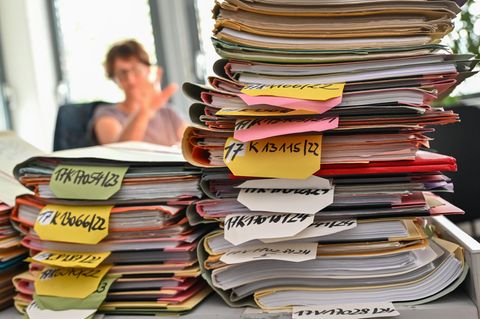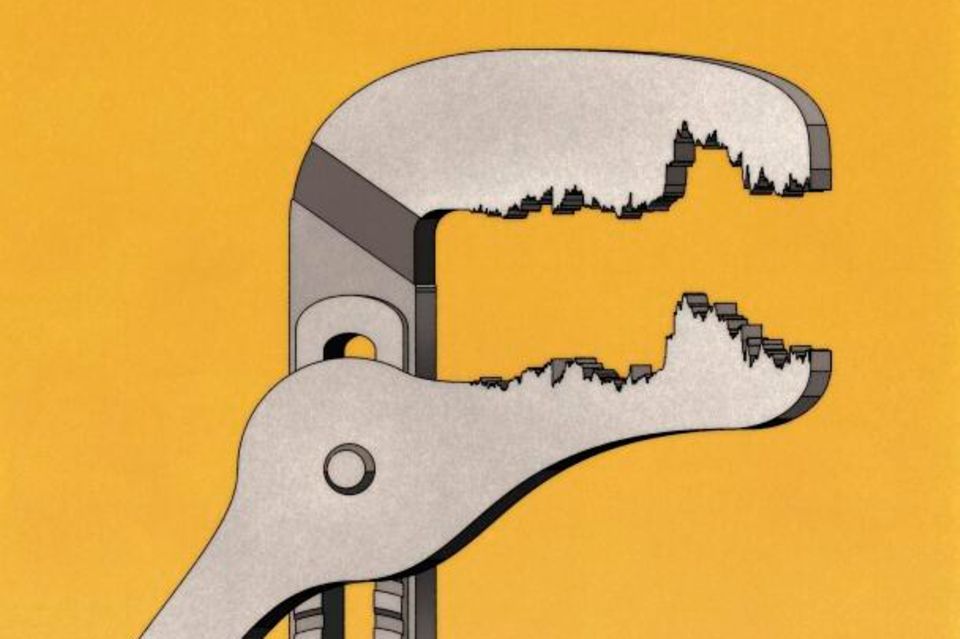Capital: Frau Kemfert, vergangene Woche brach im niedersächsischen Alfstedt das Rotorblatt eines Windrads ab – allein dort ist es der zweite Vorfall in nur einem Jahr. Der TÜV geht von 50 schweren Unfällen an Windkraftanlagen pro Jahr aus. Hat die Technologie ein grundlegendes Qualitätsproblem?
CLAUDIA KEMFERT: Qualitätssicherung ist in der Industrie immer ein Thema. Aber es gibt kein grundlegendes Problem damit. In Deutschland sind knapp 30.000 Anlagen in Betrieb. Die Schadensquote liegt demnach im Promillebereich – entsprechend niedrig sind auch die Versicherungsbeiträge. Dass ab und zu Schäden auftreten, ist normal. Soweit ich weiß, betreffen die Schäden vornehmlich ältere Anlagen. Die neueren haben wohl bessere Qualitätsstandards.
Bei Siemens Energy, immerhin einem Big Player der Branche, klingt das anders. Die Turbinentochter Siemens Gamesa hat den Vertrieb ihrer Windturbinen weitgehend eingestellt – der Grund: Qualitätsprobleme.
Für Siemens Gamesa ist das tragisch, keine Frage. Denn das Unternehmen muss mit der Konkurrenz mithalten. Doch ein Einzelfall stellt keine Grundsatzfrage. Grundsätzlich ist die Technologie zuverlässig. Ich gehe davon aus, dass ein Qualitätskonzern wie Siemens die Probleme in den Griff bekommen wird.
Wie bewerten Sie denn grundsätzlich die Stimmung in der Branche?
Ich würde sagen, sie ist auf dem Weg der Besserung. Grundsätzlich geht es mit der Windenergie wieder aufwärts, sie ist weltweit buchstäblich im Aufwind und die deutschen Hersteller sind wettbewerbsfähig. Die Ampel hat die politischen Rahmenbedingungen deutlich verbessert: klarerer Naturschutz, verpflichtende Flächenausweisung für die Länder, erleichterte Verfahren – auch wenn diese immer noch zu aufwendig sind.
Was macht die Verfahren immer noch so langwierig?
Die schleppenden Genehmigungsverfahren haben weniger mit Bürokratie zu tun als mit dem Personalmangel. Es fehlen rund 450.000 Fachkräfte im öffentlichen Dienst. Kurzfristig wären mehr Personalunterstützungen oder mobile Teams denkbar. Aber es ist nicht nur ein besseres Recruiting nötig, sondern vor allem eine veränderte Organisation der Behörden – und Digitalisierung. Derzeit dauern Planung, Genehmigung und Bau eines Windrads im Schnitt sieben Jahre. Sieben Monate wäre ein wünschenswertes Deutschlandtempo.
Nicht alle sind so optimistisch. RWE-Chef Markus Krebber sagt, für die Offshore-Windbranche braue sich „der perfekte Sturm zusammen“: steigende Materialkosten, Preiskämpfe, brüchige Lieferketten, neu geplante Anlagen, die sich nicht rechnen und drastisch an Wert verlieren. Wie passt das zusammen mit Ihrem rosigen Ausblick?
Na ja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Die Rentabilität der Anlagen ist aufgrund hoher Strompreise hoch. Steigende Kosten können mit Aufschlag an die Kunden weitergeben werden. Ein gutes Geschäft. Wie sonst lässt sich erklären, dass es bei den jüngsten Ausschreibungen mehrere Null-Cent-Gebote gab? Der Bieterwettbewerb ist stark. Einspeiserechte werden subventionsfrei versteigert. Selbst Mineralölkonzerne – ausgerechnet – bieten viel Geld, um Offshore-Windparks errichten zu können. Zwei haben gerade für über 12 Mrd. Euro den Zuschlag bekommen. Dies zeigt, wie attraktiv die Bedingungen noch immer sind. Das Problem sind weniger die Profitabilität der Anlagen als vielmehr der unzureichende Umweltschutz, der künftig viel mehr Berücksichtigung finden muss. Genau da könnten deutsche und europäische Windanlagenhersteller übrigens punkten. Wettbewerb macht’s möglich, wenn die Marktregeln stimmen.
Die Förderung erneuerbarer Energien in Deutschland begann vor über 20 Jahren – recht früh im internationalen Vergleich. Warum sind wir heute nicht Weltspitze?
Der Rollback kam um das Jahr 2010 herum. Zwar rief Angela Merkel vorgeblich eine Energiewende aus. Tatsächlich wurde die Wende aber behindert und Rahmenbedingungen verschlechterten sich. Der Markt war lahmgelegt. Die Branche brach weitestgehend ein. Zeitweilig wurden kaum noch neue Windanlagen gebaut. Die Politik wollte eine scheinbar goldene Vergangenheit konservieren und ließ sich durch die Lobbyarbeit der fossilen Energien verunsichern. So wurde der Umbau auf eine erneuerbare Zukunft verhindert. Das hat irre viele wichtige Industriearbeitsplätze gekostet: In der Solarbranche gingen in den letzten zehn Jahren über 120.000 Stellen verloren, in der Windbranche über 50.000. Die kommen jetzt – in Zeiten von allgemeinem Fachkräftemangel – Schritt für Schritt wieder zurück. Mit gutem Grund. Die Branche der erneuerbaren Energien ist eine Zukunftsbranche.
Lief das aus Ihrer Sicht in anderen Ländern besser?
Durchaus. Vor allem in China wurden die erneuerbaren Energien all die Jahre stark unterstützt. Deswegen haben sie jetzt großen Vorsprung. Der deutsche Markt ist interessant. Das größere Wachstum aber findet im Moment weltweit statt – insbesondere in den USA. Die Unternehmen wissen: Windkraft wird im zukünftigen Energiesystem ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Deshalb wollen sie mitmischen und am Wettbewerb teilhaben. Die deutsche Industrie kann davon profitieren, wenn wir es der Branche nicht weiter schwer machen.
Was braucht es jetzt, damit der Knoten auch in Deutschland endlich platzt?
Wie gesagt, die schleppenden Genehmigungsverfahren sind zu beschleunigen. Dafür sind auch die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Online-Tools sinnvoll. Zudem müssen die Ausschreibungsmengen erhöht und verbessert werden. Ein wichtiges Feld sind die ausländischen Märkte: Die USA und China schotten ihre Wirtschaft durch Zugriffe von außen ab. Hier muss die Regierung eine Lösung finden, deutschen Unternehmen den Zugang zu dortigen Ausschreibungen zu ermöglichen. Übrigens könnte dabei gerade die deutsche Qualität als Bonus gelten. Und unbedingt muss im Süden Deutschlands der Ausbau der Windenergie vorankommen. Die 10H-Abstandsregelung in Bayern ist wirtschafts- und zukunftsfeindliche Blockade.
Die EU-Kommission hat diese Woche ein neues Windkraftpaket vorgestellt, das den Anlagenbau europaweit erleichtern soll. Was halten Sie davon?
Es ist absolut sinnvoll und setzt an den wichtigen Baustellen an: Endlich bekäme nicht der billigste Anbieter bei Ausschreibungen den Zuschlag, sondern der beste. Nachhaltigkeit, Cybersicherheit sowie Versorgungssicherheit würden nämlich berücksichtigt. Marktverzerrende Dumping-Angebote aus dem Ausland sollen verhindert werden, deutsche und europäische Anbieter hätten dadurch faire Chancen. Und: Unternehmen sollen verbesserte finanzielle Bedingungen bekommen.