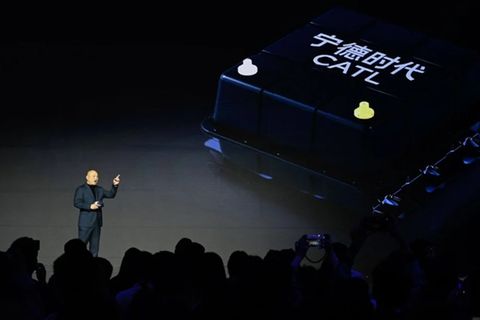Am ersten Tag der neuen Zeitrechnung essen zwei Männer im zwölften Stock zu Mittag, zu ihren Füßen der Dax-Konzern, den sie aufspalten wollen. Guido Kerkhoff und Oliver Burkhard haben belegte Brötchen und Salat kommen lassen, sie essen während des Interviews, so sparen sie Zeit. In der Essener Thyssenkrupp-Zentrale ist dieser 1. Oktober dicht getaktet.
Tags zuvor hat der Aufsichtsrat die monatelange Hängepartie bei dem mehr als 200 Jahre alten Konzern beendet. Hat der Zweiteilung in eine Werkstoff- und eine Industriesparte zugestimmt. Einen neuen Oberkontrolleur gewählt. Und Kerkhoff und Burkhard für fünf weitere Jahre als CEO und Personalvorstand verpflichtet. Die Entscheidung fiel einstimmig. Offenbar haben die beiden einiges richtig gemacht. „Ja, wir sind auch keine Dösbaddel!“, platzt Kerkhoff heraus.
So kann man das sagen. Seine nicht vorhandene Chance hat der 50-jährige Niedersachse gut genutzt. Als Anfang Juli der langjährige Thyssenkrupp-Boss Heinrich Hiesinger überraschend zurücktrat und wenig später auch Oberkontrolleur Ulrich Lehner hinwarf, setzte der Aufsichtsrat Kerkhoff als Interimschef ein. Er galt als reine Übergangslösung. Für eine Neuausrichtung des Konzerns, sagte Kerkhoff damals selbst, habe er kein Mandat.
Nur elf Wochen später ist er der neue starke Mann. Wie hat er das geschafft?
Schicksalswochen
Capital hat Kerkhoff und Burkhard in den vergangenen Monaten wiederholt begleitet und zudem Vertreter der größten Anteilseigner, Aufsichtsratsmitglieder, Gewerkschafter und hohe Manager gesprochen. Es waren Schicksalswochen, in denen hinter den Kulissen der deutschen IndustrieIkone Thyssenkrupp unerwartete Machtverschiebungen stattfanden.
Drei Wochen vor dem ersten Tag der neuen Zeitrechnung: Durchs Foyer des nordrhein-westfälischen Landtags schleppen drei Bäcker eine Torte, groß wie ein Badelaken. Die Abgeordneten zelebrieren an diesem Morgen in Düsseldorf den Abschied vom Steinkohlebergbau. Ein paar Stockwerke höher sitzt in einem Besprechungszimmer Arbeitsminister Karl-Josef Laumann und sorgt sich um eine andere Ruhrpott-Institution: „Aus Sicht der Landesregierung“, sagt er, „müssen wir die Kräfte stärken, die an einem langfristigen Fortbestehen interessiert sind, nicht am schnellen Euro.“
Die Rede ist von Thyssenkrupp. Laumann trifft an jenem Tag Oliver Burkhard. Der Termin ist ein demonstrativer Schulterschluss von Politik und Management, um Gegendruck aufzubauen – gegen die Beteiligungsgesellschaften Cevian aus Schweden und Elliott aus den USA. Die beiden aktivistischen Investoren gelten als potenzielle Zerstörer, die den Konzern filetieren und die Einzelteile versilbern wollen. Aktivisten nennt man sie, weil sie sich gezielt Unternehmen aussuchen, die sie für Underperformer halten, um dann den Vorstand vor sich her- und den Aktienkurs nach oben zu treiben. Interessen von Arbeitnehmern haben dabei keine Priorität.
Cevian hält 18 Prozent an Thyssenkrupp, Elliott knapp drei. Damit sind die Aktivisten gemeinsam so stark wie die Krupp-Stiftung, die altehrwürdige Ankeraktionärin, die 21 Prozent besitzt und in ihrer Satzung vorsieht, „die Einheit des Unternehmens möglichst zu wahren“. Der Dissens dieser ungleichen Eigentümer hat Thyssenkrupp in diesem Sommer ins Chaos trudeln lassen.
Über die Autobahn rauscht die Konzern-Fahrbereitschaft zurück nach Essen. Burkhard, auf dem Beifahrersitz der schwarzen Limousine, hat das Sakko abgelegt. „Ich bin motivierter denn je“, sagt er. „Weil ich es partout nicht ertragen könnte, wenn die falsche Idee gewinnt.“ Bemerkenswert offenherzig ist das, schließlich sind Cevian und Elliott Eigentümer, und Burkhard ist ein Angestellter – da wäre mancher vorsichtiger.
Mit seiner kräftigen Statur könnte man sich ihn auch am Bratwurstgrill auf dem Gewerkschaftsfest vorstellen. Tatsächlich ist er – ungewöhnlich für einen deutschen Spitzenmanager – SPD-Mitglied und kommt von der IG Metall. Hiesinger holte ihn 2013 in den Konzern.
Ein Gewerkschafter im Vorstand? Bei Thyssenkrupp ergibt das Sinn. Dank der Montanmitbestimmung besetzen die Arbeitnehmer dort die Hälfte der 20 Sitze im Aufsichtsrat. Markus Grolms, ranghöchster Gewerkschafter im Gremium und in der Krise zwischenzeitlich dessen Vorsitzender, lobt Burkhard über den grünen Klee: „Null dogmatisch“ sei der, ein „kreativer Brückenbauer“, „extrem kommunikativ und integrativ“. Dass solche Verbündeten Gold wert sind, wird sich in dieser Geschichte noch zeigen.
Bevor die Limousine Essen erreicht und vor dem Gebäude Q1 stoppt, äußert Burkhard noch einen Gedanken. „Wir sind jetzt in der Post-Hiesinger-Zeit“, sagt er. „Wir schlagen Veränderungen vor, die wir in der Vergangenheit nicht vorgeschlagen haben. Dann muss der Aufsichtsrat sagen, ob er sich das mit uns vorstellen kann.“
Tags darauf wird bekannt, dass der Vorstand den Anlagenbau, das derzeitige Sorgenkind des Konzerns, neu aufstellt. Das Management wird gefeuert, zudem löst Kerkhoff die Werften aus dem Bereich heraus und unterstellt sie Burkhard. Zunehmend verfestigt sich der Eindruck, dass dieser Vorstand zwar behauptet, er habe kein Mandat zum Gestalten, sich aber anders verhält. Die machen Politik, bringen sich in Stellung.
Nervenkrieg im Aufsichtsrat
An dieser Stelle nützt ein Blick in die Vorgeschichte. Heinrich Hiesingers Verdienste um den Konzern bestreitet niemand: Er war es, der Thyssenkrupp nach seinem Antritt 2011 vor der Pleite rettete, er hat reformiert, gespart, vereinheitlicht, einen Kulturwandel eingeleitet. Große Teile der Stahlherstellung sind verkauft, den Rest brachte Hiesinger in ein Joint Venture mit Tata Steel ein. Ende Juni wurde der Vertrag unterzeichnet, sein wohl größter Triumph. Nur Tage später trat er ab.
Es lag an den Zahlen. Als Hiesinger kam, stand die Aktie bei 30 Euro, als er ging bei 22 Euro. Im selben Zeitraum war der Dax von 7000 auf über 12.000 Punkte gestiegen. Die Dividende: stets mager, zweimal fiel sie ganz aus. Die operative Marge des Konzerns: eiert seit Jahren um drei Prozent, meist lag sie darunter, Wettbewerber sind teils doppelt so gut. Zudem zeichnete sich wegen der Probleme beim Anlagenbau ab, dass eine Gewinnwarnung im Anzug war.
Cevian und Elliott hielten von Hiesingers Strategie wenig. Ihre Sicht des Konglomerats: teuer, behäbig, ineffizient, wenige Synergien. Durch die schlechten Zahlen sahen sie sich bestätigt, wie Cevian-Chef Lars Förberg im Interview mit Capital unterstreicht .
Kolportiert wurde ferner, dass die Krupp-Stiftung in ihrer Unterstützung Hiesingers geschwankt und den Chef so untergraben habe – auch wenn die Stiftung dieser Interpretation widersprochen und Hiesingers Fortgang bedauert hat.
Nach Capital-Recherchen entwickelte sich im Aufsichtsrat seit Dezember 2017 eine Dynamik, die eigenen Gesetzen folgte und im Führungsvakuum der Jahresmitte gipfelte – womit für Burkhards und Kerkhoffs Durchmarsch erst der Weg frei wurde. Nicht nur inhaltlicher Dissens, auch persönliche Animositäten befeuerten diese Krise.
Verhängnisvolles Dreieck
Im Zentrum standen drei wichtige Mitglieder. Oberkontrolleur Ulrich Lehner, 72, gilt als einer der letzten Vertreter der alten Deutschland AG: führungsstark, manche sagen arrogant, einer, der von Respekt viel und von vorlauten Neulingen wenig hält. Er stand fest zu Hiesinger.
Der Cevian-Abgesandte Jens Tischendorf, 44, genießt einen Ruf als cleverer Analyst – und als harter Hund, dessen Auftritt brüskieren kann. Im Verlauf der Verhandlungen über den Stahldeal soll sein Ton gegenüber Hiesinger gekippt sein, so Sitzungsteilnehmer.
Die Stiftungschefin Ursula Gather, 65, ist Mathematikerin und Rektorin der TU Dortmund. Sie sitzt im Aufsichtsrat der Munich Re, ansonsten ist ihre Wirtschaftserfahrung begrenzt. Manche im Konzern verleitete das zu dem vergifteten Kompliment, sie sei „bestimmt eine gute Professorin“. Sie und Lehner fingen gleich auf dem falschen Fuß an. Ende 2017 fand der Vorsitzende des Aufsichtsrats für einen dort frei werdenden Posten eine Frau aus seinem Netzwerk, heißt es aus dem Umfeld des Gremiums. Die anderen Kontrolleure habe er jedoch erst zwei Tage vor der Abstimmung in Kenntnis gesetzt. Bei der Stiftung fühlte man sich überrumpelt und beschloss, Gather zu entsenden, wozu das Gremium laut Satzung das Recht hat. Lehner habe seiner Kandidatin absagen müssen – ein Gesichtsverlust.
Der Aufsichtsratssaal bei Thyssenkrupp – Sichtblenden, schwarze Ledersessel, der u-förmige Tisch wuchtig wie ein Wall – verströmt die Behaglichkeit eines Kühlschranks. Man kann sich gut vorstellen, wie die Temperatur noch um ein paar Grad fiel, wenn Lehner, Gather und Tischendorf hier aufeinandertrafen. Dass ihr Verhältnis zum Vorsitzenden gestört war, wird es Gather und Tischendorf nicht erschwert haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hiesingers größter Kritiker und die Vertreterin der Stiftung, bisher sein Schutzschild, begannen, Einschätzungen auszutauschen. Das sandte ein Signal, selbst wenn Gather das nicht beabsichtigte.
Dann kam auch noch Elliott ins Spiel. Der Einstieg des US-Fonds wurde im Mai 2018 bekannt. Bald schrieben die New Yorker Hiesinger einen Brief, der den Weg an die Öffentlichkeit fand. Ihre Kritik war zwar sachlich – man gab sich besorgt, ob Thyssenkrupp bei der Stahlfusion angemessen wegkomme. Dennoch schrillten Alarmglocken: In der Vergangenheit sollen die Amerikaner Manager mit Geheimdienstmethoden aus dem Weg geräumt haben, etwa Klaus Kleinfeld bei Arconic.
Als der Aufsichtsrat am 29. Juni über das Joint Venture entschied, griff Gather das Argument aus dem Elliott-Brief auf. Hiesinger muss es als Provokation erlebt haben. Eine Woche später nahm er seinen Hut. Konsterniert hatte ihn wohl nicht nur, dass die Stiftungschefin ein offenes Ohr für seine Gegner hatte, sondern auch Gathers Weigerung, öffentlich Position für ihn zu beziehen. Friedrich von Bohlen, Neffe des letzten Krupp-Alleininhabers Alfried Krupp und Sprecher des Familienrats, kritisiert Gather und die Stiftung dafür scharf. Ihrer Verantwortung für den Konzern und dessen Mitarbeiter sei sie „nicht erkennbar“ nachgekommen. Sie habe „die Dinge einfach laufen lassen“ und verletze jetzt mit der Unterstützung der Zweiteilung den Auftrag der Stiftung.
Nachdem Hiesinger hingeworfen hatte, hielt sich auch Lehner nur noch wenige Tage. Am Donnerstag, dem 12. Juli, erschien ein Interview in der „Zeit“, in dem er den Aktivisten „Psychoterror“ vorwarf. Eine steile These – denn ein Vorgehen wie bei Kleinfeld hat es wohl nicht gegeben. Niemand aus dem Aufsichtsrat oder dem Management sprang Lehner zur Seite, niemand bekräftigte seine Vorwürfe. Er muss erkannt haben, dass er isoliert war. Nur vier Tage nach dem Interview gab er auf.
Aufsichtsratsmitglied Grolms zeigt sich enttäuscht: „Der Lehner hatte keinen Bock auf eine Schlammschlacht“, sagt er, „aber das hat nichts mit Angst zu tun, eher mit Genervtsein.“ Der Abgang wirkte, als habe Lehner sagen wollen: Dann macht euren Mist doch allein. Und manche taten genau das.
Eine Woche nach dem Termin im Düsseldorfer Landtag steht Burkhard in der Thyssenkrupp Academy. Unter dem Neonschriftzug „Town Hall“ sitzen 30 Angestellte der Weiterbildungsstätte und lauschen, wie er die Lage beschreibt. Er spricht mit leiser Stimme, konzentriert, den Blick teils nach innen gekehrt. Das ist jetzt eine seiner wichtigsten Aufgaben: die Leute beruhigen.
Burkhards Botschaft: Wir werden einen Interessenausgleich finden. Denn auch die Argumente der Aktivisten könne man „nicht komplett ignorieren“. Unter Hiesinger habe man „manches erreicht, aber nicht alles geschafft“. Zur Möglichkeit einer Zerschlagung sagt Burkhard: „Der Ruhr-Bischof hat gesagt, auch Gott will das nicht.“ Gelächter. Man möge sich nicht kirre machen lassen, fährt Burkhard fort. „Es ist manchmal schwer erträglich, was wir da immer wieder in der Presse lesen. Doch ganz so schlimm steht es nun auch wieder nicht um uns.“
Er spielt auf eine Geschichte des „Handelsblatt“ an. Dort war Tage zuvor aufgelistet worden, wer Thyssenkrupp alles schon abgesagt hatte: Hakan Samuelsson, CEO von Volvo Cars, Airbus-Chef Tom Enders, der frühere Bayer-Boss Marijn Dekkers, Ex-Deutsche-Bank-Vorstand Marcus Schenck. Niemand will Lehners Stuhl, solange sich die Aktivisten und die Stiftung auf keine Linie einigen können. Mit jeder Absage wird der Job unattraktiver.
„Es wird nicht so schwer sein, einen oder eine zu finden“, versichert Burkhard in der Town Hall. „Man muss bloß sagen, für welche Strategie.“ Dass er bereits eine ziemlich gute Vorstellung hat, wie die aussehen könnte, kann er noch nicht offen sagen. Tatsächlich ist der Vorstand schon seit etwa einem Monat in die Offensive gewechselt – denn die Lage verschiebt sich zu seinen Gunsten.
Kerkhoff greift an
Am 13. Juli hatte Lehner Guido Kerkhoff das Amt des Interims-CEO übertragen. Der nahm aus Pflichtgefühl an, schränkte jedoch ein: „Dann kann ich aber keine Strategie machen. Da hört mir ja keiner zu.“ Das leuchtete damals allen ein.
Seither aber ist Lehner von Bord gegangen, der Nominierungsausschuss bekommt seinen Platz nicht gefüllt, eine Gewinnwarnung wurde ausgesprochen, Cevian und die Stiftung finden keine gemeinsame Vision. Die Lage ist verzweifelt. Worauf Kerkhoff einen Vorstoß wagt: „Wollt ihr einen Vorschlag von uns?“
Man bekommt zum genauen Ablauf nicht viel aus ihm heraus – nur dass der Startschuss gegen Mitte August fiel. Da zog sich der Vorstand nach Schloss Landsberg zurück, 1903 von August Thyssen erworben. Schon unter Hiesinger haben sie sich hier zu Strategiesitzungen versammelt – und sich, wie Kerkhoff es ausdrückt, „ein sehr breites Optionenspektrum angeguckt“.
Es tagen Kerkhoff, Burkhard und der dritte Vorstand Donatus Kaufmann, ein Compliance-Experte. In die Überlegungen wird zudem eine Gruppe von etwa 20 Helfern eingeweiht. Sie wissen, es kann nicht alles beim Alten bleiben, aber den Konzern in seine fünf Sparten zerlegen wollen sie auch nicht.
Was, wenn man einen Werkstoff- und einen Industriekonzern schüfe? Hier die zyklischen Geschäfte, dort der stete Cashflow – es würde die Komplexität der Aktie mindern. Die Investoren müssten es goutieren, gleichzeitig verhindert es einen Ausverkauf und schützt Arbeitsplätze, so die Hoffnung. Eine ähnliche Option war bereits als Alternative zum Stahl-Joint-Venture andiskutiert worden, aber Hiesinger hatte sie damals abgelehnt.
Der Vorstand teilt sich die Aufgaben, Kerkhoff wirkt als Außen-, Burkhard als Innenminister. Der CEO baut Brücken zwischen den Eignern, er stellt Cevian und der Stiftung die Idee vor. Offenbar sind sie gottfroh, dass jemand die Initiative ergreift, und nehmen dankend an. „Wir haben den Vorschlag so gemacht, wie er jetzt umgesetzt wird“, sagt Kerkhoff. „Der fand seine Unterstützung. Wir waren schon überrascht, wie schnell der Aufsichtsrat sich einig war.“
Ihm hilft, dass er sich im Rahmen seines Mandats als entschlossener Sanierer profilieren konnte. Den Anlagenbau hat er bereits umstrukturiert, das Management gefeuert, die Werften zur Chefsache gemacht, neue Dreijahresziele ausgegeben. Allmählich scheint es nicht mehr naheliegend, ihn bald abzulösen.
Zur selben Zeit rudern die Aktivisten zurück. Nein, eine Zerschlagung habe man nie gewollt, heißt es von Cevian. Auch Elliott redet plötzlich von Fusionen und Zukäufen.
Burkhard fällt die Rolle zu, die Arbeitnehmer mitzunehmen. Er hat das gerade erst durchexerziert: Beim Stahl-Joint-Venture war er Verhandlungsführer. Auch diesmal klappt es. Entscheidend ist seine Zusammenarbeit mit Markus Grolms, dem Interims-Aufsichtsratschef. „Die Rolle, die Herr Grolms gespielt hat, wie er seine Seite mitgenommen hat, wie er aktiv gestaltet hat, das fand ich bemerkenswert“, lobt Kerkhoff. Man einigt sich auf die Grundlagen: Keine betriebsbedingten Kündigungen, die Mitbestimmung bleibt garantiert.
Am 30. September kommt der Aufsichtsrat zur entscheidenden Sitzung zusammen. Außer Lehner hat auch René Obermann sein Mandat niedergelegt, die Kapitalseite hat daher nur acht Stimmen, die Arbeitnehmer zehn. Sie hätten die Teilung abschmettern können. Doch der Plan geht einstimmig durch.
Die Haie kreisen
Auf einer Anrichte in Kerkhoffs Eckbüro im 13. Stock steht eine Sammlung von Modellautos, lauter VW-Bullis. Die fährt Kerkhoff auch im echten Leben. Er zeigt ein Handyfoto, darauf ein Original in 70er-Jahre-Orange, erst diesen Sommer ist er damit aus dem Urlaub in der Provence nach Essen zurückgetuckert.
Status interessiere ihn nicht, sagt Kerkhoff. Ihm geht es um Anerkennung, „dass man sieht, wofür ich mich einsetze. Mein bester Freund hat gesagt: Du bist gern nützlich.“
Gefragt, warum er sich diesen Job antue – CEO bei Thyssenkrupp, bei dieser Gemengelage unter den Eignern –, grinst Kerkhoff schief und sagt: „Es wäre ein Leichtes gewesen zu gehen. Ich genieße einen guten Ruf, es mangelt nicht an Angeboten. Mag es von einigen als Notlösung wahrgenommen werden, das ist mir egal. Ich laufe nicht weg. Denn mir liegen die Mitarbeiter und das Unternehmen sehr am Herzen.“
Natürlich stellt sich die Frage, ob es sich damit hat. Oder ob die jetzigen Beschlüsse nur eine Atempause bedeuten, bevor Cevian und Elliott weiterdrängen. An ihren Interessen – möglichst schnell möglichst viel Rendite – hat sich ja nichts geändert, auch wenn die verfahrene Lage sie in eine Waffenruhe gezwungen hat.
Kerkhoff antwortet darauf nicht direkt. „Jede große Organisation kennt politische Spielchen“, sagt er. „Ich bin mir meines Umfelds bewusst. Da sind Haifische dabei.“
Mitarbeit: Thomas Steinmann
Der Beitrag ist in Capital 11/2018 erschienen. Interesse an Capital? Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay.