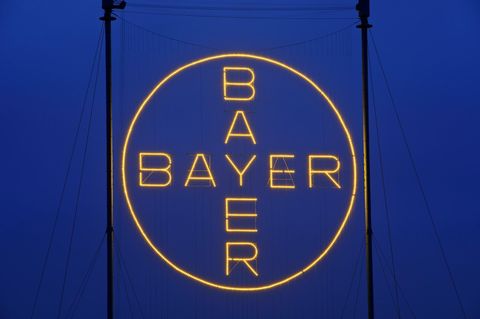Bis zur Hauptversammlung am 10. Mai soll die Vereinbarung fertig sein: Die deutsche Linde AG und der amerikanische Konkurrent Praxair schließen sich zum weltgrößten Hersteller von Industriegasen zusammen, wenn alles glattläuft. Um den letzten Widerstand unter Aktionären und Beschäftigten des deutschen Traditionskonzerns zu brechen, reden die Manager in München in diesen Tagen ununterbrochen von einer „Fusion unter Gleichen“. Mag die Zentrale des neuen Konzerns in die USA wandern, mag auch der bisherige Praxair-Chef an die Spitze des fusionierten Unternehmens treten – das alles ändere nichts an einem gleichberechtigten Zusammenschluss, heißt es in München.
Um die Skeptiker endlich zu besänftigen, schoben die Linde-Manager zuletzt ein weiteres Argument nach. Die paritätische Besetzung der künftigen Konzernführung sei keineswegs nur für die Anfangsjahre geplant, sondern „ganz grundsätzlich vereinbart und gesichert“. Diese schöne Formulierung stammt vom amtierenden Linde-Chef Aldo Belloni, einem erst vor Kurzem reaktivierten Ruheständler. Sie ähnelt ein bisschen einem Produkt, das die Linde AG erfolgreich in vielen Ländern verkauft: dem schmerzstillenden Lachgas, mit dem Zahnärzte operieren.
Solche Versprechen wie bei Linde und Praxair gab es schon häufiger in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Sie wurden allerdings in keinem Fall wirklich eingehalten. Im September 1998 etwa schlossen sich die Bayerische Vereinsbank und die Hypotheken- und Wechsel-Bank zur HypoVereinsbank zusammen. Auch damals versprachen die Architekten der „Fusion unter Gleichen“ die paritätische Besetzung der Führungsgremien. Schon zwei Monate später war davon keine Rede mehr.
Im gleichen Jahr schlossen Daimler-Chef Jürgen Schrempp und Chrysler-CEO Bob Eaton ihre berühmt-berüchtigte „Hochzeit im Himmel“. Auch damals versprachen alle Beteiligten eine „Fusion unter Gleichen“ mit paritätischer Besetzung des Vorstands, mit Schrempp und Eaton als Co-Chefs. Das Arrangement hielt keine zwei Jahre, die Deutschen regierten durch, und nach weiteren sieben Jahren trennten sich beide Konzerne wieder.
Die Beispiele zeigen: Die paritätische Besetzung von Vorständen kann unter normalen Umständen nicht funktionieren. Am Ende setzt sich die eine oder die andere Seite mit ihrer Kultur durch.
Was passiert, wenn man auf Biegen und Brechen wirklich an der Idee einer „Fusion unter Gleichen“ festhält, kann man in Japan besichtigen. Dort legten die Dai-ichi Bank und die Nippon Kangyo Bank 1971 bei ihrer Fusion fest, dass zwei gesonderte Personalabteilungen über die paritätische Zusammensetzung aller wichtigen Führungspositionen wachen sollten. Über zwei Jahrzehnte hielten die Fusionswächter eisern durch – und brachten die Großbank so an den Rand des Zusammenbruchs. Die ständigen Fehden zwischen ehemaligen Dai-ichi-Leuten und früheren Kangyo-Männern lähmten den ganzen Konzern. Im Jahr 2000 erzwang das Finanzministerium in Tokio einen Zusammenschluss mit zwei weiteren Kreditinstituten. Von einer „Fusion unter Gleichen“ redete nun niemand mehr.
Bernd Ziesemer war Chefredakteur des „Handelsblatt“. In der Kolumne „Déjà-vu“ greift er jeden Monat Strategien, Probleme und Pläne von Unternehmen auf – und durchleuchtet sie bis in die Vergangenheit. Die vorliegende Kolumne ist in der aktuellen Capital erschienen. Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes oder GooglePlay