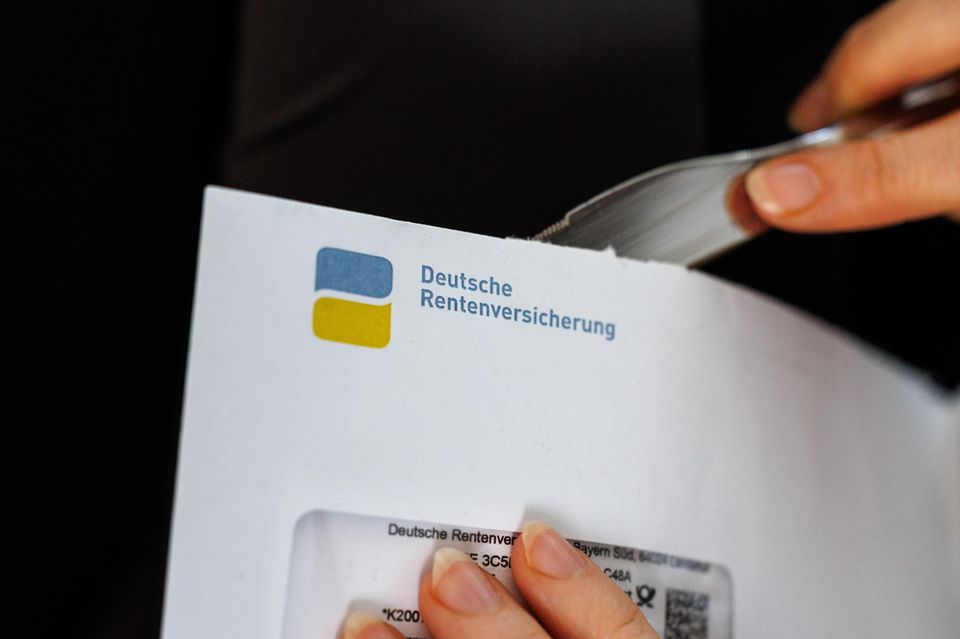Lars Vollmer ist Unternehmer, Vortragsredner und Autor. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Zurück an die Arbeit - Wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden", Linde Verlag, Februar 2016
Im Gespräch mit einem Geschäftsführer: „Herr Vollmer, das ist ja alles gut und schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in einem Betrieb mit 25 Leuten funktioniert, aber wir sind nur zu viert.“
Zwei Tage später auf einer Veranstaltung: „Herr Vollmer, ich verstehe ja Ihre Ideen, aber die Umsetzbarkeit hört bei 500 Mitarbeitern eben auf.”
„600.000 Menschen in der Kürze ins Boot holen und die Veränderung umsetzen? Wie stellen Sie sich das vor, Herr Vollmer? Das ist unmöglich!”, so der Vorstand eines großen deutschen Automobilkonzerns.
Ja, was denn nun? Zu groß oder zu klein?
Es geht einfach nicht
Wenn ich mit Unternehmern über Ideen, Veränderungen oder neudeutsch „Change” spreche, sind viele meiner Gesprächspartner entrüstet. Wie könnte mir denn einfallen, solche Vorschläge zu machen! Es spielt keine Rolle, zu welchen organisationsrelevanten Thesen ich etwas sage – sei es die Abschaffung von Zeiterfassung, von überflüssigen Meetings, wirkungslosen Leistungsanreizen, Führung, Organisation, Arbeit etc. – ich bekomme von Innovativen und mäßig Innovativen gleichermaßen den Einwurf zu hören: „Bei unserer Unternehmensgröße geht das nicht.”
Auch ein paar andere Kriterien werden gerne herangezogen, um meine Forderungen zu entkräften: In der Bankenbranche geht das vielleicht, allerdings nicht bei Maschinenbauern. Gerne auch andersherum. Oder: Mit Akademikern mag das möglich sein, aber nicht mit gering qualifizierten Mitarbeitern.
Wenn Sie mich fragen: Alles bloß fadenscheinige Ausflüchte, um keine tiefgreifenden Veränderungen angehen zu müssen. Und mangelnde Vorstellungskraft.
Wäre dem tatsächlich so, dass die Größe ein Kriterium für die Organisationsform ist, wieso sollten dann Unternehmen jedweder Größe tayloristisch organisiert werden können? Wie kann es dann sein, dass diese Organisationsform für kleine und große, deutschlandweit und international tätige, Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen das Allheilmittel zu sein scheint?
Weil Gewohnheit bequem ist und denkunflexibel macht. In den Köpfen vieler Verantwortlicher hat sich eine mächtige Blockade breitgemacht: Die Aussage „Es geht nicht” ist gleichzusetzen mit „Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, irgendwas anders zu machen”.
Menschen als Change-Objekt
Dabei sind tiefgreifende Veränderungen absolut notwendig, wenn Unternehmen sich an das schnelle Tempo und die Komplexität der Welt anpassen wollen. Die Größe eines Unternehmens spielt bei der Umsetzbarkeit von organisationellen Maßnahmen überhaupt keine Rolle – genauso wenig wie die Branche oder die Qualifikation der Mitarbeiter. Alle meine Vorschläge, was in Unternehmen verändert werden könnte, beziehen sich nämlich nicht auf die Menschen in Unternehmen, sondern auf das System selbst.
Die Arbeit an Strukturmerkmalen der Organisationen – an Entgeltsystemen, Kennzahlen, internen oder externen Referenzen, Organigrammen etc. – ist nun völlig größenunabhängig. Die Anzahl der Arbeitnehmer hat keinerlei Einfluss auf den Veränderungsprozess, weil die Veränderung eben nicht an den Menschen direkt stattfindet, sondern an der Organisation, in der sie sich bewegen.
Darum ist die Frage nach der Größe in etwa so, als würden Sie danach fragen, ob eine bestimmte Veränderung im ersten Stock des Gebäudes oder im zweiten überhaupt umsetzbar ist – völlig irrelevant. Da suchen sich Unternehmer – und natürlich auch die Mitarbeiter – künstliche Unterschiede, die sie dann als Argumentation heranziehen, warum eine Maßnahme bei ihnen absolut nicht umzusetzen ist und deshalb gar nicht erst angestoßen werden braucht.
Wer dem Trugschluss verfällt, alle Mitarbeiter sollten ins Boot geholt werden, man müsse die Belegschaft überzeugen und die Mitarbeiter einschwören, glaubt an einen organisatorischen Aufwand: Ich habe 30.000 Mitarbeiter, muss mit allen sprechen, sie „abholen” und mobilisieren.
Ich kann schon verstehen, dass dieses mechanistische Bild von Change angsteinflößend ist und sich ein riesiger Gedankenberg an Arbeit auftürmt. Diese Unternehmen werden die Maßnahmen auch niemals angehen, bis das Verständnis für den Unterschied zwischen Arbeit an Menschen und Arbeit am System da ist.
Kräftige Entscheidung gegen Bonuszahlungen
Dabei ist es eine Sache von wenigen Tagen, zum Beispiel die individuellen Leistungsvergütungen abzuschaffen. Wenn Sie mit dem Betriebsrat diskutieren müssen, dauert es vielleicht ein paar Wochen länger. Aber der Change-Vorgang umfasst lediglich die Zeit bis zur Entscheidung und die geringfügige administrative Umsetzung.
Daimler hat es vor Kurzem angekündigt. Bosch hat es in diesem Fall sogar schon gemacht: Die Gruppe hat 2015 angekündigt, die individuelle Leistungsvergütung abzuschaffen, und hat das Anfang 2016 auch eingeführt. Es hat keine zwei Jahre gedauert, bis die Veränderung in 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern angekommen ist.
Und warum? Weil nur ein Umswitchen – eine kräftige Entscheidung – notwendig ist, um die Veränderung zu initiieren. Der eigentliche Change-Prozess erfolgt erst im Anschluss. Wenn die Rahmenbedingungen durch die Entscheidung neu abgesteckt und die Realisierung angestoßen wurden, setzt die Organisation ihre Entwicklung eben in den neuen Bahnen fort. Das passiert zwar nicht von selbst, aber ganz automatisch.
Denn Ihr Unternehmen lebt. Ja! Jedes soziale System ist ständig in Bewegung. Ob sie nun ein Veränderung anstoßen oder nicht. Wo Menschen sind, findet permanent Bewegung statt. Teamkonstellationen, der Markt und die Menschen an sich, die in Ihrem Unternehmen arbeiten – nichts davon ist stabil. Selbst wenn das Team dasselbe bleibt, verändern sich die Personen und die kommunikativen Muster darin.
Ein „Los-jetzt-verändere-dich-Tritt” in den Allerwertesten ist nicht notwendig. Denn Ihre Mitarbeiter stehen nicht an der Mole und warten, bis das nächste Schiff kommt. Von persönlicher und gesellschaftlicher Entwicklung getrieben, schippern sie selbst durch die Gegend – der eine im Ruderboot, der andere im Fischkutter und ein dritter vielleicht auf einem Schnellboot. Still steht allerdings keiner.
Größe ist kein Totschlag-Kriterium
Nun müssen Sie sich keinesfalls an allem, was beispielsweise Bosch macht, ein Vorbild nehmen. Der Fall illustriert allerdings trefflich: Einen Leistungsanreiz oder sonstige tayloristische Management-Praktiken abzuschaffen, hängt nun nicht im Geringsten von der Anzahl der Mitarbeiter
Ein kausaler Zusammenhang zwischen Größe und Leistungsanreizen bestünde lediglich dann, wenn Sie glauben, dass Sie anschließend jeden Einzelnen dazu bringen müssten, pünktlicher zur Arbeit zu kommen und sich mehr zu engagieren. Dann würde es natürlich einen Unterschied machen, ob Sie fünf oder zweitausend Mitarbeiter haben.
Solange die Menschen in Unternehmen das aber nicht verstanden haben, verbieten sie sich, überhaupt eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie eine solche Veränderung in ihrem eigenen Unternehmen aussehen könnte. Sie machen die Schotten dicht und das Denken findet an dieser imaginären Grenze ein jähes Ende. Schließlich haben sie das Totschlag-Kriterium ja bereits gefunden: Unternehmen zu groß … wahlweise zu klein.
Ihre Zeit ist besser investiert in das Treffen kräftiger Entscheidungen für gewinnbringende Veränderungen. Realisieren Sie diese, statt Ihre Zeit darauf zu verschwenden, Change in Gang setzen zu wollen. Der findet ohnehin von ganz alleine statt! Und bitte: Verwenden Sie nicht einen weiteren Moment auf das vermeintliche Ausschluss-Kriterium Größe!
Weitere Beiträge von Lars Vollmer: Das Märchen von der Wissensarbeit, Denkfehler der New-Work-Bewegung, Schluss mit Bullshit-Bingo, Neues Jahr, neues Glück, Management von vorgestern, Oje, Oje VW und Das Tesla-Experiment
Newsletter: „Capital- Die Woche“
Jeden Freitag lassen wir in unserem Newsletter „Capital – Die Woche“ für Sie die letzten sieben Tage aus Capital-Sicht Revue passieren. Sie finden in unserem Newsletter ausgewählte Kolumnen, Geldanlagetipps und Artikel von unserer Webseite, die wir für Sie zusammenstellen. „Capital – Die Woche“ können Sie hier bestellen: