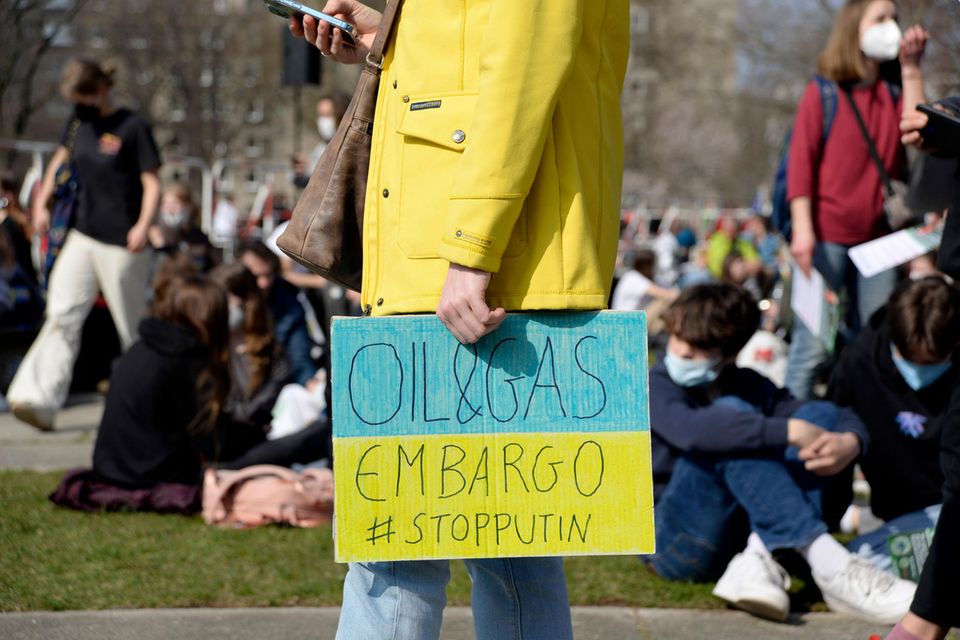Ein bizarrer Streit ist um die deutsche Wertschöpfung, um Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand entstanden. Es geht um russisches Gas, wie schnell wir darauf verzichten können oder sollen – und was passiert, wenn Wladimir Putin oder Europa selbst den Gashahn zudreht. Der Streit schwelte diese Woche vor einer technischen Frage, ob wir das Gas weiterhin in Euro zahlen – oder in Rubel, wie der russische Präsident es verlangt.
Der „Kompromiss“, den Russland nun präsentiert hat, ist eine technische Albernheit, wenn es nicht so ernst wäre: Das Gas kann in Euro auf Euro-Konten bei der Gazprom-Bank gezahlt, soll aber innerhalb der Bank auf Rubelkonten übertragen, umgetauscht und dann an Gazprom weitergeleitet werden. Da Gazprom wie andere Exporteure ohnehin seit Kriegsbeginn 80 Prozent seiner Einnahmen aus dem Ausland in Rubel konvertieren muss, geht es im Kern um eine Machtprobe und einen Nervenkrieg. Jede Seite kann nun behaupten, nicht eingenickt zu sein – was nicht darüber hinwegtäuscht, dass unsere Energieversorgung seit Wochen an einem Abgrund balanciert.
Bruchstellen zwischen Maschinenraum und Studierzimmer
Die Szenarien über die Beherrschbarkeit gehen weit auseinander, sie zeigen Bruchstellen zwischen Maschinenraum und Studierzimmer, zwischen Hochofen und Excel, aber auch neue Lager innerhalb der Ökonomen tun sich auf. Und was auf Twitter als akademischer Streit begann, hat es sogar in den „Economist“ geschafft, der lakonisch feststellte: „Solange das Gas weiter fließt, läuft auch die Debatte über die Moral des Gaskaufs.“
Auf der einen Seite hält eine Reihe von Ökonomen einen Stopp russischen Gases für beherrschbar und verkraftbar. Sie kommen in ihren Modellen, je nach Szenario und Sonneneinstrahlung, auf eine schwere Rezession zwischen minus drei und minus vier Prozent. Flankiert oder, besser, garniert werden die Excel-Tabellen mit dem moralischen Überbau „Frieren für den Frieden“. In diesen Chor stimmen Klimaschützer ein, die Gas, Öl und Kohle ohnehin loswerden wollten. Ölkessel sollten ja eh raus, nun auch Gasthermen – das Haus muss dann halt bis zum Winter gedämmt werden. Schwerter zu Windrädern!
Auf der anderen Seite formiert sich eine neue Allianz aus Industrie, Gewerkschaften sowie Wirtschaftsministerium und Kanzleramt, die nicht nur eine Störung, sondern eine Zerstörung des industriellen Kerns unseres Landes fürchten.
Im Kanzleramt lästert man seit Wochen schon über die „absurden Szenarien“ diverser „Couch-Strategen“. Robert Habeck, der diese Woche den Notfallplan Gas vorsorglich aktivierte, warnt jeden zweiten Tag in den „Tagesthemen“ vor einer schweren Rezession. Die Modelle gewerkschaftsnaher Ökonomen kommen eher auf minus sechs Prozent. Aber keiner brachte es so schäumend auf den Punkt wie BASF-Chef Michael Brudermüller im Interview mit der „FAZ“. Er sprach von „irreversiblen Schäden“, der schwersten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Stopp der Lieferungen könne „unseren Wohlstand zerstören“. Ein Verzicht auf russisches Gas sei ein Umbau, für den man vier bis fünf Jahre brauche – und nicht vier bis fünf Wochen. „Es reicht nicht, dass wir jetzt alle mal die Heizung um zwei Grad runterdrehen“, warnte er.
Die Chemieindustrie braucht Unmengen an Energie
Die BASF müsste in Ludwigshafen, dem größten Chemiekomplex der Welt, bei einem Ausfall die Produktion zurück- oder ganz herunterfahren. „Die größten Wortführer“, sagte Brudermüller, „sind diejenigen, die an dieser Stelle keine Verantwortung tragen.“ Und setzte hinzu: „Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören? Das, was wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben? Ich glaube, ein solches Experiment wäre unverantwortlich.“
Es gibt ähnliche Szenarien für die Stahlindustrie, für die Metall-, Glas- und Keramikbranche.
Allein für die Produktion von rund 40 Millionen Tonnen Stahl werden in Deutschland pro Jahr 2,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht. In vielen industriellen Prozessen kann man nicht ersatzweise Kohle verfeuern, oder Atomstrom oder gar Ökostrom dazu schalten. Zwar laufen in vielen Fabriken, in den Hochöfen des Ruhrgebiets und den „Steamcrackern“ der BASF, Experimente mit Ökostrom und Wasserstoff – aber es sind Prototypen, die in bescheidenen Maßstäben ab 2023 oder später einsatzbereit sind. Gas ist in der Industrie unverzichtbar, und wenn man gut die Hälfte aus einem Imperium des Bösen bezieht, hat man ein Problem.
Vor allem die Chemie braucht Unmengen an Energie. 2020 waren es in Ludwigshafen knapp sechs Millionen Megawattstunden Strom und 16,5 Millionen Megawattstunden fossile Brennstoffe. Wir reden nicht über ferne Engpässe in Lieferketten, die man bei Amazon oder im dm-Markt dann doch nur auszugsweise und in Anekdoten spürt. Die BASF hat rund 45.000 Produkte, fast überall in unserem Alltag steckt Chemie drin, in Polstern, Dämmmaterial, Kleidung, Lacken, Farben, Batterien, Baustoffen, Verpackungen, in Dichtungen und Beschichtungen – ohne chemische Produkte würde bald die Autoindustrie nichts mehr produzieren, andere Branchen ebenfalls.
Ist das alles Panikmache?
Eine Kettenreaktion wäre die Folge, bei der man sich fragt, wie man sie modellieren kann. Seit Wochen erleben wir schon eine Panik auf den Energie- und Rohstoffmärkten, in vielen Lieferketten herrscht ein Bluthochdruck wie beim Hamsterkauf von Klopapier. Aber warum? War der Handel mit Russland nicht auch schon zu vernachlässigen, ja, ein Verzicht auf die paar Prozentpunkte im Handel verkraftbar?
Ist das alles Panikmache? Von ein paar Managern, die weiter in Ruhe Geschäfte machen wollen? Wohl kaum. Ich sehe das Problem eher auf der anderen Seite, in den Modellen jener Ökonomen, die einen Ausfall für verkraftbar oder zumindest für beherrschbar halten. Man müsste halt zur Not Millionen Menschen wieder in Kurzarbeit schicken und zahlreiche Unternehmen mit Staatskrediten und Steuergeldern am Leben erhalten. Ist ja alles erprobt und gelernt, oder? Haben wir in den Lockdowns und zuvor in den diverseren Finanzkrisen auch hinbekommen.
Hinter der fast routinehaften Nonchalance, mit denen epochale Krisenmanagements wie eine Probe für einen Feueralarm skizziert werden, steckt ein Problem. Man könnte meinen, manchen Ökonomen seien die vielen Weltkrisen etwas zu Kopf gestiegen, angesichts der dreistelligen Milliardensummen, die man während der Pandemie fingerschnippend mobilisieren konnte. Jede Krise wird zu einem Kapitel des „Playbooks“, in dem die Stichworte und Instrumente zwischen Kurzarbeit und KfW ja stehen.
Ist das eine Art „Long Covid“ der deutschen Ökonomie? Wir reden nicht mehr von Restaurants oder Kinos, die man schließt, von Tanzlehrern, Kellnerinnen und Fitnesstrainern – das war schon schlimm genug. Wir reden von möglichen unkontrollierbaren Prozessen in unserer industriellen Wertschöpfung. Wir reden nicht von Stress in Lieferketten, sondern von Chaos.
Wir sind abhängig
Jeder, der glaubt, man könne den Ausfall von russischem Gas kurzfristig ersetzen, durch ein paar LNG-Dampfer aus den USA und Wüstenstaaten plus etwas mehr Windräder, die wir etwas schneller aufstellen, ist naiv. Knapp 77 Prozent unseres primären Energieverbrauchs kommt immer noch aus fossilen Brennstoffen. Und ein guter Teil davon kommt aus Russland, trotz des Ausbaus der Erneuerbaren, die 16 Prozent beisteuern.
Das Problem ist nicht, das Ökonomen nun als Excel-Krieger den Ausfall unterschiedlich bewerten. Das Problem ist, dass wir abhängig sind und uns einreden, seit dem Kriegsausbruch es nicht mehr sein zu müssen. Das ist der Abgrund, an dem unser Land, die viertgrößte Industrienation der Erde, seit Wochen wandelt. Weil wir diese Illusion – und bei der Energieversorgung waren wir über Jahre in der Lage, uns alles Mögliche einzureden – nicht mehr selbst steuern. Am Rande dieses blutigen Krieges sind Deutschland und Russland zu einer furchtbaren Schicksalsgemeinschaft geworden, weil die Energieversorgung so verflochten ist.
Man hofft fast, dass auch die Russen das wissen, in der Hand aber haben wir es nicht – der Hebel, an dem Moskau sitzt, ist etwas länger, auch wenn Putin mit dem Rücken zur Wand steht. Wir müssen weg von diesem Gas, so oder so, auch weg von Öl und Kohle. Aber all das sollte ja ein Prozess sein, den wir über Jahre und Jahrzehnte planvoll steuern, und da war der Umstieg schon schwer genug. Wer suggeriert, man könne in sechs Monaten erreichen, was man bis 2030 und darüber hinaus schaffen wollte, beschwört Szenarien, die unkalkulierbar sind.