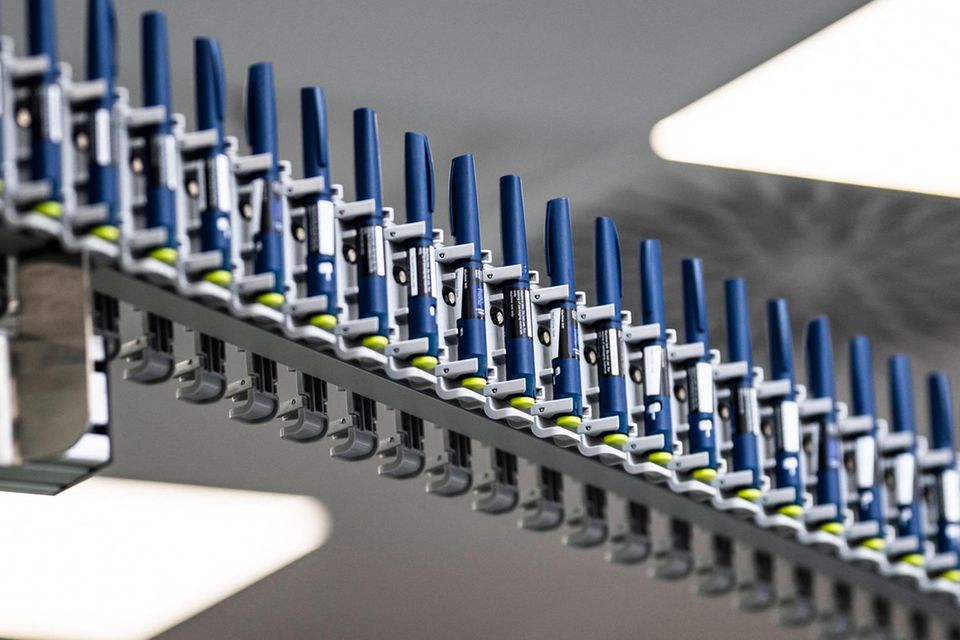Es fällt nicht besonders schwer, sich über die Pläne für eine „Wehrpflicht light“ lustig zu machen. „Von wegen Zeitenwende“, „Pflicht zum Fragebogen“, „Adé, Kriegstüchtigkeit“ – das Urteil vieler Hobby-Generäle in dieser Woche war eindeutig: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine erste klare Niederlage erlitten.
Tatsächlich kann man hinter dessen Pläne ein Fragezeichen setzen, sie sind wahrscheinlich wirklich ein Zeichen der Schwäche. Ein Zeichen seiner eigenen Schwäche in seiner Partei, der SPD, und auch beim Kanzler, der frühzeitig deutlich gemacht hatte, was er von der Wiedereinführung einer allgemeinen Wehrpflicht für alle jungen Menschen im Land hält, nämlich gar nichts. Darüber hinaus aber auch ein Zeichen der Schwäche für die Bundeswehr und den Verteidigungsetat. Denn die Armee hätte derzeit weder die personellen und logistischen noch die finanziellen Ressourcen, um jedes Jahr zehntausende Rekruten auszubilden.
Doch selbst wenn man all diese Kritikpunkte von den Plänen abzieht, so wäre ich mir nicht sicher, dass Pistorius nun in den Augen der Bevölkerung substanziell an Popularität einbüßt, nach dem Motto: Seht her, der Überflieger kann es doch nicht. Denn all die Einwände und Einschränkungen kann man nur dann wirklich gegen Pistorius wenden, wenn man großzügig ignoriert, dass er selbst immer wieder einräumte, er hätte gerne mehr erreicht und durchgesetzt, dieses Mehr wäre aber angesichts der Kürze der Zeit und der objektiven Umstände in der Bundeswehr nicht realistisch gewesen.
Das führt zur eigentlichen Erkenntnis dieser Woche: Die Wählerinnen und Wähler, egal in welchem Lager, haben ganz offenkundig ein gutes Gespür dafür, wer sich wirklich um die Probleme in seinem Arbeitsbereich kümmert und wer allen Widerständen und Widrigkeiten zum Trotz einfach seine Arbeit erledigt. Unter allen Bundespolitikern genießt Pistorius – obwohl die Unterstützung der Ukraine und die Aufrüstung des Landes alles andere als unumstritten sind – mit Abstand die höchsten Popularitätswerte: 1,7 Punkte, weit vor den anderen wichtigen Ministern des Kabinetts, Robert Habeck, Christian Lindner und Annalena Baerbock. Und erst dahinter, einen Platz vor Alice Weidel (wenn auch mit großem Vorsprung), folgt Kanzler Olaf Scholz.
Man darf solchen Umfragen nicht allzu viel Bedeutung beimessen, aber ein Indikator sind sie schon: Während bei Scholz, Habeck, Lindner und Baerbock die ganze Zeit (zurecht) immer die Frage mitschwingt, was sie sonst noch so im Schilde führen (Machterhalt, Wahlkampftaktik, Koalitionsbruch, Kanzlerkandidatur), hat man bei Pistorius den Eindruck: Da macht einer einfach seinen Job, einigermaßen ehrlich und ernsthaft. Und das allein hebt ihn schon wohltuend ab vom Rest der Ampel-Mannschaft.
Merz macht einfach sein Ding
Ähnliches gilt für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Angesichts einer größtenteils kritischen Kommentarlage, befeuert übrigens durch anhaltende Sticheleien und mehr oder weniger offene Einschätzungen aus seiner eigenen Partei, im Grunde könne es der Vorsitzende ja doch nicht, wirken seine Sympathiewerte gar nicht so übel. Merz macht einfach weiter und lässt sich inzwischen, zumindest öffentlich, nichts anmerken.
Für die wie so oft ziemlich überhebliche These aus dem Lager des Bundeskanzlers jedenfalls, die Union könne dem SPD-Amtsinhaber keinen größeren Gefallen tun, als mit einem Spitzenkandidaten Merz in den Wahlkampf zu ziehen, gibt es eigentlich keinen Beleg. Die Europawahl lieferte ihn jedenfalls nicht. Eher sieht es doch umgekehrt aus: Die SPD kann der Union keinen größeren Gefallen tun, als mit Scholz in den kommenden Wahlkampf zu ziehen.
Im Grunde hat die Europawahl ein treffendes Bild der Stimmungslage im Bund geliefert: Wenn kein Wunder mehr geschieht, stürzt die SPD ab und muss sich mit Scholz als Spitzenkandidat auf ein Ergebnis zwischen 14 bis 16 Prozent einstellen. Für mehr müsste sich Scholz komplett neu erfinden – das wäre das Wunder – und sich offen, unverstellt und wahrscheinlich auch mit einer großen Portion Selbstkritik und Demut erklären. Wer ihn kennt, ahnt, dass so eine Verwandlung nicht zu erwarten ist.
Die Union kann mit einem Ergebnis um die 30 Prozent rechnen, was eigentlich zu wenig ist angesichts der politischen Stimmung und dem Ansehen der Koalition. Will sie mehr erreichen, müsste sie wahrscheinlich konkreter klären, was sie im Falle eines Wahlsiegs eigentlich anders machen will – und mit wem. Das setzt voraus, dass man in vier bis fünf zentralen Politikfeldern klare, aber auch realistische Alternativen zur aktuellen Ampelpolitik entwickelt: in der Energie- und Wirtschaftspolitik, in der Finanz-, Innen-, Verkehrs- und Verteidigungspolitik.
Angesichts ihrer Koalitionsoptionen mit SPD und Grünen müsste sie dafür wohl auch ein paar alte Glaubenssätze (vorsichtig) zur Diskussion stellen. Da das wiederum nicht zu erwarten ist, sind die 30 Prozent aus der Europawahl auch für den Bund wahrscheinlich ein ganz realistischer Zielwert.
Bleiben FDP und Grüne: Das schlechte Abschneiden der Grünen am vergangenen Sonntag überzeichnet ihre wahre Lage – bei der letzten Bundestagswahl kamen sie auf 14,8 Prozent. Rechnet man auf die knapp 12 Prozent die Stimmen der kleinen, grün-liberalen Volt-Partei, die am Sonntag vor allem in Großstädten kleine Erfolge erzielte, kommt man wieder auf 13 bis 15 Prozent. Das ist seit bald zwei Jahren sehr stabil der Wert der Grünen in allen Umfragen, allen Fehltritten und Mängeln in der Regierungsarbeit zum Trotz. Die Wählerklientel der Grünen scheint ziemlich unerschütterlich. Und die Liberalen? Die FDP kann sich eigentlich ermutigt fühlen. Die Europawahl brachte für sie keinen Absturz, sondern eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau.
Für Parteichef Christian Lindner ist das eine Bestätigung, seinen harten Kurs in der Finanz- und Haushaltspolitik durchzuziehen. Die Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2025 in den kommenden Wochen wird das nicht einfacher machen: Kompromisse werden jetzt wohl noch schwieriger, erst recht, wenn die SPD ihren Kanzler ebenfalls auf einen Konfrontationskurs zu Lindner zwingen sollte.
Wie schön, dass wir all dieses Hin und Her in den kommenden Wochen etwas vergessen können: bei der Europameisterschaft und einem hoffentlich langen Fußball-Sommermärchen!