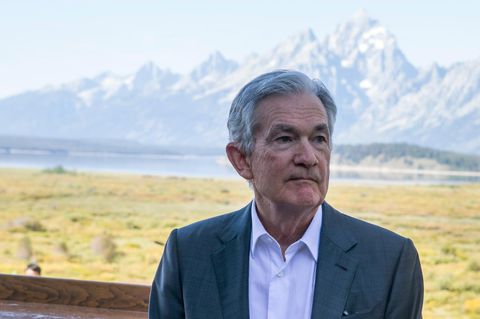Kurz nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Mai Zinserhöhungen angekündigt hatte, reagierten die Märkte. Nicht etwa, wie gewünscht, mit einer geringeren Inflation, sondern mit höheren Risikoaufschlägen (Spreads) auf italienische Staatsanleihen. Anleger spekulierten damals auf eine Rückkehr der Eurokrise, da Italien mehr Geld für seine Neuverschuldung ausgeben muss. Erst eine Notsitzung des EZB-Rats beruhigte die Märkte etwas.
Die Zentralbanker waren also gewarnt, als sie am Donnerstag tatsächlich die Zinsen um 50 Basispunkte anhoben. Marktbeobachter rechneten daher schon im Vorfeld damit, dass die EZB ein flankierendes Kriseninstrument präsentieren wird. Das kam auch in Form des „TPI“, was für Transmission Protection Instrument steht. Doch was hat es damit auf sich? Fünf Fragen und Antworten.
Was ist die Idee hinter TPI?
Gewissermaßen funktioniert die Idee gegenläufig zur Zinserhöhung, die letztlich Liquidität aus dem Markt nimmt. Mit dem TPI will die EZB nämlich gezielte und unbegrenzte Anleihekäufe einzelner hochverschuldeter Länder ermöglichen. Dadurch würde wieder Liquidität in den Markt fließen. Letztlich geht es der EZB um einen Ausgleich: Durch die Anleihenkäufe sinken die Finanzierungskosten von hochverschuldeten Ländern. Damit sinkt die Differenz zu Ländern, die sich aufgrund ihrer guten Wirtschaftslage günstiger finanzieren können.
Wie funktioniert das Instrument?
Die EZB hat erklärt, sie werde vor allem Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen einem und zehn Jahren kaufen. In erster Linie von Ländern „deren Finanzierungsbedingungen sich verschlechtert haben, was durch länderspezifische Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt ist“. Das wäre sehr weitreichend und bedeutet im Klartext: Die EZB kann immer dann eingreifen, wenn die Mitgliedsstaaten bereits unter Druck stehen (Fundamentaldaten) – nicht aber bei Druck, der erst durch Änderungen der Wirtschaftsaussichten entsteht. Das TPI ist nicht nur auf Staatsanleihen beschränkt. Die EZB kann auch Wertpapiere aus dem privaten Sektor kaufen, „wenn dies angemessen ist“.
Wo liegen die Grenzen?
Grundsätzlich gibt es nur wenige Limits für den Umfang der Käufe. Ihr Ausmaß werde „von der Schwere der Risiken abhängen“, so die EZB – und nicht von einem vorher vereinbarten Limit. Laut EZB soll das Kriseninstrument nur zum Einsatz kommen, um „ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entgegenzuwirken, die eine ernsthafte Bedrohung für die Transmission der Geldpolitik im Euro-Raum darstellen“. Was das genau heißt, also wann etwa Marktdynamiken „ungerechtfertigt“ sind, bleibt unklar. EZB-Präsidentin Lagarde sprach aber davon, dass der Rat „nach eigenem Ermessen“ entscheiden werde, wann er die neuen Instrumente einsetzt. Aktuell rechnet die EZB damit, dass sich TPI, bzw. etwaige Anleihekäufe, mit rund 9 Mrd. Euro in der Bilanz niederschlagen werden.
Welche Bedingungen werden an die Käufe geknüpft?
Zunächst kommen alle 19 Länder der Eurozone automatisch für das Instrument infrage – jedenfalls, sofern sie nicht gegen Defizitkriterien der EU verstoßen oder Verfahren anhängig sind wegen wirtschaftlicher Ungleichgewichte. Die EZB will vorab prüfen, ob die Entwicklung der Staatsverschuldung eines Landes nachhaltig ist und ob es eine solide und nachhaltige makroökonomische Politik verfolgt. Das soll vor allem über „Markt- und Transmissionsindikatoren“ geprüft werden – etwa über die Kreditkosten für Regierungen und Unternehmen. Mit der Transmission will die EZB feststellen, ob die Auswirkungen ihrer geldpolitischen Entscheidungen die gewünschte Wirkung.
Fest steht schon jetzt, dass vielen Ökonomen die Bedingungen zu lasch sind – vor allem in Deutschland. So verweist Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer darauf, dass die EU-Kommission bei Defizitsündern häufig beide Augen zugedrückt habe. „Unseres Erachtens hat die EZB damit die Latte für die Anwendung des TPI relativ niedrig angesetzt.“
Auch gehen Analysten davon aus, dass das Verfassungsgericht in Karlsruhe gegen die EZB-Pläne vorgehen wird. Schon in der Vergangenheit hatte das Gericht mehrfach Staatsanleihenkäufe durch die EZB angefochten.
Wird TPI Italien helfen?
Die meisten Analysten machen das von der politischen Entwicklung im Land abhängig. Wenn Rom in eine selbstverschuldete politische Krise gerät – zum Beispiel, wenn eine neue Regierung sich weigert, vereinbarte Strukturreformen durchzuführen, dürfte das neue Instrument keinen großen Nutzen haben. So meint etwa Frederik Ducrozet von Picet Wealth, dass die EZB TPI für Italien nicht aktivieren würde, „wenn italienische Anleiherenditen aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die Wahlergebnisse stetig steigen.“
EZB-Präsidentin Lagarde äußerte sich diesbezüglich zurückhaltend: „Politische Angelegenheiten sind Sache des demokratischen Prozesses eines jeden Mitgliedsstaates.“ Das bedeute auch, dass „Unterschiede in der lokalen Finanzierung legitimerweise auftreten können“.
Viele Ökonomen verweisen darauf, dass es bereits mehrere Instrumente gibt, um verschuldeten Euro-Ländern zu helfen. Etwa das Notfallprogramm PEPP aus der Coronakrise, den europäischen Rettungsfonds ESM und das ältere Anleihekaufprogramm OMT. Unter allen sei allerdings TPI am lukrativsten, meinen Ökonomen. Durch TPI werden reformintensive Programme wie OMT unattraktiver, meint etwa der Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbands (IIF), Robin Brooks. Es sei wichtig, Hilfen an relativ harte Auflagen zu binden und mit einer gewissen Stigmatisierung zu verbinden, da dies hochverschuldete Euro-Länder eher zu Reformen ermutigen würde.