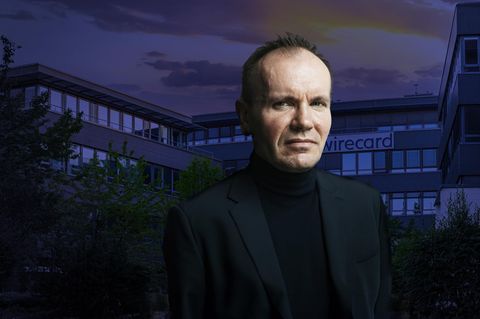Schimpfen können sie. Sogar ganz, ganz böse werden. Das sei doch eine „Kultur des Absahnens und der Ignoranz“ schallt es durch die prallgefüllte Kongresshalle, die „parasitäre Entwicklung eines Managerkapitalismus“, donnert es den Aufsichtsräten und Vorständen auf der Bühne entgegen. Es sei unerträglich, „dass sich Verantwortliche ungestraft die Taschen vollstopfen“. Die Manager seien „mäßig erfolgreich, aber unmäßig raffgierig“.
Das attestierten aufgebrachte Aktionäre dem obersten Führungsgremium von Daimler. Sechs Jahre ist das her. Auf der eigens einberufenen Hauptversammlung wurde endgültig das Ende der „Welt AG“ verkündet, wurde die „Hochzeit im Himmel“ zwischen Daimler und Chrysler nach neun Jahren geschieden. 18 Mrd. Euro hat den Eignern diese Affäre gekostet. Der Kuppler, Jürgen Schrempp, hatte den Chefsessel da schon geräumt, freiwillig betonte er damals und sagte noch zum Abschied: „I'm a happy man.“
Rund 80 Mio. Euro soll Schrempp in seiner zehnjährigen Amtszeit als Daimler-Chef kassiert haben. Offengelegt wurden die Bezüge damals noch nicht. Es könnte durchaus mehr gewesen sein – rechnet man die Aktienoptionen mit ein, die Schrempp beim Deal mit dem US-Autohersteller Chrysler zugesprochen bekam. In den USA waren solche Sonderprämien seit Ende der 90er-Jahre Usus und die Vorstandskollegen in Übersee damit schwer reich geworden.
Spitzenverdiener Winterkorn
Dieses Vergütungssystem hat Daimler übernommen - und in die deutschen Konzernzentralen exportiert. Seither sind die Gehälter der Vorstände börsennotierter Unternehmen exorbitant gestiegen. Jedes Jahr. Mal um 22 Prozent, dann noch mal um acht Prozent, zuletzt um „nur noch“ 2,5 Prozent wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gerade aufrechnete – aber auf verdammt hohem Niveau. Im Durchschnitt haben die 30 Dax-Chefs im vergangenen Jahr 5,2 Mio. Euro eingestrichen. Aber knapp die Hälfte von ihnen kam auf mehr: VW-Chef Martin Winterkorn war mit 14,5 Mio. Euro wieder Spitzenreiter, gefolgt von Schrempp-Nachfolger Dieter Zetsche mit 8,2 Mio. Euro.
Von der Nach-Schrempp-Ära sprechen Personalvermittler heute, die manche Topposition in Konzernen wegen dieser hohen Messlatte und den steigenden Ansprüchen der Manager heute schon nicht mehr adäquat besetzt bekommen. Manche Kandidaten haben innerhalb weniger Jahren im Amt schlicht so viele Millionen gebunkert, dass sie schon zu abschreckend unabhängig wirken, um sich noch mal wirklich richtig in einen neuen Job reinzuhängen oder sich selbst den Stress auf einer neuen Position auch gar nicht mehr antun wollen.
Das Daimler-Chrysler-Desaster galt als Zäsur für die deutsche Wirtschaftsgeschichte. Als Lehre aus einem ungezügelten Managerkapitalismus. Das Gegenteil ist der Fall.
Die heftige Empörung der Aktionäre damals hat bei weitem nicht gereicht, ebenso wenig alle weiteren Disziplinierungsversuche - von der Verschärfung des Aktiengesetzes über Ermahnungen der Regierungskommission für gute Unternehmensführung bis zur Offenlegung der Gehälter und Haftungsansprüchen gegen Aufsichtsräte.
Geisterstunde im Bundestag
Allen regelmäßig wiederkehrenden Abzocker-Debatten zum Trotz steigt die Vergütungsspirale weiter an. Zwar stehen die Aufsichtsräte, zu deren Hauptaufgabe es gehört, Vorstände einzustellen und jährlich deren Vergütung zu justieren, unter öffentlichem Druck, den Exzessen Einhalt zu gebieten. Doch damit sind sie gescheitert. Sie schrauben unentwegt an den unübersichtlich vielen Stellknöpfen für Fixgehalt, Aktienoptionen, sofort fälligen Boni und langfristigen Variablen. Aber dabei haben sie selbst den Überblick über das komplexe System verloren und wissen manchmal gar nicht, mit welchem Geldsegen sich einzelne Vereinbarungen am Ende des Jahres niederschlagen.
Und dieser Entwicklung soll nun durch das Plazet der Aktionäre Einhalt geboten werden? Das glaubt die Regierungskoalition, die ihren Gesetzesantrag zur „Aktienrechtsnovelle 2012“ im Sprint vor der Bundestagswahl letzte Woche durch den Bundestagstag gepeitscht hat. In der zweitägigen Marathonsitzung haben den Antrag nachts um kurz vor halb zwölf rund drei Dutzend anwesende Abgeordnete innerhalb von gut vier Minuten durchgewinkt – als 65. von 143 Tagesordnungspunkten zwischen Beschlüssen zur Modernisierung des Geschmackmustergesetzes (wurde genehmigt), der bundeseinheitlichen Chip- und Registrierungspflicht für Welpen (wurde abgelehnt) und dem Verbot zur Haltung von Delfinen (ebenfalls abgelehnt). Connaisseure können sich das hier in der Liveübertragung anschauen: http://dbtg.tv/fvid/2480605
Wenn der Bundesrat der Aktienrechtsnovelle wie erwartet noch vor der Wahl zustimmt, werden ab dem kommenden Jahr bei jeder Hauptversammlung die Investoren über die Vergütungssysteme der Vorstände bestimmen. Der Aufsichtsrat wird ihnen dann die komplexen Tabellen und Erklärungen vorstellen. Die Angemessenheit der Bezüge können selbst Experten in eingehender Prüfung kaum bewerten. Wie aber sollen Anleger dazu innerhalb weniger Minuten bei der Abstimmung über zahlreiche Tagesordnungspunkte in der Lage sein? Kernige Kritik mag auch in Zukunft wieder von einzelnen Aktionärsvertretern geäußert werden. Aber eine ausreichende Mehrheit für die Ablehnung der Managergehälter wird es wohl in den wenigsten Fällen geben. Von diesem Durchgriffsrecht haben die Anleger auch sonst kaum Gebrauch gemacht – etwa bei der Abberufung von Aufsichtsräten.
Jenny Genger schreibt jeden Donnerstag an dieser Stelle über Unternehmensführung, Netzwerke und Karrierethemen. Ihre letzten Kolumnen Dein #Chef ist unsozial, Ingenieure am Taxistand und Virtuelle Führung
E-Mail: genger.jenny@capital.de
Foto: © Trevor Good