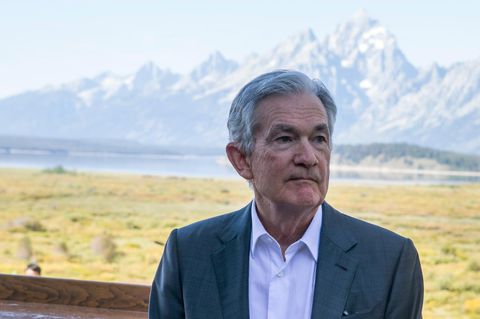Die EZB verschärft ihren Kampf gegen die Abschwächung der Konjunktur. Banken müssen künftig 0,5 statt 0,4 Prozent Zinsen auf Einlagen bei der Zentralbank zahlen. Damit soll die Kreditvergabe angekurbelt werden, wodurch dann auch die Inflationsrate wieder steigen könnte. Die niedrige Teuerung bereitet der EZB Kopfzerbrechen: Die Währungshüter rechnen für das Gesamtjahr mit einer Inflationsrate von 1,2 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als bisher. Hoffnungen auf eine Zinswende erteilte die Zentralbank eine Absage: Die Zinsen sollen solange niedrig bleiben, bis das Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation erreicht ist.
Und damit nicht genug: Die Zentralbank nimmt im November ihr Anleihenaufkaufprogramm wieder auf, dass sie im Dezember 2018 vorerst gestoppt hatte. Ab November sollen nun wieder Monat für Monat Anleihen im Wert von 20 Mrd. Euro gekauft werden.
Beifall von ungewohnter Seite kam aus den USA:
Der Grund für Donald Trumps Beifall ist offensichtlich: Seit Monaten fordert der Präsident von der US-Notenbank Fed Zinssenkungen. Damit soll ein Abschwung in den USA verhindert werden, der Trumps Chancen auf eine zweite Amtszeit schmälern würde.
Lob und Tadel von Ökonomen
Ökonomen urteilen nüchterner: „Die EZB hatte vor dem Hintergrund der schwachen europäischen Wirtschaft und der viel zu niedrigen Inflationserwartungen keine andere Wahl, als die Geldpolitik zu lockern“, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher . Er erwartet „viele weitere Jahre der Nullzinsen“. Deutschland sei mit seiner „exzessiven Ersparnis mit verantwortlich für die niedrigen Zinsen“. Fratzscher fordert die Bundesregierung auf, eine expansivere Finanzpolitik zu verfolgen.
Der Kojunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft Stefan Kooths kritisierte dagegen die EZB-Entscheidungen , weil sie kaum positive Konjunktureffekte haben oder die Investitionstätigkeit anregen würden. Die Nebenwirkungen der EZB-Politik würden dagegen immer problematischer: „Insbesondere erlahmt die politische Reformbereitschaft und der Strukturwandel wird künstlich aufgehalten. Es bleiben Unternehmen am Markt, die nur noch wegen der künstlich niedrigen Zinsen ihre Kapitalkosten verdienen können.“ Kooths spracht sich gegen eine expansivere Fiskalpolitik aus: „Die Rufe nach höherer Staatsverschuldung werden immer lauter, weil man sich der Illusion hingibt, bei Negativzinsen rentiere sich automatisch jede staatliche Ausgabe. Dem ist nicht so, weil auch staatliche Investitionen abgeschrieben werden müssen, um den Kapitalverzehr abzubilden.“
Die EZB korrigierte auch ihre Wachstumsprognose nach unten: Für 2019 rechnet sie nur noch mit einem BIP-Wachstum der Eurozone um 1,1 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als bisher. Das Münchner Ifo-Institut hält in Deutschland eine Rezession mittlerweile für wahrscheinlich: „Das Bruttoinlandsprodukt, das bereits im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft ist, dürfte im dritten Quartal noch einmal um 0,1 Prozent sinken, bevor es am Jahresende wieder leicht zunimmt“, heißt es in der neuen Konjunkturprognose der Wirtschaftsforscher . „Damit dürfte das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr mit 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger ausfallen als in den zurückliegenden Jahren des Aufschwungs.“ Immerhin: Für das kommende Jahr rechnet das Institut wieder mit einer besseren Entwicklung: Um 0,8 Prozent (kalenderbereinigt) soll die Wirtschaftsleistung 2020 wachsen.