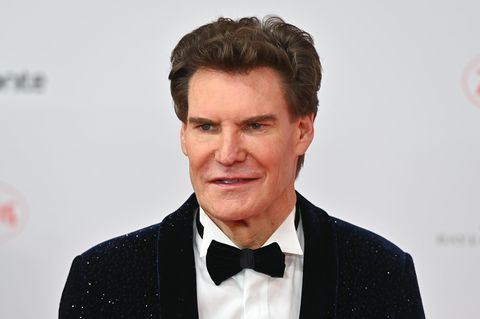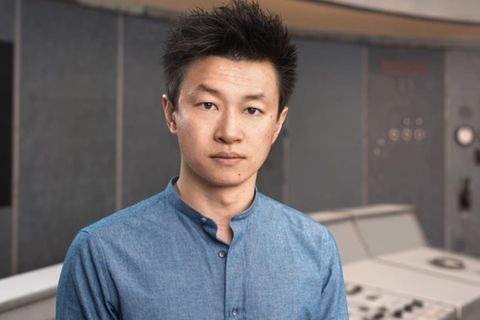Um ans Ende der Tabelle auf der Homepage des Bundestages zu kommen, muss man weit hinunter scrollen. Fein säuberlich ist darin aufgeführt, wie viel Geld jede Partei im Jahr 2025 gespendet bekommen hat – vorausgesetzt die Spende beträgt mindestens 35.000 Euro. Ab dieser Summe gelten die Zuwendungen als Großspenden und müssen sofort veröffentlicht werden. Das Jahr hatte bisher 52 Tage – in der Tabelle sind schon 98 solcher Großspenden eingetragen.
„Das war auf jeden Fall ein Rekordspendenwahlkampf. Vom Spendenvolumen und den Spendenhöhen war es eine absolute Eskalation“, sagt Aurel Eschmann, Experte für Parteispenden beim Verein Lobbycontrol, im Gespräch mit Capital. Seit dem Ampel-Aus bis zum Wochenende der Bundestagswahl gingen etwa 24 Mio. Euro an Großspenden an die Parteien, mehr als in den Wahljahren zuvor. Eine Entwicklung, die Aktivisten und Experten besorgt. Warum steigt das Spendenvolumen – und was sagt das über Politik und Wirtschaft aus?
Helfen hohe Parteispenden im Wahlkampf?
Besonders viel Geld haben die Unionsparteien, die FDP und die AfD bekommen, allein auf deren Parteikonten gingen seit dem Ampel-Aus insgesamt rund 17,5 Mio. Euro ein. Dahinter folgen SPD und Grüne, die rund 3,5 Mio. Euro bekommen haben. Einige der Spenden haben für Schlagzeilen gesorgt: Derzeit ermitteln die österreichischen Behörden laut Medienberichten, ob es sich bei einer 2,35 Mio. Euro schweren Plakatspende für die AfD aus Österreich um eine illegale Strohmannspende handelt.
„Bisher gibt es keine Studien, die zeigen, dass Parteispenden auch wirklich zu Wahlerfolgen führen. Aber eine Partei, die mehr Geld hat, hat natürlich auch mehr Möglichkeiten, Veranstaltungen zu organisieren, Plakate zu drucken oder Werbespots zu produzieren“, sagt Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Co-Direktorin des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung.
Spenden sind explizit erlaubt
Parteien finanzieren sich über verschiedene Wege. Da sind Spenden und Mitgliedsbeiträge sowie staatliche Zuwendungen. Die sind allerdings gedeckelt – um eine gewisse Distanz zum Staat zu wahren. Gleichzeitig sind vor allem Wahlkämpfe teuer, laut einer Umfrage des „RND“ stehen den Parteien mindestens 77 Mio. Euro an Budget zur Verfügung.
Eine Unterstützung per Spende ist explizit erlaubt, allerdings gibt es strenge Regeln: Die Spenden dürfen zum Beispiel laut Parteiengesetz nicht „erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt werden“.
„Die Rechtsprechung ist da auch ein wenig widersprüchlich“, sagt Schönberger. Das Bundesverfassungsgericht habe in der Vergangenheit die Gefahr besonders vermögender Spender erkannt, hält allerdings an der Obergrenze für staatliche Finanzierung fest. „Und auch wenn von den Spenden eine Gefahr für den demokratischen Prozess ausgeht, kommt man nicht ohne Weiteres an die Rechtsprechung ran.“
Deutschland hat im europäischen Vergleich einen schlechten Ruf. Laut einer internationalen Recherche blieb im Jahr 2022 der Ursprung von rund 100 Mio. Euro aus Spenden und Monatsbeiträgen unbekannt. Ein Kritikpunkt: Zwar müssen Großspenden sofort veröffentlicht werden, viele Beträge blieben aber darunter. Sie werden erst in den Rechenschaftsberichten aufgeführt, die bis zu zwei Jahre später veröffentlicht werden. In diesen Berichten müssen allerdings nur Spenden über 10.000 Euro ausgewiesen werden.
Von den meldepflichtigen Spenden stachen einige in ihrer Höhe heraus: Im März 2024 spendete ein Ehepaar in zwei Tranchen mehr als 5 Mio. Euro an das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und auch die AfD profitierte von einigen besonders hohen Beträgen: Neben der Plakatspende bekam sie 1,5 Mio. Euro von dem umstrittenen Arzt Winfried Alexander Stöcker und knapp 1 Mio. Euro von Horst Jan Winter, ehemaliger Aufsichtsrat des Thüringer Büroartikelhändlers Böttcher.
„In diesem Wahlkampf ist sehr auffällig, dass tatsächlich nur vier Personen für rund 10 Mio. Euro der Großspenden verantwortlich sind – und dieses Geld an die Randparteien AfD und BSW geflossen ist“, sagt Andreas Polk. Der Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin beschäftigt sich seit Jahren mit Parteispenden und ist Mitglied bei der Nichtregierungsorganisation Transparency International. „Das ist fast ein Drittel aller Großspenden 2024/2025. So etwas haben wir bisher in Wahlkämpfen noch nicht gesehen.“
Warum Unternehmen an Parteien spenden
Grundsätzlich dominierten zwei Motive die Parteispenden in Deutschland, sagt Polk: die ideologische Unterstützung und der Zugang zur Politik. „Wer Geld spendet, fällt bei den Parteien auf und wird vielleicht in Zukunft gehört, wenn er ein Anliegen hat.“ Dabei ist der Ursprung nicht immer klar – selbst wenn die Spende öffentlich ist. Das Bündnis Sahra Wagenknecht zum Beispiel erhielt im September eine Spende in Höhe von 1,2 Mio. Euro – vom „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.“, dem Verein, der der Partei vorgeschaltet ist. „Verbesserungsbedarf gibt es auf jeden Fall bei der Transparenz“, sagt Polk. „Bei den Spenden von vorgelagerten Vereinen an die Parteien wissen wir schlicht nicht, wer die eigentlichen Spender sind. Und das ist ein echtes Problem, gerade vor dem Hintergrund hybrider Bedrohungen unserer freiheitlichen Demokratien. Sinnvoll wäre außerdem ein parteiunabhängiges Kontrollgremium und eine Kappungsgrenze für die Spendenhöhe.“
Dass die Höhe der Spenden nun steigt, besorgt Aktivisten wie Aurel Eschmann: „Viele Akteure wollen sich in Position bringen und gut stellen mit der neuen Regierung. Und dass jetzt eine besonders unternehmensfreundliche Politik im Raum steht, ist attraktiv für Lobbyisten.“ Als Beispiel dafür könnten die Spenden des Kryptobrokers Bitpanda gelten, der jeweils 500.000 Euro an SPD und FDP und 750.000 Euro an die Unionsparteien überwiesen hat.
Viele Unternehmen haben Geld an mehrere Parteien gespendet. „Die optimistische Antwort ist, dass die Unternehmen die Demokratie stärken wollen“, sagt die Juristin Sophie Schönberger. „Die pessimistische Antwort ist, dass sie politischen Einfluss ausüben wollen. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte, mit Tendenz zu Letzterem.“
Es liege aber auch am Vermögen der Menschen, dass die Spenden immer größer würden: „Die Vermögen in Deutschland entwickeln sich weiter auseinander, gleichzeitig haben wir einen polarisierenden Wahlkampf und eine aufgeheizte gesellschaftliche Stimmung. Das könnte dazu führen, dass Menschen mit viel Geld eher das Gefühl haben, sie müssen an ihre präferierte Partei spenden.“
Allerdings stehe hinter so hohen Spenden die Gefahr, dass die demokratische Gleichheit torpediert werde. „Wenn am Ende die Parteien mit mehr Geld mehr entscheiden können, wird das demokratische Versprechen gebrochen“, sagt Schönberger. Deshalb gebe es Nachbesserungsbedarf, zum Beispiel kürzere Veröffentlichungsfristen für die Rechenschaftsberichte der Parteien. Polk und Eschmann fordern außerdem ein parteiunabhängiges Kontrollgremium, das die Einhaltung der Transparenzregeln prüft – bisher ist dafür die Bundestagspräsidentin zuständig. Überdies brauche es eine Kappungsgrenze, wie viel maximal gespendet werden dürfe.