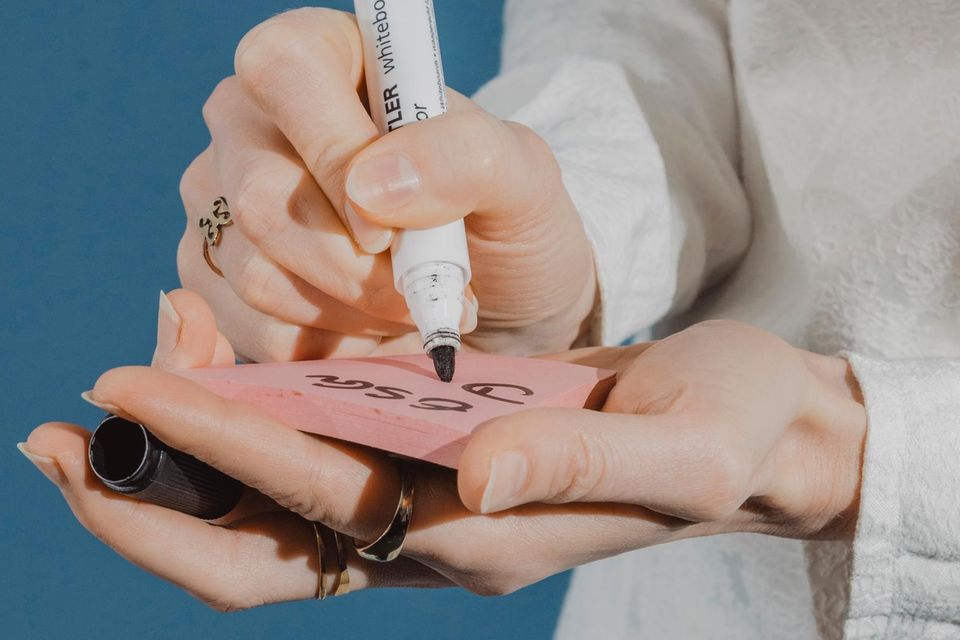Die Veröffentlichung von ChatGPT vor einem Jahr war ein Startschuss. Seitdem hat Künstliche Intelligenz (KI) enorm an öffentlicher Aufmerksamkeit gewonnen, und fast täglich betreten Start-ups den Markt mit innovativen Angeboten. Wenig überraschend ist KI auch für Consultants zu einem wichtigen Thema geworden. Zu den Kernkompetenzen der Berater gehört die Entwicklung von Trends und das Surfen auf deren Wellen. Sie produzieren daher White Paper und präsentieren einschlägige Services auf ihren Websites. Diese Angebote reichen von der Strategieentwicklung über die Umsetzung technischer Lösungen bis hin zur Neugestaltung von Rollen und Aufgaben der Beschäftigten. KI-Labore werden gegründet und Partnerschaften mit Entwicklern von Large-Language-Modellen eingegangen – und alles wird intensiv für Marketing und Vertrieb genutzt.
KI ist für Berater also interessant, allerdings nicht nur, um neue Aufträge zu generieren, sondern auch für den internen Gebrauch. Eine bereits länger verfügbare Lösung ist AskBrian. Diese Software übernimmt verschiedene Aufgaben, die typischerweise Junior-Consultants als Berufseinsteiger erledigen: Recherchen, Formatierungsarbeiten, Übersetzungen, Brainstorming-Beiträge und ähnliches. Eine gewisse Prominenz hat jüngst Lilli erworben, eine proprietäre KI, die McKinsey für seine eigenen Consultants entwickelt hat. In der Nutzung mit ChatGPT und anderen KI-Angeboten vergleichbar, greift sie aber auch auf firmeninterne und kundenspezifische Daten zurück.
Solche Anwendungen erscheinen sinnvoll und kommen nicht unerwartet. Allerdings: Consultants sind zwar typischerweise offen und kommunikativ, wenn es etwa um die Auswirkungen des Einsatzes einer neuen Technologie bei ihren Kunden geht. Sie sind aber traditionell zurückhaltend bei einer Berichterstattung über konkrete Entwicklungen in ihrem eigenen Geschäft. Das gilt auch für den Fall der hausinternen KI-Nutzung.
Effizienzgewinne bei kreativen Aufgaben
Es machten bereits Vermutungen über die positiven Auswirkungen von KI auf die Effizienz in der Beratungsarbeit die Runde. Nun hat ausgerechnet ein Beratungshaus selber dies mit einer Studie bestätigt und konkretisiert. Die Boston Consulting Group (BCG) hat gemeinsam mit Forschern der Universitäten Harvard, MIT, Warwick und Wharton Analysen zu den Effekten von KI-Einsätzen bei ihren eigenen Berufseinsteigern durchgeführt. Dabei standen die Auswirkungen des KI-Einsatzes auf die Arbeitsqualität und -effizienz im Fokus. In einem ausgeklügelten Experiment wurden 758 Consultants in verschiedene Versuchs- und Kontrollgruppen eingeteilt, ihnen realitätsnahe Beratungsaufgaben gestellt – und interessante Ergebnisse erzielt.
Es stellte sich heraus, dass der KI-Einsatz bei eher analytischen Aufgaben (also etwa die Lösung von Problemen, Arbeit mit quantitativen Daten, Auswertung von Interviews) teilweise zu falschen Lösungen führte. Bei eher kreativen Aufgaben (hier ist an Ideenentwicklung, Überzeugungskompetenzen und Schreibfähigkeiten zu denken) konnten hingegen Effizienzgewinne in Höhe von 25 Prozent verzeichnet werden. Die hieraus resultierenden Einsparungen sind eine „KI-Dividende“.
Weniger Consultants in Projekten
Mit diesem quantitativen Puzzlestück können Auswirkungen auf die Honorarsumme einzelner Projekte und auch auf das Gesamtvolumen des Marktes simuliert werden. Als Basis kann etwa die Struktur eines Strategieprojektes, wie es von BCG, aber auch von McKinsey, Bain oder Berger durchgeführt werden könnte, dienen: In einer einfachen Modellierung besteht ein solches Projekt aus einer halben Partnerressource, einem Projektleiter und sechs Consultants. Jede Person arbeitet 20 Tage im Monat und wird mit Tagessätzen von 4.000, 2.000 beziehungsweise 1.000 Euro fakturiert. Für einen solchen Projektmonat werden also 200.000 Euro in Rechnung gestellt.
Durch den Einsatz von KI verändern sich nun das benötigte personelle Mengengerüst und damit auch die nach Aufwand beziehungsweise Arbeitszeit („Time & Material“) abrechenbaren Beratereinsätze. Für eine konservative Simulation werden drei Dinge angenommen: Erstens besteht die Arbeit von Consultants als Berufseinsteiger zu je einem Drittel aus analytischen, kreativen und sonstigen Aufgaben. Zweitens wird der KI-Einsatz nur auf der Ebene der Consultants unterstellt; ein etwaiger Einsatz durch Partner und Projektleiter ist leicht vorstellbar, wird aber zunächst ausgeblendet. Drittens, die KI-Anwendung erfolgt lediglich bei der Gruppe der kreativen Tätigkeiten.
Die Simulation zeigt, dass 8,3 Prozent weniger Consultants benötigt werden. Dies führt zu einer Reduzierung des Gesamthonorarvolumens um 10.000 Euro beziehungsweise fünf Prozent. Bei anderen Ausgangsparametern können die Honorarsenkungen sogar bis zu zehn Prozent betragen. Hierbei könnte man etwa die durchschnittlichen Rahmenvertragskonditionen berücksichtigen, die der Bund mit seinen Beratungsdienstleistern ausgehandelt hat, andere personelle Projektzusammensetzungen oder eine veränderte Mischung der drei Aufgabentypen in Betracht ziehen.
Eine Milliarde Euro im Markt
Nicht nur auf Projektebene, auch für das gesamte Marktvolumen der Branche sind die Auswirkungen einer Simulation erheblich. Laut dem Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) gibt es rund 53.000 Berufseinsteiger. Mit Bachelortitel beträgt ihr durchschnittlicher Tagessatz 1.200 Euro und mit Masterabschluss 1.350 Euro; im einfachen Mittel also 1.275 Euro. Bei 220 Arbeitstagen im Jahr und einer Auslastung von 80 Prozent erwirtschaften die Junior-Consultants im Ausgangsszenario einen Gesamtumsatz von 11,9 Mrd. Euro pro Jahr.
Für die Simulation werden wieder die drei Annahmen von oben (Drittelung der Tätigkeitstypen, nur Berufseinsteiger, nur kreative Aufgaben) herangezogen. Das Marktvolumen schrumpft in diesem Fall um eine ganze Milliarde Euro.
Beide Ergebnisse, die Reduktion des Projekthonorars um fünf bis zehn Prozent sowie das Absinken des Marktvolumens, sind die Folge einer effizienteren Arbeitsweise und der damit einhergehenden geringeren Abrechnung von Beratungszeiten beim Kunden. Vorausgesetzt, die Consultants behalten die KI-Dividende nicht für sich und geben die Effizienzgewinne an ihre Kunden weiter.
Weiterreichen oder selbst einstreichen?
Es bleibt jedoch fraglich, ob dies tatsächlich geschieht. Consultingunternehmen haben mit Blick auf die Auswirkungen des KI-Einsatzes mindestens drei Optionen. Sie können die realisierten Effizienzgewinne vollumfänglich an den Kunden weiterreichen. Sie können allerdings auch darauf hoffen und hinarbeiten, dass der Kunde nichts von der KI-Dividende erfährt beziehungsweise diese im Zweifelsfall negieren und herunterspielen. Dann könnten nämlich 100 Prozent der Effizienzgewinne beratungsintern verbucht werden. Oder sie verwenden einen gewissen Prozentsatz darauf, dem Kunden „Zusatzleistungen“ anzubieten beziehungsweise generös zu gewähren. Ihm werden dann also Dinge schmackhaft gemacht, die bisher „out of scope“ und nicht relevant für das Projekt waren: Der Kunde wusste bisher nicht, dass er die Ergebnisse von bestimmten Arbeitspaketen benötigt – jetzt bekommt er sie trotzdem.
Aus der Kundenperspektive stellt sich die Situation spiegelverkehrt dar. Er kann 100 Prozent der KI-Dividende für sich beanspruchen, alles dem Beratungshaus überlassen oder sich mit Goodies und Zusatzleistungen abspeisen lassen.
Wer wird Dividendengewinner?
Um hier eine Wahl zu haben oder zumindest in fundierte Diskussionen einzusteigen, muss der Kunde sich jedoch mit dem Geschäftsmodell seiner Beratungsdienstleister auseinandersetzen und es verstehen. Leider gibt es wenig Optimismus, dass dies diesmal geschieht, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft. Aber vielleicht bieten die finanziellen Aussichten einen neuen und erfolgreichen Anreiz.
Wenn man jedoch skeptisch bleibt, dann ist die Antwort auf die Ausgangsfrage, wer die eine Milliarde Euro KI-Dividende kassiert, gut prognostizierbar.