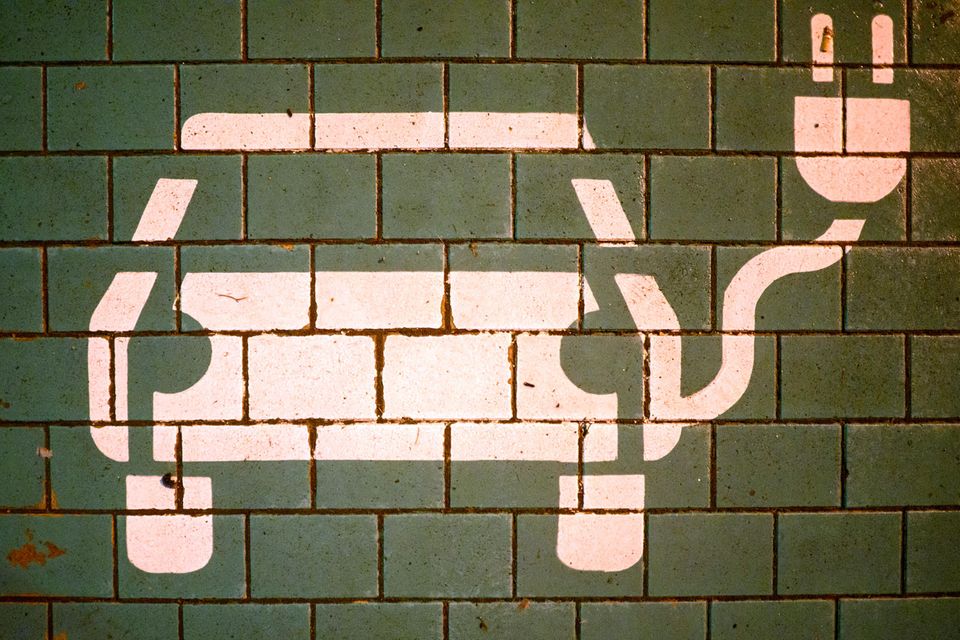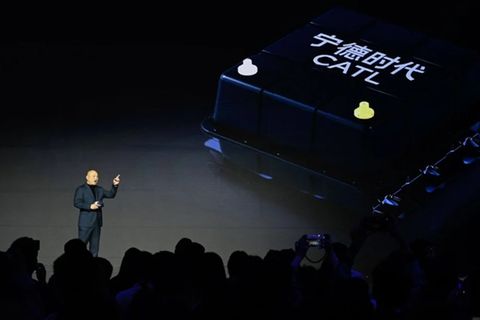Nach spätestens 300 Kilometern müssen die meisten Elektroautos zum Laden halten. Wenn es gut läuft und man eine der rund 14.000 Schnellladesäulen ergattert hat, dauert es etwa 30 Minuten, bis die Batterie wieder voll ist – wenn es schlecht läuft, kann der Tankstopp aber auch mehrere Stunden lang werden. Für Gegner der Elektromobilität ist das ein entscheidendes Argument, gerade bei längeren Strecken, die zum Beispiel für den Warentransport zurückgelegt werden müssen. Wie praktisch wäre es da, einfach während der Fahrt aufladen zu können?
Als Lösung bietet sich das induktive Laden an: Anstatt dass Fahrer an einer Ladesäule halten und das Kabel ins Auto stecken müssen, sollen elektrifizierte Straßen die Batterien kontaktlos beim Fahren laden. So lautet die Vision, und tatsächlich macht die Forschung in diesem Bereich Fortschritte. In näherer Zukunft flächendeckend Straßen zu elektrifizieren, scheint allerdings unrealistisch, besonders mit Blick auf das deutsche Tempo beim Infrastrukturausbau.
Laden mittels Induktion bedeutet: Strom kann über eine kurze Distanz ohne Kontakt übertragen werden. Straße und Auto sind dabei über ein Magnetfeld miteinander verbunden. In den Asphalt eingelassene Induktionsspulen erzeugen durch Wechselstrom ein Magnetfeld. In einer kompatiblen Gegenspule am Fahrzeug wird die Energie aufgefangen und wieder in Strom umgewandelt, der dann die Batterie aufladen kann.
Getestet wird vor allem im ÖPNV
In ersten Projekten wird die Technologie bereits getestet. Braunschweig setzt seit 2015 vier öffentliche Busse ein, die an ausgewählten Haltestellen beim Fahrgastwechsel induktiv geladen werden. Hier passiert das Laden also stationär, was daher zu Verzögerungen im Betriebsablauf führen kann. Balingen in Baden-Württemberg will im Herbst die erste deutsche Stadt werden, in der das drahtlose „dynamische“ Laden in der Praxis getestet wird. Bei der aktuell laufenden Landesgartenschau fährt schon ein Shuttle-Bus, der auch auf einem 400 Meter langen Stück Straße während des Fahrens geladen wird. Für den Einsatz im regulären ÖPNV soll eine zweite Induktionsstrecke von rund 600 Metern ausgebaut werden.
In einem begrenzten Umfeld wie der Landesgartenschau ergebe das induktive Laden Sinn, sagt Ladeinfrastrukturexperte Philipp Seidel von der Unternehmensberatung Arthur D. Little gegenüber Capital. Auch stationäres Laden sei sinnvoll, weil nur ein paar Quadratmeter mit der entsprechenden Ladetechnik ausgestattet werden müssen. „Einen Einsatz im normalen Linienbetrieb halte ich aber nicht für realistisch“, so Seidel. „Es gibt zu viele gute Konkurrenzkonzepte, zum Beispiel das Schnelladen im Depot oder an Endhaltestellen.“ Zudem sollen Busse für Passagiere möglichst nah am Boden gebaut sein. Um die Elemente für das induktive Laden einzubauen, bleibt also wenig Platz.
Das am Karlsruher Projekt beteiligte israelische Unternehmen Electreon hat allerdings schon in mehreren Ländern wie Schweden und Italien funktionierende Ladestrecken für Busse, Autos und Lkw gebaut. Nach eigenen Angaben habe man die Batteriegrößen dadurch massiv reduzieren können. Damit argumentieren auch andere Befürworter. Wenn Batterien unterwegs geladen werden können, würden die Fahrzeuge leichter, effizienter und könnten so in zweifacher Hinsicht ihre Reichweite verlängern. Vor allem für die Logistikbranche wäre das ein Meilenstein.
Ein Kilometer kostet 8 Mio. Euro
Noch ist die Technologie aber nicht ausgereift. Denn ein Kilometer elektrifizierte Straße reicht nicht aus, um die Batterie voll aufzuladen. Ein Problem des induktiven Ladens ist, dass durch die entstehende Wärme bei der kontaktlosen Übertragung Energie verloren geht. Die Straße erkennt zwar, wo sich das Auto befindet und überträgt nur dort den Strom. Die Wirkungsgrade unterscheiden sich aber momentan noch deutlich, beim Projekt in Karlsruhe liegt er beispielsweise bei 85 Prozent. Ein Forschungsprojekt an der Uni Stuttgart erreichte Anfang des Jahres über 90 Prozent, aber nur stationär. Für einen praktischen Einsatz müsste diese Übertragung auch bei höheren Geschwindigkeiten gewährleistet sein. Effizient sei ein Wirkungsgrad von um die 95 Prozent, dort liege momentan auch der Wirkungsgrad beim Laden mit Stecker, erklärt Alexander Kühl vom Lehrstuhl für Produktionssystematik an der Uni Erlangen-Nürnberg.
Er ist mit seinem Fachbereich an einem Forschungsprojekt in Nordbayern beteiligt: Dort soll bis 2025 eine ein Kilometer lange Teststrecke auf einer Autobahn entstehen. Was erfolgversprechend klingt, ist im Moment vor allem teuer. Die geplanten Investitionen betragen rund 8 Mio. Euro. Zu den Kosten für die spätere Installation in der Praxis gehen die Prognosen derzeit noch deutlich auseinander. „Einige Schätzungen beginnen bei 1 Mio. US-Dollar pro Meile, andere pendeln sich im Bereich von 2 bis 3 Mio. Euro pro Kilometer ein“, erklärt Kühl. „Wir arbeiten aber gerade an verschiedenen Technologien, um die Systeme besser zu integrieren.“ So könnten zum Beispiel Kosten gespart werden, indem die Systeme während einer ohnehin fälligen Überarbeitung eingebaut werden oder mittels partieller Eingriffe in die Straße, zum Beispiel durch Ausfräsen eines möglichst schmalen Straßenteils.
2030 soll es eine Million Ladepunkte geben
Nach Ansicht von Forschern der Technische Hochschule Chalmers in Schweden müssten in Europa zwar nur Hauptverkehrsadern elektrifiziert werden. Doch der Bau neuer Straßen gestaltet sich in Deutschland ebenso schleppend wie der flächendeckende Ausbau von Ladesäulen. 2030 soll es eine Million Ladepunkte geben, zu Beginn diesen Jahres waren es laut Bundesnetzagentur erst 85.073, davon 14.378 Schnellladepunkte. Mittlerweile kommen dem Ranking des Verbandes der Automobilindustrie zufolge 23 Pkw auf eine Ladesäule. Bürokratie und unklare Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen für die über 50.000 Kilometer Autobahn und Bundesstraßen in Deutschland sind dabei ein großes Problem.
Seidel hält den flächendeckenden Ausbau von induktivem Laden entlang der Straßen daher nicht für realistisch. „Der Vorteil gegenüber moderner und erwartungsgemäß zukünftig noch besserer konventioneller Schnellladetechnik mit Stecker ist zu gering, um die immensen Investitionen zu rechtfertigen“, sagt er. Vorstellbar sei der Einsatz der Technologie entweder stationär oder in Zukunft im Zusammenhang mit autonomen Fahren, um so einen pausenlosen Betrieb im Schwerlastverkehr zu ermöglichen. Momentan müssten dort aber ohnehin Pausen gemacht werden, die man zum Laden nutzen kann.
Kühl von der Uni Erlangen-Nürnberg spricht von einem „klassischen Henne-Ei-Problem“: „Selbst nach erfolgreicher Projektumsetzung sind noch große Anstrengungen und auch etwas Mut notwendig, um die Technologie flächendeckend einzusetzen.“ Er bleibe aber optimistisch: „Sobald das Laden auf vielen Straßen möglich ist, wird auch die Nachfrage massiv steigen.“