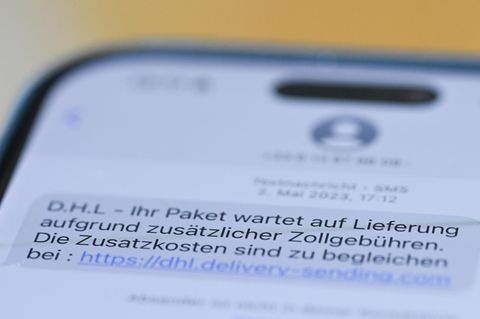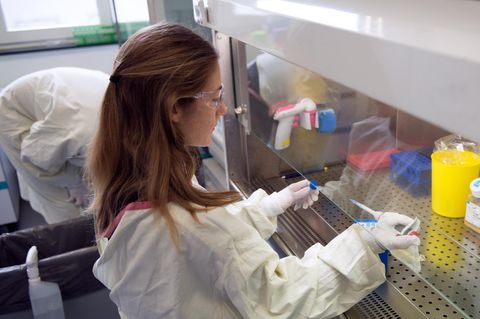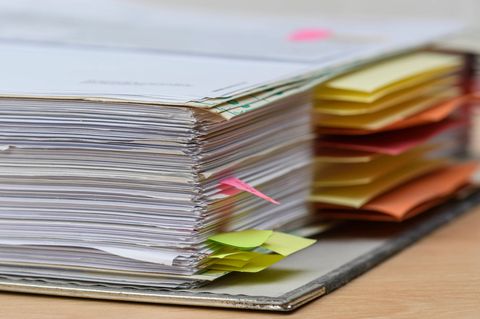Wer elektrisch fährt, spart Emissionen und hilft der Umwelt. Was aber, wenn der Besitzer eines E-Autos seine Einsparung mit einem CO₂-Zertifikat weiterverkauft? Etwa an die Mineralölwirtschaft, die dadurch für den CO₂-Ausstoß ihrer Kraftstoffe zahlt. Ist das dann ein moderner Ablasshandel auf Kosten der Umwelt? Wird das E-Auto damit doch wieder zur „Dreckschleuder“, weil dafür Shell und Co. an anderer Stelle CO₂ in die Luft pusten?
Die Frage stellt sich, seit das Bundes-Immissionsschutzgesetz genau das ermöglicht. 2018 wurde mit dem Gesetz für Betreiber von Ladestationen und für elektrisch Fahrende – egal ob Auto oder Roller – die Treibhausgasminderungs-Prämie eingeführt, kurz: THG-Prämie. Pro E-Auto hat das Umweltbundesamt pauschal etwa eine Tonne CO₂-Äquivalent als Einsparung festgelegt. E-Autobesitzer können nun per Zertifikat diese Tonne als Verschmutzungsrecht über Zwischenhändler weiterverkaufen, für bis zu 420 Euro jährlich. Abnehmer sind etwa Mineralölkonzerne. Die nämlich sind verpflichtet, ihre CO₂-Emissionen jedes Jahr zu reduzieren: Ihre Werte aus dem Jahr 2010 müssen sie bis 2030 um 25 Prozent unterbieten. Um die Quote zu erfüllen, haben die Konzerne bisher vor allem dem herkömmlichen Sprit Biokraftstoff beigemischt. Nun aber greifen sie vermehrt auf die Zertifikate aus der E-Mobilität zurück, die seit Anfang 2022 boomen – 170.000 Anträge gab es im ersten Halbjahr.
Ein nützliches Instrument? Beim Öko-Institut sehen sie diesen CO₂-Handel durchaus als „sinnvoll“ an. Ohne die THG-Prämie wären die Abbauziele für Shell und Co. gar nicht erreichbar, sagt Peter Kasten, Vizeleiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität. Dass derzeit immer mehr Mineralölkonzerne Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge bauen, sei ein Erfolg des Instruments.
Tobias Austrup hingegen, Mobilitätsexperte bei Greenpeace, fehlt der nötige Transformationsdruck auf die Branche. Es handele sich eher um klassisches Freikaufen. Dennoch rät er Autofahrern, die Prämie mitzunehmen: „Die Mineralölkonzerne kommen so oder so an ihre Quote.“ Denn für den Fall, dass zu wenige Privatnutzer mitziehen, kann der Staat die Zertifikate selbst versteigern. So oder so: Letztlich finanziert die Mineralölbranche mit dem Kauf ihre eigene Abschaffung.
Testurteil: Befriedigend