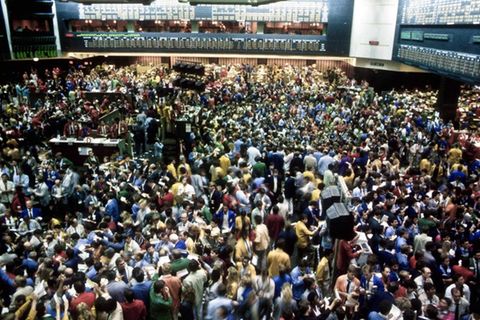Sven von Loh ist geschäftsführender Gesellschafter der Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft SvL Entrepreneurial Partners. Als Business Angel investiert er zudem in den Sparten Life Science, Diagnostik und Medizin-Technik.
Findige Startups krempeln mit disruptiven Geschäftsmodellen und bahnbrechenden Innovationen eine Industrie nach der anderen um. Gewöhnlich geht es dabei um den digitalen Bereich, also um Digitalisierung im weitesten Sinne. Gerne wird dabei vergessen, dass auch in anderen Bereichen an Innovationen mit disruptivem Potential gearbeitet wird. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich Bio- und Foodtech. Wissenschaftler arbeiten in ihren Laboren an aus Stammzellen gezüchteten Herzklappen, an auf Nährlösung wachsender Ersatzhaut und auch in Petrischalen gewachsene Ohrmuscheln haben wir alle im Fernsehen schon mal gesehen.
Soweit so gut. Machen wir jetzt mal einen Schnitt und wenden uns einem anderen Problem zu: Der Versorgung der Menschheit mit gesunder und umweltfreundlich erzeugter Nahrung. Ein Thema, das viele Menschen bewegt. Wir sehen das sowohl am Bio-Boom als auch daran, dass sich immer mehr Menschen einer veganen Ernährungsweise zuwenden.
Wir wollen beides: Fleisch essen und umweltbewusst sein
Fragt man Veganer, warum sie auf Fleisch und andere tierische Produkte verzichten, werden neben gesundheitlichen Aspekten vor allem ethische Gründe aufgeführt. Also Tierschutz und die Tatsache, dass die Fleischerzeugung eine nahezu endlose Ressourcen-Verschwendung mit sich bringt. So ist laut einer Studie der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) die Viehhaltung für 18 Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Gleichzeitig scheint belegt zu sein, dass die Erzeugung von Nahrung auf Basis tierischer Produkte extrem inneffektiv ist. So heißt es, dass nur zehn Prozent der Proteine und Kalorien, die von den Nutztieren aufgenommen werden, letztendlich beim Menschen als Nahrung ankommen.
Das Problem: Die Mehrheit der Menschen möchte auf Fleisch und tierische Produkte wie Milch und Eier nicht verzichten. Aber gleichzeitig haben alle ein schlechtes Gewissen. Spätestens beim Thema Massentierhaltung kommen die meisten Fleischesser ins Grübeln.
Mit anderen Worten, wir wollen eigentlich beides: Fleisch essen, aber ohne dass Tiere und Umwelt leiden müssen. Sie ahnen es, damit wären wir wieder zurück beim Anfang dieses Beitrages: Wenn man Herzklappen, Hautgewebe und Ohrmuscheln in der Petrischale züchten kann, warum nicht auch Steaks, Schnitzel und Burger? Genau hier setzen diverse Startups in den USA, aber auch in Europa und Israel an.
Die Geschichte des Kunstfleisches
Tatsächlich ist "In-Vitro-Fleisch“ nicht brandneu. So züchtete der Wissenschaftler Mark Post an der Universität Maastricht schon 2013 den ersten Burger aus Muskelgewebe. Freilich gab es dabei drei Probleme: Erstens sah es nicht gerade appetitlich aus, in etwa so wie eine "rosafarbene Nudel". Zweitens war der Geschmack nicht wirklich überzeugend und Drittens: Der Preis. Angeblich kostete der In-Vitro-Burger rund 325.000 US-Dollar.
Ein Preis, der den Financier freilich kaum ins Schwitzen gebracht haben dürfte, denn es handelte sich um den Google-Gründer Sergey Brin. Was die Kosten pro Burger betrifft, sind die Maastrichter mittlerweile übrigens deutlich weiter. Er liegt jetzt bei nur noch rund 11 US-Dollar. Immerhin ist man schon so weit, unter dem Namen Mosa Meat eine eigene Ausgründung zu starten, um das Verfahren kommerziell auszuschlachten.
Wohl von den Erfolgen in Holland inspiriert, fasste in den USA der Wissenschaftler Dr. Paul Mozdziak den Entschluss das gleiche mit Putenbrustfleisch zu versuchen. Unterstützt und gefördert von New Harvest – einem auf "zelluläre Landwirtschaft“ spezialisierten Institut – lässt er aus einem Körnchen Putenbrustgewebe nahezu unbegrenzt neues Gewebe wachsen.
Memphis Meat, Super Meat, Clara Foods und Perfect Day Foods erorbern den Markt
Mittlerweile ist die Idee vom In-Vitro-Fleisch, oder Clean Meat, wie es die Amerikaner nennen, auch in der virilen Start-up-Szene von San Francisco angekommen. Dort versuchen von Wagniskapitalgebern finanzierte Gründer die Verfahren so weit zu entwickeln, dass sie damit auf den Markt gehen können. Beispielsweise Memphis Meat mit dem Motto „Announcing the world’s first chicken produced without the Animal“ auf der Startseite.
In die gleiche Kerbe schlägt das israelische Startup Super Meat. Auch hier soll Geflügelfleisch ohne Tiere gezüchtet werden. Für die Finanzierung wählte man die Crowd-Financing-Plattform Indiegogo. Das Ziel waren 100.000 US-Dollar. Geworden sind es doppelt so viel. Jetzt peilt man die halbe Million an. Wann und ob tatsächlich ein Produkt daraus wird, steht freilich in den Sternen.
Aber warum beim Fleisch Halt machen? Das dachten sich wohl auch die Gründer von Clara Foods und machten sich daran, „künstliche Eier“, genauer gesagt Eiklar, sprich Eiweiß zu züchten. Seit 2014 sammelten sie rund 3,5 Mio US-Dollar Wagniskapital ein. Richtig, im Vergleich zur Digitalbranche ist das recht wenig. Im Biotech/Nahrungsmittelbereich hingegen ist es sehr viel. Zum Vergleich: Das New Harvest Institute fördert das In-Vitro-Putenfleisch-Projekt mit lediglich 118.000 US-Dollar für zwei Jahre.
Ein anderes Startup in der Bay Area von San Francisco hat sich wiederum der Milch zugewandt. Perfect Day Foods hat es sich zum Ziel gesetzt, Milchprodukte und Milch ohne den Umweg über die Kuh zu erzeugen. Das dabei verwendete Verfahren ahmt die Milcherzeugung im Organismus der Kuh nach und erinnert ein wenig an den Brauprozess beim Bier. Tatsächlich spricht auch Perfect Day Foods davon, Milch zu „brauen“. Zumindest auf der Homepage steht „Animal-free Milk – Brewed with Love in San Francisco, California."
In Deutschland fehlen dem Foodtech-Sektor die Investoren
Eines ist all diesen Bio-Tech-Start-ups gemein: Sie wollen Fleisch und tierische Nahrungsmittel ohne die hässlichen Seiten der Tier- und Fleischwirtschaft produzieren. Also Fleisch-, Milch- und Ei-Genuss ohne Tierquälerei, ohne Ressourcenverschwendung und ohne negative Auswirkungen auf die dritte Welt, die unter dem exzessiven Futtermittelanbau leiden muss.
Und noch eine Gemeinsamkeit haben die obengenannten Beispiele: Keines von ihnen kommt aus Deutschland. Das liegt allerdings keineswegs an dem seit ein paar Jahren zu beobachtenden Trend eines rückläufigen Fleischkonsums hierzulande. Schließlich verzehren die Deutschen pro Kopf durchschnittlich immer noch rund 60 Kilo pro Jahr. Vielmehr leidet der Foodtech-Sektor unter den gleichen Umständen wie der restliche deutsche Biotechnologiemarkt: Es fehlt an Kapital um die jungen Unternehmen anzuschieben. Die Venture Capital-Investoren finanzieren lieber Digital-Startups – zuletzt verstärkt im Bereich Finanztechnologien.
Dieses Investitionsverhalten birgt jedoch Risiken. Zum Beispiel für die Fondsbetreiber selbst. Die wachsende Weltbevölkerung wird die konventionelle Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion auf Sicht an ihre Grenzen bringen. Wer dann mit neuen Technologien und Lösungen, die weniger Ressourcen benötigen – beispielsweise verbraucht die Herstellung eines Kilos Rindfleisch rund 15.000 Liter Wasser –, bereits am Markt ist, hat einen klaren Vorteil gegenüber Mitbewerbern, die zu dem Zeitpunkt erst in die Forschung und Entwicklung einsteigen. Gleichzeitig ist man dann ein attraktives Übernahmeziel für Konzerne. Welche Bedeutung diese der Ernährung von bald acht Milliarden Menschen beimessen, veranschaulicht die geplante Übernahme von Monsanto durch den deutschen Bayer-Konzern für voraussichtlich 66 Mrd. Euro.
Deutschland als Verlierer auf dem Foodtech-Markt?
Ein weiteres Risiko der Investitionsschüchternheit: Zwar macht die Landwirtschaft weniger als ein Prozent des bundesdeutschen Bruttoinlandsprodukts aus, doch läuft man Gefahr, beim Thema Foodtech international abgehängt zu werden. Wieder einmal. Nachdem bereits Internetservices wie Suchmaschinen und soziale Netzwerke oder die Biotechnologie von Unternehmen aus den USA dominiert werden. Da scheint es fast schon paradox, dass in der Diskussion um das Freihandelsabkommen TTIP in Deutschland wieder und wieder der Aspekt der Landwirtschaft und die Sorge um eine Sicherstellung der Nahrungsmittelqualität angeführt wurde.
Auch wenn (international) die ersten Ergebnisse durchaus vielversprechend erscheinen, noch hapert es an den Kosten und wohl bisweilen auch am Geschmack. Klappt es aber mit dem künstlich gezüchteten Fleisch, dann ist das Potential für die Disruption der gesamten Nahrungsmittelindustrie riesig. Auch vor dem Hintergrund, dass diese Fleischprodukte in der Herstellung ohne Antibiotika und Wachstumshormone auskommen.