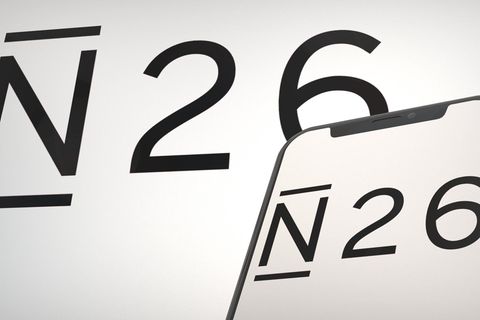Für Privatanleger hält die deutsche Finanzaufsicht Contracts for Difference (CFD) nicht gerade für eine besonders geeignetes Finanzanlage. Bei CFD handelt es sich um hoch spekulative Derivate, bei denen mit großen Hebeln und entsprechenden Verlustrisiken auf Währungen, Aktien oder Rohstoffe gewettet wird. In nicht seltenen Fällen übersteigen bei einzelnen Geschäften die Verluste auch den Kapitaleinsatz.
Seit 2017 beschränkt die Bafin daher den Vertrieb dieser Finanzprodukte, die vor allem von Daytradern gehandelt werden – die auf Tagesbasis spekulieren und dafür viel Zeit vor dem Rechner investieren. Hintergrund dieser sogenannten Produktintervention der Behörde: Die deutschen Aufseher haben – ebenso wie ihre Kollegen der EU-Wertpapieraufsicht ESMA – bei Differenzkontrakten „erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz“. Im Juli 2019 erließ die Bafin eine unbefristete Allgemeinverfügung, die für CFD eine Begrenzung von Hebeln und Verlusten vorschreibt. CFD-Anbieter dürfen Anleger auch nicht mit Startguthaben oder Rabatten ködern und müssen sie im Vertrieb vor einem möglichen Totalverlust warnen. Als die Bafin im Sommer 2020 überprüfte, ob sich die Broker an die strikten Beschränkungen halten, stellte sie bei der Hälfte der CFD-Anbieter Verstöße fest.
Doch die Bedenken und Interventionen der Behörde haben einige ihrer Mitarbeiter nicht davon abgehalten, privat schwunghaft mit diesen besonders spekulativen Papieren zu wetten. Von Anfang 2018 bis Ende September 2020 haben Bafin-Beschäftigte 298 Geschäfte mit CFD aufgeführt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor geht, die Capital ausgewertet hat. Insgesamt handelten neun Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen mit den Papieren.
Mehr als die Hälfte aller Geschäfte (174) entfielen demnach auf das Jahr 2019. Besonders aktiv in dieser Zeit: ein Mitarbeiter der Wertpapieraufsicht, der in manchen Monaten nahezu täglich mit CFD auf Basis von Währungen handelte und 2019 auf 137 Geschäfte kam. In den ersten neun Monaten 2020 wickelten andere Bafin-Mitarbeiter dann 97 CFD-Geschäfte ab, die sich vor allem auf Aktien als Basiswerte bezogen. Um welche konkreten Aktien es sich handelte, wird in der aktuellen Antwort der Bundesregierung nicht ausgewiesen. Nach früheren Recherchen von Capital sind allerdings zehn CFD-Geschäfte eines Mitarbeiters aus der Versicherungsaufsicht aus dem Mai 2020 bekannt, die sich auf die Aktie des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard bezogen.
Auf Anfrage wollte die Bafin die CFD-Geschäfte ihrer Beschäftigten nicht kommentieren. Tatsächlich waren die Transaktionen nach den internen Regeln der Aufsicht zulässig. Für Differenzkontrakte bestehen lediglich die gleichen Insiderhandelsverbote und Meldepflichten wie für andere private Finanzgeschäfte. Allerdings lassen sich CFD nicht wie Aktien und andere Zertifikate über eine Wertpapierkennnummer (ISIN) identifizieren, was eine Überprüfung des konkreten Geschäfts erschwert. Laut Bundesregierung müssen die Bafin-Mitarbeiter bei CFD den jeweiligen Emittenten des Papiers und „weitere Identifikationsmerkmale“ im internen Meldesystem der Behörde angeben. Im „Einzelfall“ sei eine „weitergehende Prüfung“ erfolgt, heißt es in ihrer Antwort.
Infolge des Wirecard-Skandals und des Bekanntwerdens von einer großen Zahl von Mitarbeitergeschäften mit Wirecard-Papieren vor allem in den Monaten vor der Insolvenz hatte Behördenchef Felix Hufeld bereits im Herbst allgemeine Beschränkungen erlassen. Seit Oktober dürfen die Aufseher keine Papiere mehr von Finanzunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in der EU handeln – darunter von solchen, die von der Bafin beaufsichtigt werden. Laut der Antwort auf die FDP-Anfrage gilt diese Regelung auch für CFD, wenn der „Hauptzweck der Anlage“ in Anleihen, Aktien oder Derivaten von Finanzunternehmen besteht. Im Rahmen des Gesetzes für Stärkung der Finanzmarktintegrität, das die Bundesregierung als Reaktion auf den Wirecard-Skandal beschlossen hat, sind zudem weiter gehende Handelsbeschränkungen für Bafin-Mitarbeiter vorgesehen.
Scharfe Kritik an den Finanzwetten äußerte die parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Fraktion, Bettina Stark-Watzinger. Es sei „wie eine Realsatire“, wenn einige Mitarbeiter der Finanzaufsicht ausgedehnte CFD-Geschäfte betreiben, sagte die Finanzexpertin. „Wer nimmt eine Aufsicht ernst, die den CFD-Handel als hoch riskant einstuft, obwohl deren Mitarbeiter selbst damit spekulieren?“ Der Staat müsse sich selbst an das halten, was er von anderen verlange, fügte Stark-Watzinger hinzu. Daher seien die eingeführten Handelsverbote zwar ein wichtiger Schritt. Allerdings fehle es in der Bafin an der Einsicht, dass Fehler gemacht worden seien. „Hufeld sollte sich für die Fehler entschuldigen und nicht weiter die Mär erzählen, dass die Bafin alles richtig gemacht habe.“
Auffällige Wirecard-Deals
Neue Erkenntnisse gibt es auch zu auffälligen Wirecard-Geschäften von Beschäftigten der Finanzaufsicht, zu denen nach der Pleite des Konzerns im Juni eine interne Sonderprüfung veranlasst wurde. In den Jahren 2018 bis 2020 hatten 85 der rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde etwa 500 Mal mit Wirecard gehandelt, einige von ihnen auch mit hoch riskanten Zertifikaten. Besonders aktiv waren dabei zwei Beschäftigte aus der Abteilung WA2, die unter anderem für Marktaufsicht und die Überwachung von Leerverkäufen zuständig ist – was bei Wirecard relevante Themen waren, auch wenn die Wirecard AG selbst nicht unter der Aufsicht der Bafin stand.
Allein in den letzten drei Monaten vor der Pleite meldeten diese beiden Beschäftigten zusammen knapp 40 Geschäfte mit Bezug zu Wirecard, also mit Aktien und Derivaten. Wie nun aus einer neuen Aufstellung des Bundesfinanzministeriums hervor geht, kauften die beiden Mitarbeiter Ende April und Anfang Mai unter anderem auch zwei Zertifikate, die auf fallende Kurse setzten. Wenige Tage später verkauften sie die Papiere wieder. In zwei weiteren Fällen handelten die Kollegen ebenfalls mit den gleichen Wirecard-Derivaten – auch in diesen Fällen an den gleichen Tagen oder nur kurz versetzt.
In seiner Antwort betonte das Ministerium von Olaf Scholz (SPD), dem die Bafin unterstellt ist, dass die betreffenden Beschäftigten aus dem für „Marktanalyse“ zuständigen Referat bei ihren Geschäften jedoch „keine Kenntnisse von Insiderinformationen“ gehabt hätten. Ein entsprechendes Votum der Vorgesetzten liege vor. Aus der Tatsache, dass die Kollegen Geschäfte mit den gleichen Finanzprodukten parallel abgewickelt haben, ergibt sich aber, dass sie sich bei ihren privaten Investments abgestimmt haben müssen. Dabei war Wirecard kein Einzelfall: Auch bei Wertpapieren anderer Unternehmen agierten die beiden wie ein kleiner „Trading Club“ – was zu der Frage führt: Tauschten sich auch andere Bafin-Leute in der Kantine oder beim Feierabendbier über Finanzanlagen aus?
Wie eine Auflistung sämtlicher Geschäfte belegt, agierte vor allem einer der beiden Mitarbeiter aus der Abteilung WA2 fast wie ein Profihändler. Für den Zeitraum von Januar 2019 bis September 2020 meldete er nicht weniger als 618 Geschäfte mit Aktien und Derivaten. Dabei ging es in erster Linie um Papiere deutscher Unternehmen – darunter Konzerne wie Bayer, Lufthansa, Daimler und Thyssenkrupp, aber auch zahlreiche Nebenwerte wie Evotec, Lang & Schwarz, Brenntag und Osram. Vereinzelt tauchen auch ausländische Werte wie Lukoil, Nokia und Shop Apotheke Europe aus den Niederlanden auf. Mehr als zwei Drittel der Geschäfte dieser Person (421) entfielen auf das Jahr 2020, in dem die Corona-Krise auch die Aktienmärkte durchschüttelte. Allein im besonders turbulenten März 2020 wickelte sie nahezu 100 Käufe und Verkäufe ab.
Dagegen finden sich unter den Papieren, die dieser Mitarbeiter handelte, praktisch keine Finanzwerte – und kaum ein Unternehmen, bei dem die Bafin in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle spielte. Ausnahmen: Wirecard – und der Leasingspezialist Grenke. Im September 2020 meldete er acht Geschäfte mit Discountzertifikaten auf den Kurs des im MDax notierten Leasingspezialisten Grenke, nachdem Leerverkäufer, die auch schon bei Wirecard eine Rolle spielten, schwere Betrugsvorwürfe gegen das Unternehmen erhoben hatten. Später veranlasste die Bafin bei Grenke eine Sonderprüfung.
Aber auch der Kollege oder die Kollegin aus dem gleichen Referat handelte sehr aktiv, wenn auch deutlich weniger und mit einem etwas niedrigeren Risikoprofil. In diesem Fall waren es von Januar 2019 bis September 2020 immerhin 141 Geschäfte. Naheliegend, aber nicht bestätigt ist, dass auch die CFD-Geschäfte aus der Abteilung WA2 auf das Konto eines dieser Beamten gingen: insgesamt 138 Trades im Jahr 2019.
Geschäfte zu spät gemeldet
Aus der Aufstellung des Finanzministeriums geht zudem hervor, dass die beiden Mitarbeiter aus der Marktaufsicht bei einigen Unternehmen nicht nur Aktien handelten, sondern auch Derivate. So wetteten sie im Frühjahr 2020 etwa mit entsprechenden Zertifikaten auf sinkende Kurse bei den Airlines Lufthansa und Air France-KLM sowie dem Touristikkonzern TUI, die allesamt besonders heftig von der Corona-Krise getroffen wurden. Dennoch stechen die Geschäfte bei Wirecard hervor, weil sie besonders spekulativ waren: Bei keinem anderen Unternehmen handelten die Beamten phasenweise mit so hoher Frequenz und so vielen unterschiedlichen Derivaten wie bei diesem.
Dabei ist auffällig, dass die WA2-Beschäftigten praktisch nur mit Wirecard handelten, wenn bei dem Konzern Feuer unter dem Dach war. Das gilt insbesondere für den aktiveren der beiden: Der Regierungsantwort zufolge handelte er auch im Januar 2019 drei verschiedene Zertifikate auf Wirecard – allesamt etliche Tage vor Veröffentlichungen der „Financial Times“ über Unregelmäßigkeiten bei dem Zahlungskonzern in Singapur, die Mitte Februar auch zum Leerverkaufsverbot der Bafin führten. In den ersten Februartagen, an denen es infolge der „FT“-Berichte zu starken Kursausschlägen kam, wickelte der gleiche Mitarbeiter dann mehrere Käufe und Verkäufe von Wirecard-Aktien ab. Die nächsten Geschäfte mit Wirecard-Bezug folgten erst ab Februar 2020 – und dann in besonders hohem Maße nach der Veröffentlichung des KPMG-Sonderberichts Ende April.
Allerdings versichert das Finanzministerium, der oder die betreffende Beschäftigte habe innerhalb der Bafin „keinen Zugang zu Insiderinformationen“ zu den relevanten Geschäften gehabt. Die Person sei in einem Referat eingesetzt, in dem Insiderinformationen „in der Regel erst nach deren Veröffentlichung“ bekannt seien. Zudem sei jedes Geschäft von Fachvorgesetzten überprüft worden, betont das Ministerium.
Ins Auge fällt jedoch, dass einige der Geschäfte von Anfang 2019 erst mit massiver Verspätung angezeigt wurden – obwohl die Bafin ihren Beschäftigten vorschreibt, ihre privaten Finanzgeschäfte „unverzüglich“ in einem internen IT-System anzugeben und der betreffende Beamte diese Vorgabe normalerweise sehr ernst nahm. So zeigte er seine Wirecard-Derivategeschäfte aus dem Januar 2019 erst im Februar nach der „FT“-Enthüllung an – einen Teil sogar erst im August. Ebenfalls zu spät meldete er drei Geschäfte mit Wirecard-Aktien vom 7. Februar – und dies auch nicht in einem Rutsch, sondern kleckerweise bis Ende April. Zwei weitere Aktiengeschäfte vom 8. Februar verschwieg die Person sogar bis Oktober 2019. Und auch 2020 ließ sie sich bei manchen Geschäften mit Wirecard-Bezug Zeit, bevor sie sie offen legte: Mehrere Trades mit Aktien und Derivaten kurz vor der Insolvenz im Juni zeigte sie erst im August an.
Interessant daran: Anders als in anderen Fällen, bei denen im Laufe der Bafin-internen Sonderprüfung verspätete Meldungen ans Tageslicht kamen, hatten diese Meldeverstöße bislang offenbar keine Folgen – obwohl sie heikle Zeitpunkte im Fall Wirecard betreffen. Vor Weihnachten wurde zwar bekannt, dass ein Beschäftigter aus der Versicherungsaufsicht die Bafin verlassen musste, weil er mehr als 40 Geschäfte aus „nicht nachvollziehbaren Gründen“ nicht rechtzeitig angezeigt hatte. Darunter waren auch mehrere Geschäfte mit Put-Optionen auf Wirecard im Mai 2020. Auch in drei weiteren Fällen informierte der für Mitarbeitergeschäfte zuständige Beauftragte der Behörde die Personalabteilung über Verstöße von Mitarbeitern. Hier ging es jeweils nur um ein oder zwei Geschäfte, die nicht rechtzeitig gemeldet wurden. Dagegen zählt zu den drei Personen, bei denen die Personalabteilung noch über Konsequenzen entscheiden soll, nach Bafin-Angaben niemand aus der besonders aktiven Abteilung WA2.
Daytrading an heiklem Börsentag
Aber auch bei Wirecard-Geschäften von Beschäftigten aus anderen Bafin-Abteilungen gibt es Auffälligkeiten, die im Zuge der Sonderprüfung aufgefallen sein müssten. Besonders interessant: die Transaktionen vom 18. Juni 2020. Dabei handelte es sich um jenen turbulenten Börsentag, an dem öffentlich bekannt wurde, dass die Wirtschaftsprüfer von EY ihr Testat für den Jahresabschluss 2019 des Paymentkonzerns vorerst nicht erteilen werden, weil sich Saldenbestätigungen für milliardenschwere Treuhandkonten auf den Philippinen als offenkundig gefälscht erwiesen hatten.
Laut einer Antwort des Finanzministeriums auf eine frühere Kleine Anfrage der FDP-Fraktion wickelte eine Reihe von Bafin-Beschäftigten allein an diesem Tag 35 Geschäfte mit Wirecard-Aktien und Derivaten ab. Aus den Daten geht hervor, dass dabei auch drei Mitarbeiter im Stile von Daytradern Derivate kauften und verkauften. So handelte der bereits erwähnte Beschäftigte aus der Versicherungsaufsicht, der inzwischen die Bafin verlassen musste, an diesem Tag fünf Mal mit Put-Optionen, die von fallenden Kursen profitieren. Zwei Mal kaufte er die Zertifikate, in drei Tranchen verkaufte er die gleichen Papiere wieder. Alle Deals zeigte er erst im September an.
Spekulationsgeschäfte wie diese und die Vielzahl an einzelnen Trades lassen die Annahme zu, dass auch einige Bafin-Mitarbeiter die Kursentwicklung am 18. Juni den Tag über eng verfolgten, um zum richtigen Zeitpunkt handeln zu können. Zwar verbieten die Bestimmungen dem Bafin-Personal, während der Arbeitszeit private Transaktionen auszuführen. Diese seien nur „in Pausenzeiten erlaubt“, erklärte eine Sprecherin. Allerdings räumte die Behörde ein, dass eine „systematische Überprüfung“, ob sich die Beschäftigten an diese Vorgabe halten, mit dem internen IT-Meldesystem „nicht möglich“ sei. Die Mitarbeiter müssen zwar angeben, an welchem Tag sie den Auftrag erteilt haben – nicht aber die Uhrzeit, ebenso wenig die die Handelsvolumina. Den Verzicht auf weitergehende Angaben begründet die Behörde mit dem Datenschutz.
„Es ist ein Fehler, dass die Bafin nicht mehr Daten zu den privaten Börsengeschäften ihrer Mitarbeiter erfasst“, sagte dagegen die Finanzpolitikerin Stark-Watzinger. Es falle auf, dass an ereignisreichen Börsentagen viele spekulative Geschäfte ausgeführt worden seien. „Wer CFD-Geschäfte tätigt, mit gehebelten Derivaten handelt und Daytrading betreibt, muss laufend die Kurse verfolgen“, sagte sie. „Wenn an diesen Tagen nicht außergewöhnlich viele Pausen eingelegt wurden, muss der Handel in die Arbeitszeit gefallen sein. Das wiederum hätte allerdings den Vorgesetzten auffallen müssen.“
Darüber hinaus kritisierte die FDP-Finanzexpertin, dass die fehlenden Angaben auch eine Bewertung erschwerten, ob ein Geschäft an einem bestimmten Tag auffällig ist. „Ohne die Uhrzeit des Handels zu kennen, können wir nicht ausschließen, dass hierfür Insiderwissen genutzt wurde“, sagte sie. So wären etwa Aktienverkäufe nach der Veröffentlichung einer negativen Ad-hoc-Meldung eines Konzerns nicht weiter ungewöhnlich. Bei Aktienverkäufen oder bestimmten Derivategeschäften am selben Tag vor einer negativen Ad-hoc-Meldung und mit hohem Einsatz wäre es möglicherweise anders.
Im Meldesystem der Bafin lässt sich dieser Unterschied aber derzeit nicht nachvollziehen, weil dort nur das Datum der Order erfasst wird. „Für eine lückenlose Aufklärung ist es wichtig zu wissen, zu welcher Uhrzeit und in welcher Höhe diese Geschäfte getätigt worden sind“, sagte Stark-Watzinger. Die Bafin wollte sich zu der allgemeinen Frage, ob sie die Aussagekraft der Angaben für ausreichend betrachte, unter Verweis auf die laufende Sonderauswertung zu den Wirecard-Deals nicht äußern.
Bankaufseher spekulierte mit Short-Zertifikat
Dass es sich dabei keineswegs um einen theoretischen Fall handelt, zeigen Geschäfte, die ein Mitarbeiter der Bankenaufsicht am 18. Juni ausgeführt hat – und zwar ausgerechnet aus der Abteilung BA3, in der die Aufsicht über die Wirecard Bank angesiedelt war. Laut Auflistung des Finanzministeriums kaufte dieser Beschäftigte am Tag des Offenbarungseids von EY ein Zertifikat, das mit einem vierfachen Hebel auf einen fallenden Wirecard-Kurs setzt. Im Laufe des Tages verkaufte er es wieder.
Aus der Meldung im Bafin-System lässt sich nicht erkennen, ob der Kauf am 18. Juni erfolgte, bevor Wirecard um 10.43 Uhr per Ad-hoc-Meldung mitteilte, dass EY nicht testieren werde. Nach der Ad-hoc stürzte der Kurs der Aktie, die mit 99 Euro in den Handelstag gegangen war, auf zeitweise fast 30 Euro ab. Der Schlusskurs an diesem Tag lag bei knapp 40 Euro. Unklar ist auch, ob der Mitarbeiter eine hohe Summe für die Wette investierte – beides mögliche Indizien für Insiderwissen. Über den Verdacht, dass die Belege zu den Treuhandkonten gefälscht sein könnten, hat EY die Finanzaufsicht bereits am 16. Juni informiert. Nicht überraschend wäre, wenn diese Information auch in der für die Wirecard Bank zuständigen Abteilung BA3 angekommen sein sollte – schließlich handelte es sich bei der Wirecard AG um den Mutterkonzern der Bank.
Auf Anfrage von Capital wollte sich eine Bafin-Sprecherin auch zu diesem Fall nicht äußern und verwies auf die Sonderprüfung. Wie die Bundesregierung allerdings in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage schreibt, können Mitarbeiter im Rahmen der Sonderauswertung auch zu „auffälligen Geschäften“ befragt sowie um „Vorlage weiterer Unterlagen“ gebeten werden – „sofern die Prüfung zur Aufklärung des Sachverhalts dies erforderlich macht“. Derzeit würden Nachweise zu einzelnen Geschäften geprüft, heißt es weiter. Diese könnten auch Depotauszüge enthalten. Im Rahmen der Sonderauswertung werde auch die relevante „dienstliche Kommunikation“ der betroffenen Mitarbeiter überprüft.
Nach Angaben des Finanzministeriums greift die Bafin bei der Sonderuntersuchung auch auf externe Expertise von Wirtschaftsprüfern und einer Rechtsanwaltskanzlei zurück. Gleich mehrfach betont es in der Antwort, bei den Geschäften der Bafin-Mitarbeiter solle „bereits der bloße Anschein eines Interessenkonflikts vermieden werden“.
Behördenchef Hufeld dagegen hat sein Urteil über die Investments seiner Mitarbeiter bereits Anfang November gefällt – noch bevor einer von ihnen wegen Meldeverstößen rausflog: Alle Geschäfte seien rechtmäßig abgelaufen und genehmigt worden, beteuerte Hufeld. Im Vergleich zum allgemeinen Handelsvolumen bei der Wirecard-Aktie im deutschen Markt seien seine Leute sogar „zurückhaltend“ gewesen.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden