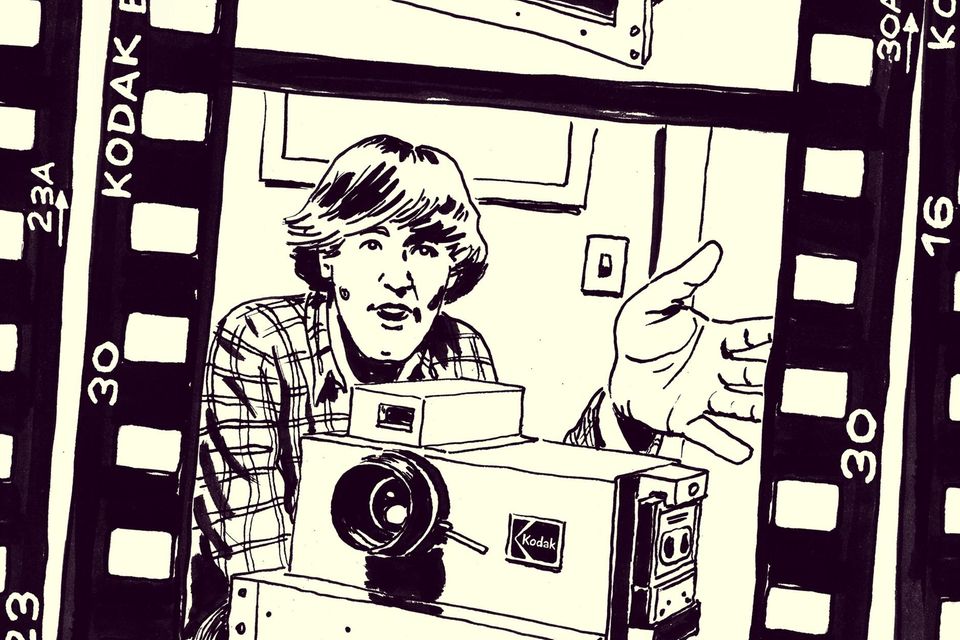Wenige Tage vor dem Jahreswechsel und pünktlich zum letzten Capital-Newsletter in diesem Jahr hat das Institut für Demoskopie in Allensbach mal wieder vermessen, wie es den Deutschen gerade geht. Nicht nur politisch, sondern auch emotional. Das machen die Meinungsforscher vom Bodensee in unregelmäßigen Abständen seit vielen Jahrzehnten, meist dann, wenn es Not tut – die Sorgen und Ängste also mal wieder besonders groß sein dürften. Und sie tun dies oft mit den immer gleichen Fragen, um langfristige Vergleiche anstellen zu können.
In diesem Jahr sind die Ergebnisse besonders interessant, weil sie etwas zeigen, das wahrscheinlich viele von uns so schon das ganze Jahr über gefühlt haben. Trotz aller Krisen, Umbrüche und Zuspitzungen geht es den meisten Menschen in Deutschland privat ziemlich gut. So stimmte fast ein Drittel der Befragten, genau 28 Prozent, der Aussage zu, jemand habe wohl Recht, wenn er oder sie den Befragten als glücklichen Menschen bezeichne, nur 13 Prozent widersprachen dieser Aussage (alle Details der Umfrage und warum diese Frage seit 1954 so kompliziert gestellt wird, können Sie übrigens hier bei den Kollegen der „FAZ“ nachlesen). Die Befunde liegen damit ziemlich stabil auf dem Niveau der letzten Jahrzehnte.
Gleichwohl nehmen die Sorgen massiv zu, wenn es um die Lage des Landes oder gar der ganzen Welt geht: So sagen derzeit – das Gegenteil wäre zugegebenermaßen auch eine Überraschung gewesen – lediglich 16 Prozent, sie lebten „in glücklichen Zeiten“, 72 Prozent hingegen bezeichnen die Weltlage aktuell als „ziemlich schwierig“. Das ist die größte Kluft seit den Nach-Wende-Jahren Anfang der 1990er Jahre. Aber auch diese Werte passen gut zu dem verbreiteten Gefühl, dass sich die Welt seit 2020 neu sortiert und lang vergessene Konflikte neu hervorbrechen.
Debatten: Stillstand statt Fortschritt
Das Private und das Öffentliche fallen derzeit weit auseinander. Oft sprechen wir von der gespaltenen Gesellschaft und über die großen und kleinen Konflikte, in denen sich Politiker, wir Journalisten und viele ganz normale Bürgerinnen und Bürger die Köpfe heiß diskutieren. So viele Debatten werden hitzig oder sie ermüden, weil ohne Fortschritt die immer gleichen Argumente ausgetauscht werden, und mitunter entgleisen sie komplett. Aber die mindestens ebenso relevante Spaltung der Gesellschaft ist die emotionale: Wieso sind so viele Menschen verunsichert und besorgt, wenn es ihnen privat doch ziemlich gut geht?
Ich habe in diesem Jahr viele beeindruckende Menschen getroffen – erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen, die ihre Geschäfte neu ausrichten; junge Gründerinnen und Gründer, die Neues wagen; und aufstrebende Wissenschaftler, die an Künstlicher Intelligenz forschen oder an neuen Krebstherapien; oder Soldatinnen und Soldaten, die in diesem Jahr in der Slowakei ihren Dienst leisteten und dort mit dem Raketensystem Patriot den Nato-Luftraum sicherten. Jedes Mal war ich beeindruckt von der Leidenschaft, der Professionalität und dem Engagement, mit dem diese Menschen ihrem Job und ihrer Berufung nachgehen.
Über die Monate verfestigten sich bei mir zwei Eindrücke: In diesem Land tut sich so viel mehr als wir oft zwischen all den düsteren Nachrichten aus aller Welt wahrnehmen. Dies soll nicht naiv klingen, die Herausforderungen sind groß. Aber nicht nur die sind groß, sondern auch unsere Fähigkeiten, diese Herausforderungen zu meistern. Und meistens wachsen unsere Fähigkeiten sogar mit unseren Problemen.
Ja, oft kommt der Fortschritt langsam, vieles steckt fest zwischen Ämtern und Aktendeckeln. Und trotzdem machen die meisten weiter, sie geben nicht auf. Oder, wie es der Ökonom Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank in einem Capital-Gespräch in diesem Jahr ausdrückte: Wir starren bei allen Sorgen vor Krisen und Umbrüchen zu sehr auf die großen Konzerne. „Der deutsche Mittelstand funktioniert wie eine riesige Suchmaschine, die fortlaufend nach Innovation und Fortschritt fahndet“, sagte Schmieding – für ihn ein Beispiel für die unverwüstliche Stärke der deutschen Wirtschaft.
Gefangen in Ritualen
Der andere Eindruck, der nach den Treffen und Gesprächen oft hängen blieb, war die große Sehnsucht nach mehr Ehrlichkeit: Auch wenn die Wahrheiten unbequem sind, so sehen viele Menschen die offensichtlichen Probleme und Herausforderungen, aber sie spüren, dass die Debatten darum in Deutschland oft nicht ehrlich geführt werden. Offensichtlich ist das Problem bei der Diskussion über Deutschlands künftige Energieversorgung: Nur Wind und Sonne werden den Industriestandort Deutschland nicht versorgen. Aber auch die Kernenergie, die Union und FDP jetzt wieder ins Spiel bringen, ist keine realistische Option mehr. Das Ende der letzten Meiler war ein Fehler, einen Weg zurück gibt es aber nicht mehr. Daher bleibt für die berühmte Grundlast auf absehbare Zeit gar nichts anderes in Deutschland als Kohle und Gas. Trotzdem plant die Politik einen schnellen Ausstieg aus der Kohle und tut wenig für den Bau von neuen Gaskraftwerken als Ersatz für die Kohle.
Diese fruchtlose Art, Politik zu betreiben, ermüdet und erweckt den Eindruck, die Spitzen von Regierung und Opposition werden den offensichtlichen Problemen des Landes nicht gerecht. Der Auftritt von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, wie sie in der vergangenen Woche ihre angebliche Lösung für den Bundeshaushalt 2024 vorstellten, ohne eine übergeordnete Idee, ohne wirklichen Plan und ohne verlässliche Zahlen, lieferte ein bezeichnendes Bild der deutschen Politik: Müde, abgekämpft und gefangen in Machtkalkülen und Ritualen. Die drei Spitzen der Regierungskoalition führen nicht, sie hängen der Realität hoffnungslos hinterher – das Land und die Wählerinnen und Wähler sind schon so viel weiter. Ein Gutteil der Sorgen, die die Demoskopen von Allensbach messen, geht zurück auf genau diese ritualisierte Oberflächlichkeit und mangelnde Aufrichtigkeit.
Mehr Ehrlichkeit, mehr Klarheit – das könnte ein guter Vorsatz für 2024 sein. Für die Politik, und für uns Journalisten. Anlässe dazu wird es im kommenden Jahr mehr als genug geben. Ehrlichkeit und Klarheit heißt aber auch: Die Rede verlangt nicht nur zuzuhören, sondern muss auch die Gegenrede aushalten. Mehr Ehrlichkeit und mehr Klarheit wird es nur geben, wenn wir Widerspruch zulassen. Das kann anstrengend sein – aber nur so wird das Vertrauen wieder wachsen, dass wir neben dem guten Leben im Privaten auch die großen Herausforderungen in der Welt meistern werden.