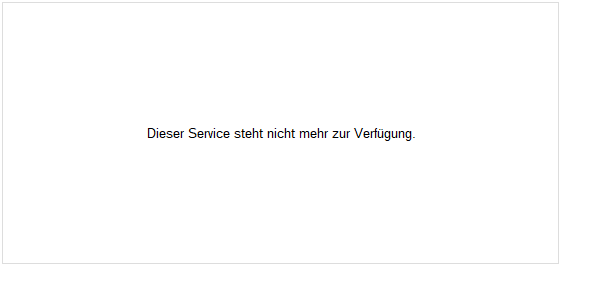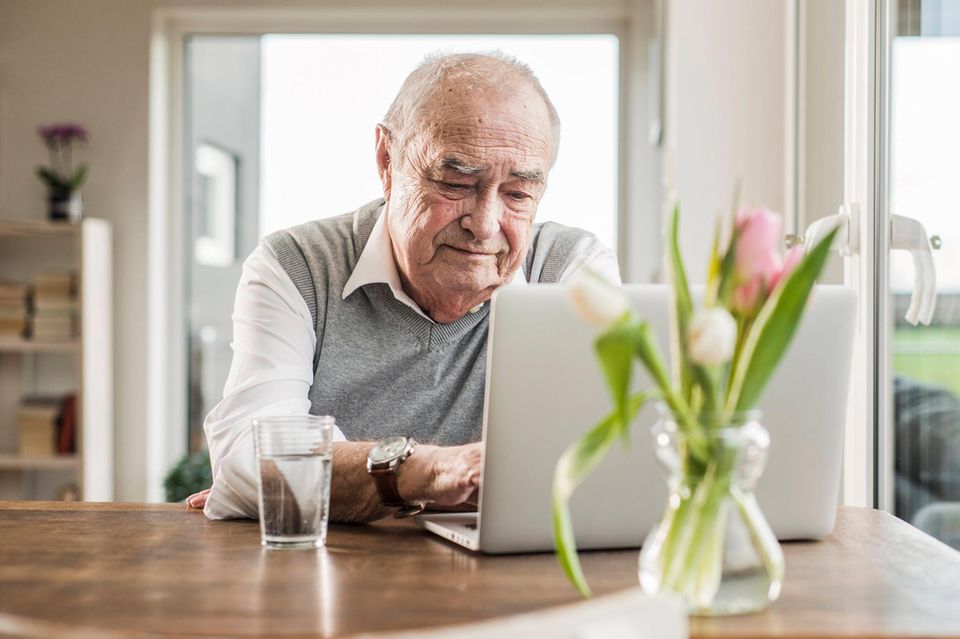Christian Kirchner ist Frankfurt-Korrespondent von Capital. Er schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Geldanlagethemen. Hier können Sie ihm auf Twitter folgen
Es gibt derzeit eine Menge Menschen, die heilfroh sind, dass es die Deutsche Bank gibt. Zum Beispiel die Führungsriege der meisten anderen europäischen Banken. Denn weil alle auf die Kurse der Aktien und Anleihen der Deutsche Bank starren, fällt nur wenigen auf, dass die Deutsche Bank zwar ein unbestritten großes Institut ist. Die aufgekommenen Zweifel an der Kapitalaustattung und künftigen Ertragskraft unterscheiden sich aber nur in Nuancen, wenn man die Deutsche Bank etwa mit anderen Großbanken wie der Commerzbank oder schweizerischen Credit Suisse vergleicht: Alle drei Institute haben in den letzten sechs Monaten knapp die Hälfte ihres Börsenwerts eingebüßt. Alle drei Institute kosten derzeit nicht einmal halb so viel wie der Buchwert je Aktie, und die Anleihen – allen voran Nachrangpapiere – aller drei Institute sind auf Talfahrt, wenngleich die der Deutschen Bank etwas steiler. Legte man den Chart der drei Institute übereinander – nur Vollprofis könnten sie voneinander unterscheiden.
Und: Die Deutsche Bank ist auch nur eines von Dutzenden Instituten, die so genannte „Coco-Bonds“ ausgegeben haben. Dabei handelt es sich um Anleihen, die bei ausbleibenden Gewinnen keine Zinsen zahlen und beim Unterschreiten gewisser Solvenzkennziffern in Aktien umgewandelt werden. 99 Prozent des ausstehenden Volumens dieser „Coco-Bonds“ entfallen auf andere Banken als Emittenten, darunter ein Drittel auf chinesische – und dennoch steht die Bank merkwürdigerweise da, als sei sie der einzige Emittent dieser Instrumente. Dass sie in Krisen zu Brandbeschleunigern für ihre Halter werden, ist keineswegs neu. Es ist sogar Sinn der Sache: dass eben Gläubiger und nicht der Staat beziehungsweise der Steuerzahler in Krisen für Banken bluten. Wen das als Investor nun überrascht, dem ist auch nicht zu helfen.
Natürlich gibt es einen gewichtigen Unterschied zwischen der Deutschen Bank und anderen: die schiere Größe der Bilanz. Sie ist bei der Deutschen Bank mit 1,7 Billionen Euro annähernd doppelt so groß wie die der Credit Suisse und rund dreimal so groß wie die der Commerzbank.
Was zur zentralen Frage führt: Muss man sich um die Deutsche Bank Sorgen machen? Darauf gibt es zwei Antworten. Die eine ist eher psychologischer Natur, die andere beruht auf harten Zahlen.
letztlich beruht alles auf Vertrauen
Zur psychologischen Seite: Ja, man muss sich sorgen. Bei einer derart monströsen Bilanzsumme in Höhe des Sechsfachen des Haushalts dieses Landes beruht letztlich alles auf Vertrauen. Dem Vertrauen darauf, dass in dieser Bilanz beherrschbare Risiken schlummern, dem Vertrauen, dass sich die Bank dauerhaft refinanzieren kann und weder Sparer noch sonstige Kunden türmen.
Dabei spielt es auch nur eine überschaubare Rolle, ob das Eigenkapital ein paar Milliarden mehr oder weniger ist, sie sind letztlich – ebenso wie der verbliebene Börsenwert – nur Rundungsfehler, wie ein Analyst einst spöttisch anmerkte. Auch die Regulierungsschritte seit der Finanzkrise haben daran wenig geändert. Dass es Bekenntnisse vom Bankchef persönlich ebenso wie dem Finanzminister gibt, die Bank sei grundsolide aufgestellt, man sei unbesorgt – geschenkt.
Die Erfahrung zeigt, dass solche Bekenntnisse bis zur allerletzten Sekunde abgegeben werden, ehe es kracht. Solche Vertrauensbekunden zeigen gleichwohl, wie ernst es um eine Bank steht. Darauf nahm auch der bekannte Bestsellerautor Nassim Nicholas Taleb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter spöttisch Bezug, als er am Dienstag twitterte: „Ich habe mir keine Sorgen über die Deutsche Bank gemacht bis zu dem Moment, in dem der deutsche Finanzminister Schäuble erklärt hat, man müsse sich keine Sorgen machen.“
Was zur zweiten Frage führt: Was sagen die harten Zahlen? Denn zu dem, was gerade passiert – dass es die Deutsche Bank ein kleines bisschen härter trifft - haben mitnichten nur eine Branchenentwicklung oder frühere Vorstandschefs beigetragen. Nein, die Bank bekommt für ihre Umstrukturierung von den Akteuren am Kapitalmarkt ganz offenbar nicht die Zeit, die sie braucht.
Die Deutsche Bank steckt in einer Transmissionsphase, in die sie mit einer dünnen Kapitaldecke gesegelt ist, und das sehenden Auges durch den neuen Chef John Cryan - und in einer Phase, in der zumindest ein gewisser Gewinnbeitrag der Investmentbanker enorm wichtig wäre, um die Kapitalausstattung stabil zu halten und die Kosten der Restrukturierung zu finanzieren. Die Investmentbanker kosten nun mal, und seit der Regulierung der Bankbranche vor allem hohe Fixgehälter. Sie sind aber paradoxerweise genau jener Unternehmensteil, in dem die Erträge am volatilsten sind. Und man muss nicht studiert haben für die Erkenntnis, dass die Einbrüche an fast allen Märkten seit Jahresbeginn Gift sind für das Geschäft mit Neuemissionen, Fusionen und Akquisitionen.
Cryans Strategie
Doch warum sind Investoren bei der Deutschen Bank besorgter als bei anderen Instituten? Hier kommt die Strategie von John Cryan ins Spiel. Der Brite übernahm die Bank im Sommer 2015 und spielte das übliche Spiel, den Zustand der Bank zu bejammern, Kürzungen zu verkünden und möglichst viele Belastungen gleich noch in das Jahr 2015 zu packen. Heraus kam ein Jahresverlust von 6,8 Mrd. Euro für 2015 und der Plan, die Bank binnen zwei bis drei Jahren zu sanieren.
Was Cryan nicht tat: noch einmal die Aktionäre anzupumpen über eine Kapitalerhöhung. Dabei waren schon zu Cryans Antritt die unterdurchschnittliche Kernkapitalquote und der überdurchschnittliche Verschuldungsgrad Grund zur Sorge. Kurz: Cryan pokerte hoch, denn vermutlich – auch wenn dies Spekulation ist – hätten es Aktionäre verstanden, wenn er die Gelegenheit genutzt hätte, ihnen noch einmal einige Milliarden abzuknöpfen für einen finalen Befreiungsschlag.
Dass der Aktienkurs der Bank aber erst ab Vorlage der Bilanz 2015 Ende Januar nochmals richtig ins Rutschen geriet und auch die Anleihen deutlich fallen, ist kein Zufall. Denn das Risiko, dass die Bank ihre Aktionäre eben doch noch mal um Kapital bitten muss, ist deutlich gestiegen – zumindest dann, wenn Cryan nicht noch einen Plan B in der Tasche hat, der eine Fusion oder Filetierung des Instituts vorsieht oder er schlicht enorm tief stapelt.
Um das nachvollziehen zu können, lohnt ein Blick zurück auf die Ära Ackermann und Jain: Die Deutsche Bank hat nicht nur ein Problem mit den Rechtsrisiken, die sie eine zweistellige Milliardensumme gekostet haben. Sie hat seit Jahren ein latentes Kosten- und Ertragsproblem. Die Analysten von Goldman Sachs haben einmal hochgerechnet, dass das Institut selbst unter Herausrechnung der außerordentlichen Kosten für Rechtsrisiken und Restrukturierungen und auf Basis der Kapitalziele für 2018 in den letzten 15 Jahren eine Eigenkapitalrendite von im Schnitt rund vier Prozent verdient hätte. Branchenüblich ist mehr als das doppelte. Ex-Chef Anshu Jain und noch Co-Chef Jürgen Fitschen sind auch daran gescheitert, die Kosten nie in den Griff bekommen, die Bilanzsumme nie nachhaltig gesenkt zu haben.
Und Cryan? Hat mitnichten alles in die Bilanz 2015 gepackt. Auf der Analystenkonferenz zur Vorlage der Zahlen für 2015 gab er nicht nur bekannt, dass die Kosten für die Restrukturierung noch einmal eine Milliarde in 2016 betragen werden. Nein, er kündigte – zur Überraschung vieler – auch noch an, dass die Kosten der Bank 2016 insgesamt genauso hoch wie 2015 sein werden, nämlich rund 26,5 Mrd. Euro. Ein Deja-Vu für viele Kritiker, die darauf gesetzt hatten, dass Cryan endlich einmal ernst macht und richtig spart.
Umstrukturierung braucht Zeit
Nun muss man auch nicht Bilanzexperte sein für die Erkenntnis, dass eine Bank in ernste Schwierigkeiten gerät, die mit einer für Analysten grenzwertigen Kapitalausstattung – der Verschuldungsgrad liegt über, und die Kernkapitalquote unter dem Branchenschnitt in Europa - in das neue Jahr gegangen ist und nun plant, die Kosten beizubehalten, obwohl ihr die Erlöse wegbrechen. Genau der Vorgang ist aber ausweislich der Zahlen des vierten Quartals bereits in Gang und dürfte sich durch den katastrophalen Jahresstart an den Börsen auch nicht umgekehrt haben.
Seit Cryans Amtsantritt hat sich der Aktienkurs auf nunmehr 14 Euro halbiert. Das heißt: Muss die Bank nun doch noch mal Geld bei Aktionären tanken, gelänge dies nur mit einer immensen Verwässerung bestehender Aktionäre und hohen Abschlägen, zumal potenzielle Ankeraktionäre wie etwa Staatsfonds inzwischen andere Sorgen haben, als angeschlagenen Banken der Eurozone zur Seite zu springen. Natürlich könnte die Bank auf die außergewöhnliche Marktentwicklung verweisen. Aber damit schlösse sich der Kreis: Die Deutsche-Bank-Aktie ist auch deshalb auf einem 25-Jahres-Tief, weil seit Jahren immer irgend etwas ist.
Nun muss man dem neuen Chef Cryan gegenüber fair bleiben: Vielleicht kommt er ohne Kapitalerhöhung davon, vielleicht beruhigt sich die Lage. Eine derart komplexe Organisation wie eine Bank zu restruktrieren, kostet Zeit, es ist eher eine Frage von Jahren denn Quartalen. Das Dumme ist nur: Ob er sie bekommt, hängt nicht vom Aufsichtsrat ab oder der internen Umsetzung der Restrukturierung. Bei einer Bank stimmen Aktionäre, Gläubiger, Mitarbeiter und Kunden immer mit den Füßen ab.