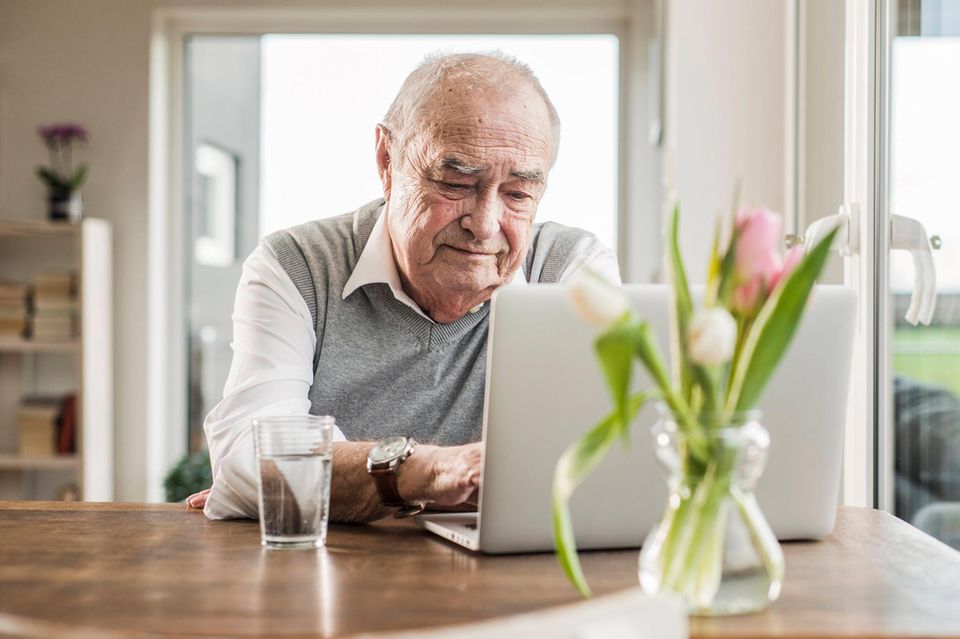Vor gut zwei Monaten schrieb mir ein Leser sehr entschieden mit Blick auf die politischen Zustände in Deutschland und den USA: „Es gibt einen riesigen Unterschied zu den USA, denn egal wer regiert, bei allen Verwerfungen dort gilt: America and business first.“
Anlass war mein Kommentar zur Prozesslawine gegen Donald Trump in den USA. In der September-Ausgabe von Capital hatte ich geschrieben, deutsche Unternehmer und Manager sollten sich gut überlegen, wo sie in den kommenden Monaten ihre Millionen investieren – günstige Energiepreise und staatliche Subventionen aus Washington hin oder her. Es könne schließlich sein, dass sie die Fabrik, die sie heute in den USA planen oder bauen, in anderthalb Jahren in einem anderen Land eröffnen: einem Land am Rande des Bürgerkriegs, wahlweise unregierbar oder unter einem Präsidenten, der erneut Donald Trump heißt.
Wenn man solche Zuschriften erhält, und das war nicht die einzige auf meinen Kommentar, dann überprüft man sich immer selbst: Hast du etwas übersehen, lagst du vielleicht wirklich falsch? Und natürlich gibt es gute Gründe, an die Zukunft der USA zu glauben: Keine andere Industrienation der Erde bietet diesen faszinierenden Mix aus Kraft, Zuversicht und Wachstumswillen. Nirgendwo sonst entstehen so schnell so viele neue Technologien und Geschäftsmodelle, die bald darauf die ganze Welt umwälzen. Und ja, Geschäftsinteressen genießen in dem Land immer einen hohen Stellenwert. Zudem konnte ich Anfang August lediglich auf das Risiko einer Rückkehr Trumps verweisen. Ich konnte nicht ahnen, wie schnell sich die Dinge entwickeln und zuspitzen würden.
Gefahr einer neuen Bankenkrise
Der Sturz des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ist tatsächlich ein dramatischer Einschnitt für die Partei, für die gesamten USA – und damit, leider, auch für uns hier in Europa. Die Revolte deckt nicht nur auf, wie heillos zerstritten das konservative Lager ist und wie tief der politische Riss durch die USA geht. Sie zeigt auch, dass im Grunde beide politischen Lager, Demokraten (die für die Entmachtung McCarthys stimmten) wie Republikaner (bei denen acht Abweichler für die Amtsenthebung reichten), ihren politischen Kompass verloren haben. Statt den Laden irgendwie zu beruhigen und zusammenzuhalten, gewinnen persönliches Machstreben und die Aussicht auf kurzfristige Gewinne die Oberhand.
Welchen Stellenwert dabei noch die wirtschaftlichen Interessen des Landes haben, war in dieser Woche unmittelbar spürbar: Die Renditen amerikanischer Staatsanleihen stiegen noch einmal deutlich an, die eigentlich bombensicheren US-Bonds wecken bei Investoren offenbar zunehmend Zweifel – weil nicht ausgeschlossen ist, dass die USA in den kommenden sechs Wochen tatsächlich handlungs- und zahlungsunfähig werden. Die Folgen wären unabsehbar, doch eine Auswirkung zeichnet sich bereits ab: Banken gehörten in dieser Woche zu den großen Verlierern an der Börse, weil sie auf großen Beständen alter US-Anleihen sitzen, die gerade massiv an Wert verlieren – Beobachter warnen vor einer nächsten Runde in der Bankenkrise. Aber anders als in diesem Frühjahr, als US-Finanzministerin Janet Yellen und Fed-Chef Jerome Powell das Misstrauen an den Märkten relativ schnell einfangen konnten, wären der Bundesregierung in Washington diesmal die Hände gebunden.
In großen Teilen Washingtons regiert die Lust an der Destruktion. Während Teile der Demokraten auf ein finales Zerwürfnis des politischen Gegners setzen, hofft ein starker radikaler Flügel der Republikaner darauf, den Staat als Ganzes ins Chaos zu stürzen – inklusive der eigenen Partei. Dass damit einigermaßen unklar ist, ob und wie die USA in den kommenden Wochen ihre Staatsausgaben finanzieren, ihre Rechnungen zahlen und ihren Schuldendienst leisten: Das ist insbesondere den Radikalen bei den Republikanern, die jetzt auf eine Rückkehr Trumps hoffen, herzlich egal. Im Gegenteil: Sie wollen gerade, dass der verhasste Staat mit seinen Behörden und Institutionen untergeht. Statt „America first“ könnten sie auch schlicht rufen: „Who cares?“
Sind die USA noch ein verlässlicher Partner?
In der Oberstufe hatte ich an meiner Schule einen großartigen Geschichtslehrer, von ihm ist mir ein Satz im Gedächtnis geblieben: Die Demokratie sei wie eine Schicht Eis auf einem See zu Beginn des Winters, sagte er. Vorsichtig müsse man testen, ob sie trägt – andernfalls könne es passieren, dass man unversehens einbricht. In den USA stampfen und springen gerade sehr viele Menschen sehr aufgebracht auf dieser dünnen Schicht Eis herum.
Auch wenn es niemand in Berlin und Brüssel offen anspricht, den Verantwortlichen in Europa ist inzwischen schmerzhaft klar, dass die USA auf die nächsten Jahre hin kein zuverlässiger Partner mehr sein werden, kein Garant der Stabilität. Oder, wie einer der wichtigsten Manager der deutschen Wirtschaft vor wenigen Tagen in einer kleinen abendlichen Runde mit anderen Unternehmenslenkern und Spitzenpolitikern fragte: „Wenn ich mit meinen Daten zu Microsoft oder Amazon gehe, kann ich mir sicher sein, dass die USA 2025 oder spätestens 2029, nach der übernächsten Wahl, noch eine Demokratie sind?“
Der überraschende Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Joe Biden heute in Washington ist daher mehr als nur ein netter Fototermin zum Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Die Liste ihrer Themen ist lang und ernst: Der Krieg in der Ukraine, die Fähigkeiten der Nato, die Zukunft der Demokratie – all das wollen die beiden heute besprechen. Gut möglich, dass Biden Steinmeier eine Botschaft mit auf den Heimweg geben wird: Kommt endlich in die Puschen in Europa.
Denn das ist doch die eigentlich brisante Erkenntnis für uns aus dem politischen Chaos in den USA: Wenn die Regierung in Washington zunehmend handlungsunfähig wird, ist Europa bald eine der letzten Regionen der Welt, in denen Vernunft und Stabilität noch eine Chance haben. Das klingt als Herausforderung vielleicht etwas banal – angesichts des kleinkarierten Hickhacks, den sich die EU-Regierungschefs regelmäßig leisten, wenn sie wie an diesem Freitag auf dem informellen Gipfel im spanischen Granada um Flüchtlingsquoten, Zölle und Beihilfen feilschen, könnte die Aufgabe jedoch kaum größer sein.