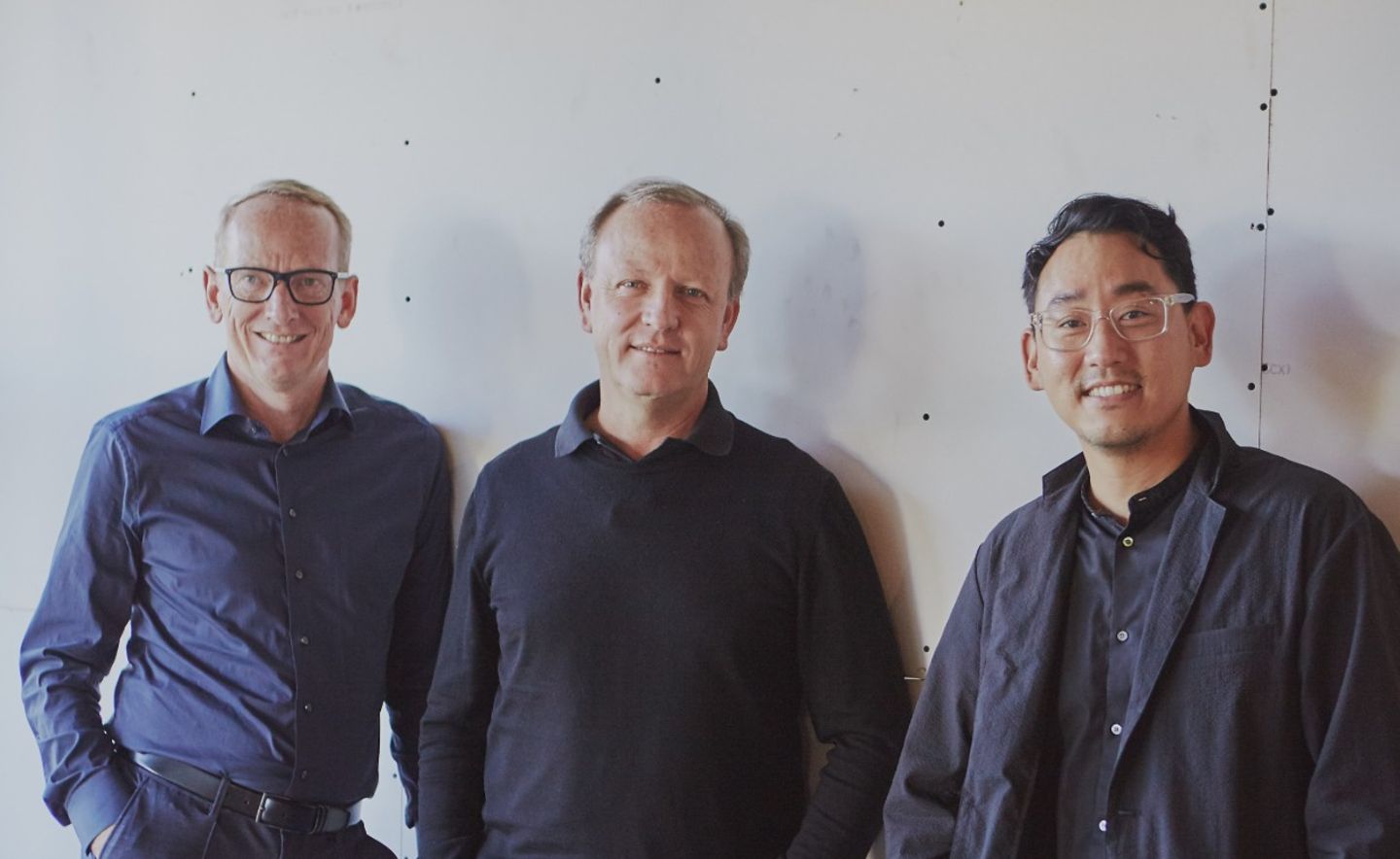Auf dem Weg hierher ist eigentlich immer Stau, aber der frühere Chef von Continental und Opel hat es dann doch geschafft. Karl-Thomas Neumann sitzt in einem Restaurant in Manhattan Beach, Los Angeles, und vor der Terrasse glitzert der Pazifik in der gerade untergehenden Sonne. Nicht weit entfernt in der anderen Richtung verläuft die Interstate 405, eine der meistbefahrenen Autobahnen der Welt: zehn vollgestopfte Spuren, und wenn man ehrlich ist, ist Los Angeles zu Stoßzeiten überhaupt ein einziger Stau. Neumann zeigt ein gut gebräuntes Lächeln und sagt, als sei es für einen Automanager das normalste der Welt: „Das Beste wäre, wenn die Autos verschwinden könnten.“
Neumann, 57 Jahre, sportlich, war einst der Tausendsassa der deutschen Automobilindustrie. Er wurde als möglicher Volkswagen-Chef gehandelt, sprang zwischen röhrenden Motoren auf den Automessen der Welt herum und predigte das Mantra der Branche: Das eigene Auto muss sein, und Verbrennungsmotoren wird es noch lange geben. Das alles ist nun vorbei.
Nachdem die PSA-Gruppe den Opel-Konzern übernommen hatte, musste Neumann im Juni 2017 gehen. Erst einmal segelte er über den Atlantik, ein alter Traum. Luft holen, leben. Dann schaute er sich um, was noch so möglich ist in der Industrie. Dabei traf er auf einen anderen alten Kämpen des Autobaus: Stefan Krause, einst Finanzvorstand bei BMW. Krause hatte ein Start-up für Elektroautos in Los Angeles gegründet: Evelozcity. Gesprochen Iwelossitti. Ein Mix aus „EV“ für E-Auto und „velocity“ für Geschwindigkeit. (Anm.d.Red.: Mittlerweile hat das Unternehmen seinen Namen in "Canoo" geändert) Neumann war skeptisch, es gibt viele schlecht laufende E-Auto-Buden auf der Welt. Aber er war auch neugierig genug, um nach Kalifornien zu fliegen und sich das Ganze anzusehen. Danach war er überzeugt und stieg ein.
„Ich hatte mir vorher selber schon mal überlegt, wie man es denn machen müsste“, sagt Neumann. „Und einer der wichtigen Punkte war: Es muss lean sein, wir können keine Fabrik bauen. Wir wollen uns auf die Vermarktung und die Geschäftsmodelle konzentrieren und nicht auf Dinge, die andere schon sehr gut können.“ Und: bloß keinen weiteren Super-Sportwagen, sondern ein für die Masse erschwingliches Auto. Genauso hatte auch Krause gedacht. Das Unternehmen soll alles anders machen, als es bisher gemacht wurde: voll elektrisch, keine eigenen Fabriken, kein Besitz mehr. Wenn Neumann sagt, die Autos müssten verschwinden, dann meint er nicht, dass es keine mehr geben soll. Er meint, dass sie keine Belastung mehr sein dürfen, sondern nur noch eine Dienstleistung. Man nutzt ein Auto, und dann „verschwindet“ es wieder – zum nächsten Kunden.
Ihre Mitstreiter: Ulrich Kranz und Richard Kim, die einst bei BMW den Bau der Elektroauto-Reihe i vorantrieben. Ein gut sortiertes Vierer-Team: ein Finanzer, ein Techniker, ein Designer und ein Verkäufer. Sie wollen mit den deutschen Konzernen nichts mehr zu tun haben. Und mehr noch: Sie haben den Glauben an deren Zukunft verloren. „Alle wollen Elektromobilität, aber sie wollen auch, dass alles so bleibt, wie es ist“, sagt Neumann. „Es muss sich aber alles ändern, damit es elektrisch werden kann, und diesen Gedanken haben die Traditionellen nicht.“
Evelozcity ließe sich leicht als kleiner Möchtegern abtun, den man nicht weiter ernst nehmen muss. Doch dessen Führungsriege besteht aus Leuten, die genau wissen, wie in den Konzernen kalkuliert wird. Und wo die Schwachstellen liegen. So entwickelt sich das Start-up aus Kalifornien zu einer Kassandra der Branche. Krause, Neumann und ihre Kollegen glauben, dass die alten Autogrößen mit den Anforderungen des Wandels nicht zurechtkommen werden – und sie sagen das auch. „Das ist ein völlig anderes Denken“, sagt Neumann. „Und es bedeutet Zerstörung für alles, was die Hersteller derzeit tun.“
Die vier stellen die ehernen Grundprinzipien ihres Gewerbes infrage. Sie tun dies nicht aus der Position von Silicon-Valley-Stars, denen in Deutschland gern die Auto-Expertise abgesprochen wird. Sondern aus der Sicht von Insidern. Es ist ein kalifornischer Angriff von innen.
Die Argumentation: Die herkömmliche Autoproduktion beruht auf einer hohen Bruttomarge. Die ermöglicht Produktvielfalt und eine eigene Vertriebsstruktur. Mit dem Siegeszug der Elektromobilität aber – und von dem sind die Evelozcity-Chefs überzeugt – ändert sich das alles. E-Autos sind einerseits einfacher zu produzieren, weshalb mehr Konkurrenten einsteigen können. Andererseits gibt es mit der teuren Batterie einen sehr großen Kostenblock.
Kein E-Auto zum Golf-Preis
Das Problem: Es ist mit den herkömmlichen Methoden ausgesprochen schwer, ein Elektroauto gewinnbringend zu produzieren. Und die traditionellen Konzerne sind nicht flexibel genug, um ihre Modelle zu ändern. Wenn Volkswagen verspricht, ein Elektroauto mit 500 Kilometer Reichweite zum Preis eines Golf Diesel zu bauen, dann glaubt das hier bei Evelozcity niemand.
Aber hat Evelozcity eine bessere Idee? Oder stehen dahinter nur ein paar Autoveteranen, die sich darin gefallen, ein bisschen über die ehemaligen Kollegen zu lästern? Die Stefan Effenbergs und Oliver Kahns der Automobilindustrie?
Der Morgen nach dem Treffen mit Neumann am Pazifik. Wer auf der Interstate 405 dem Sitz von Evelozcity in Torrance entgegenkriecht, denkt rasch, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn ein paar Autos verschwänden. Erst nach dem Abzweig in Richtung Torrance wird es ruhiger, fast ländlich. Die neue Zentrale von Evelozcity ist ein unspektakulärer Bau, der auch in einem deutschen Gewerbegebiet stehen könnte.
200 Leute arbeiten hier, 350 sollen es werden. Ein buntes Gemisch junger Menschen in Hoodies und Turnschuhen drängt sich im Erdgeschoss des Gebäudes, solange die obere Etage noch ausgebaut wird. Neumann scherzt auf Englisch mit seinen Mitarbeitern. Er fällt in seinen Jeans und dem offenem Hemd kaum auf unter seinen Kollegen. Es herrscht die amerikanische Mischung aus Lockerheit und Professionalität.
Viele der Mitarbeiter stammen von anderen Unternehmen aus der neuen Welt der Elektroautos: Tesla, das chinesisch kontrollierte Faraday Future und andere. Projekte, die nicht immer funktionieren, aber dazu beitragen, dass Leute Erfahrung mit der Technik sammeln.
Auch Richard Kim war vor seinem Start bei Evelozcity bei Faraday. Der Designchef ist der Mann, der dem Auto, das hier entwickelt wird, das Gesicht geben soll. Er erscheint ganz in Schwarz und trägt, wie er selbst lachend sagt, den üblichen Designerschal als Accessoire. Bevor Kim in seine Werkstatt führt, müssen die Besucher ihre Handys wegschließen, damit sie keine Fotos machen können. Evelozcity mag ein Start-up sein, auf Geheimhaltung legen sie hier trotzdem Wert. In einem kleinen Raum hinter der Sicherheitstür hängen Autoskizzen an der Wand. Lötkolben liegen herum. Links und rechts stehen zwei Rohversionen des ersten Fahrzeugs: eine, die den Innenraum vorführt, und eine für die Karosserie.
Das Ergebnis sieht anders aus als das meiste, was man derzeit auf den Automessen sieht. Ein Mix aus futuristischem Shuttle und Elementen, die eher an die Anfangszeit des Autos erinnern. Runde Sitzbänke, ein hoher Einstieg. Vor allem aber eine Menge Platz: Da alle Technik im Boden untergebracht ist, bleibt darüber viel Raum, um die Beine auszustrecken, oder für den Kinderwagen. Manchmal setzen die vier Manager sich in den aufgebockten Prototyp und halten dort ihre Sitzungen ab.
Der Skateboard-Zulieferer
Das eigentlich Neue ist, wie das Auto vertrieben werden soll. Bei Stefan Krause, der bei BMW und später im Vorstand der Deutschen Bank vor allem für Zahlen zuständig war, beginnen die Augen zu leuchten, wenn er darüber spricht: „Eigene Autos waren ja deshalb so attraktiv, weil sie Freiheit gegeben haben: Wann immer ich irgendwohin will, kann ich das. Heute kann man das gleiche Bedürfnis anders decken. Und eleganter.“ Das Auto, das Evelozcity anbieten will, soll nicht verkauft, sondern in einer Art Dauermiete verliehen werden. Wer nur am Wochenende eins braucht, überlässt es an den Werktagen einem anderen. Oder sogar stundenweise. Um Wartung, Service, Versicherung und alles andere kümmern sich Dienstleister unter der Marke Evelozcity.
Die zweite Idee: Das Unternehmen verkauft an jeden, der ein Elektroauto bauen will, seinen mit Batterie und Antrieb vollgestopften Unterbau. Auf dieses „Skateboard“ können dann andere ihre Karosserie setzen. Evelozcity will also auch Zulieferer sein. Unter Brancheninsidern wird inzwischen genau beobachtet, was die Veteranen in Kalifornien machen: „Die Grundidee ist richtig“, sagt ein hochrangiger Vertreter eines deutschen Autokonzerns. „Das ist alles sehr konsequent zu Ende gedacht.“
Wenn Tesla eine Tochtergesellschaft von BMW gewesen wäre, und die hätten 14 Jahre lang so viel Cash verbrannt, dann wäre doch schon dreimal der gesamte BMW-Vorstand rausgeworfen worden
Stefan Krause
Rechnen soll sich das System, weil das Unternehmen die Fertigung komplett auslagert – an US-amerikanische, vor allem aber an chinesische Fabriken. In der Zentrale selbst wird nur entwickelt und das Geschäftsmodell vorangetrieben. Auf diese Weise will Evelozcity vermeiden, was dem Elektroautopionier Tesla so große Probleme bereitet: dass die Kosten aus dem Ruder laufen. „Die meisten Entscheidungen, die sie getroffen haben, waren richtig“, sagt Krause über Tesla. „Mit der Fabrik aber haben sie aus meiner Sicht einen großen Fehler gemacht. Disruption in einer Automobilfabrik hinzukriegen ist schwierig bis unmöglich.“
Aber warum sollten die großen Automobilkonzerne etwas Ähnliches nicht auch schaffen? Mit all ihren Digitallaboren, Innovationswettbewerben und Hackathons? Immerhin arbeiten Daimler, Volkswagen oder GM ja auch an Mobilität als Dienstleistung und natürlich an Elektroautos. Krause aber glaubt nicht, dass die alten Hersteller wirklich konsequent neue Ideen entwickeln – weil ihnen immer irgendwann das Controlling dazwischenfährt. „Wenn Tesla eine Tochtergesellschaft von BMW gewesen wäre, und die hätten 14 Jahre lang so viel Cash verbrannt, dann wäre doch schon dreimal der gesamte BMW-Vorstand rausgeworfen worden“, sagt er. „Und die Shareholder hätten das Projekt gestoppt.“ Mit anderen Worten: Niemand wird zum Revolutionär, wenn das alte Regime noch so viel Geld abwirft.
Eines ist klar: Evelozcity meint es ernster, als viele in der Branche anfangs dachten. Es wurden drei Investoren aus Deutschland, Taiwan und China aufgetrieben, die das Unternehmen erst einmal bis zum Start der Produktion im Jahr 2021 finanzieren. Zahlen werden keine genannt, aber in der Industrie wird mit einem nötigen Aufwand von etwa 1 Mrd. Dollar gerechnet. Ende Oktober traf der erste fahrtüchtige Prototyp in Torrance ein. Der wird nun den Geldgebern präsentiert.
Freiheit statt Geld
Die große Frage aber ist, ob Evelozcity langfristig angelegt ist oder ob eher eine gute Wachstumsstory verkauft werden soll – wie bei vielen Start-ups. Krause, der erfahrene Rechner, versucht gar nicht erst, den Verdacht auszuräumen: „Es kann auch sein, dass ein Teil unserer Investoren überlegt, ob nicht jemand die Firma in einigen Jahren kaufen will. Das wissen wir alles noch nicht. Aber natürlich wäre das ein denkbarer Pfad.“ Die Vorgabe jedenfalls lautet nicht, rasch profitabel zu werden, sondern vor allem, dass das Unternehmen seinen Wert steigern soll.
Natürlich würden davon auch Neumann, Krause, Kranz und Kim profitieren, die auch mit eigenem Geld beteiligt sind. Aber ist es wirklich das, worum es geht – bei Managern, die ihr Leben lang zu den Bestverdienern gehört haben?
In Kalifornien findet man Leute mit einer Risikomentalität. Eine solche Kultur gibt es in Europa selten.
Ulrich Kranz
Wer mit dem Evelozcity-Team spricht, trifft auf ein Motiv, das mit Geld eher wenig zu tun hat: Freiheit. „Was mich brutal befreit, ist, dass ich jetzt frei denken darf. Und frei reden darf“, sagt Neumann. „Die ganzen Privilegien sind weg. Ich sehe das eher als Entlastung“, sagt Krause. Die Möglichkeit, nach den Zwängen der Industrie mit ihren ganzen Vorstandssitzungen und Leitungsrunden einfach mal sagen zu können, wie man die Welt sieht, scheint viel wert zu sein. Weiter weg von Deutschland könnte das Team kaum sein, auch das ist ihnen offenbar wichtig. Los Angeles hat die Ingenieure, das Geld, aber auch die Offenheit für neue Ideen. „Die Deutschen sind traditionell sehr auf Sicherheit bedacht“, sagt Ulrich Kranz. „In Kalifornien findet man Leute mit einer Risikomentalität. Eine solche Kultur gibt es in Europa selten.“
Neumann, den hier alle nur „KT“ nennen, hat jetzt seine Familie nachgeholt, aus Königstein im Taunus. In der Garage seines neuen Hauses steht nach wie vor ein Auto mit Verbrennungsmotor. Es gibt nur eine Ladestation, und auch die ist nicht besonders leistungsfähig. Doch in Los Angeles fahren überall Elektro-Scooter herum, klappbare Roller, mit denen man über die Straßen surren kann. Neumann hat sich jetzt auch einen gekauft.
E-Autos kosten zu viel
Im Sommer 2018 veröffentlichte das Evidence Lab, die Forschungsgruppe der Schweizer Großbank UBS, einen Bericht, der es in sich hatte. Die Analysten hatten mehrere Elektroautos auseinandergenommen und bis ins Detail geprüft. Darunter auch das Model 3 von Tesla, das mit einem Zielpreis von 35.000 Dollar für den Massenmarkt konzipiert ist.
Von der Technik des Autos zeigten sich die Experten weitgehend beeindruckt. Auf Seite acht des Reports aber findet sich ein Satz, der Tesla-Freunde erschrecken dürfte: „Wir gehen davon aus, dass die Basisversion für 35.000 Dollar pro Auto etwa 5900 Dollar Verlust machen würde“, schrieben die Tester.
Mit anderen Worten: Einen profitablen Tesla für den kleineren Geldbeutel gibt es gar nicht. Das allein wäre vielleicht nur eine Randnotiz – wenn andere Hersteller das Problem nicht auch hätten.
Es gilt unter Experten als offenes Geheimnis, das bisher niemand mit einem Elektroauto für die große Masse Geld verdient. Weder BMW mit dem i3 noch GM mit dem Chevrolet Bolt. Während elektrifizierte Sportwagen mit hohen Margen profitabel sein können, schlagen Alltagsmodelle auf die Kosten. „Vor allem im Volumensegment ist es aktuell immer noch schwierig, Elektroautos gewinnbringend zu produzieren“, sagt Wolfgang Bernhart, Partner und Autoexperte bei Roland Berger.
Das Problem: Der hohe Kostenanteil der Batterie von etwa einem Drittel der Wertschöpfung lässt sich mit einer strafferen Produktion kaum senken. Er geht vor allem auf Rohstoffe wie Kobalt und Lithium zurück, und deren Preise steigen derzeit eher. Selbst eine eigene Zellproduktion in Deutschland, die von der Politik gefordert wird, würde daran nichts ändern. „Alleine für die Batterie fallen immer noch Kosten von 5000 bis 6000 Euro pro Auto an“, sagt Bernhart.
Problematisch könnte das vor allem für Volkswagen werden, wo eine Reihe neuer Elektroautos vorbereitet wird. Das Versprechen für das Volumenmodell I.D.: Reichweiten von 500 Kilometern, aber ein Preis in Höhe eines Golf Diesel.
Intern wird auch in Wolfsburg eingeräumt, dass dieses Konzept bisher kaum kostendeckend sein kann. Die Lücke soll mit zusätzlichen Services rund ums Auto geschlossen werden.