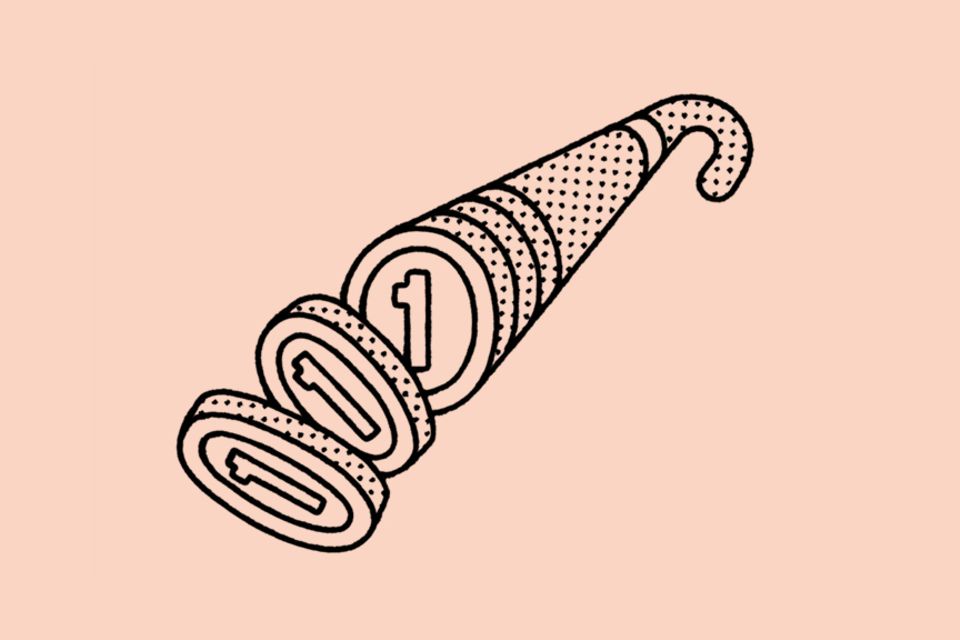Capital: Herr Geyer, Gesamtmetallchef Stefan Wolf hat jüngst gefordert, das Rentenalter schrittweise auf 70 Jahre zu erhöhen. Und nicht nur das: Wir sollen alle auch noch mehr arbeiten. Hat er damit recht?
JOHANNES GEYER: Zunächst einmal hat Herr Wolf recht, dass die Rente vor allem aus Löhnen, also aus Arbeit, finanziert wird. Insofern könnte eine Erhöhung des Rentenalters einen kleinen Teil beitragen, ist aber nicht die ultimative Lösung. Die Frage ist, was er unter Mehrarbeit versteht: Ich würde ihm zustimmen, wenn er die aktuellen Potenziale meint. Wir haben zum Beispiel große Möglichkeiten bei Menschen in Unterbeschäftigung – also solchen, die einfach zu wenig Stunden arbeiten. Da geht es dann um die Frage, ob die Förderung von Minijobs sinnvoll ist. Ich denke aber, dass Herr Wolf die Erhöhung der Wochen-Arbeitszeit von 40 auf 42 Stunden meint. Das macht keinen Sinn, weil die Belastungen pro zusätzlicher Arbeitsstunde immer höher werden. Deswegen ist das in vielen Branchen realitätsfern, weil die Arbeitnehmer ohnehin völlig überlastet sind.
Viele Menschen sind doch bewusst in ihren aktuellen Strukturen. Zum Beispiel, weil sie Kinder selbst großziehen möchten, oder weil sie die Arbeitsbelastung reduzieren wollen. Andere sind zum Beispiel auch krank. Wie groß ist dieses Potenzial denn wirklich?
Das ist vollkommen richtig und sehr wichtig. Die Debatte wird häufig in großen Überschriften geführt – etwa: ,Das ist die ultimative Lösung für das Rentenproblem‘. Wenn man aber genau hinschaut, zeigen sich sehr schnell die Probleme.
An welche Probleme denken Sie da?
Wir sind bei der Kinderbetreuung in den vergangenen 20 Jahren zum Beispiel weit gekommen, haben aber immer noch eine hohe Teilzeitquote bei Eltern. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn Eltern ihre Kinder großziehen wollen. Die Frage ist trotzdem, ob man den Eltern nicht mit besserer Betreuung mehr Arbeitsstunden ermöglichen könnte. Und solche Diskussionen lassen sich auf viele Bereiche übertragen. Insgesamt wäre das Potenzial enorm. Die Reserve durch Teilzeit von Frauen ist zum Beispiel viel größer als durch die 42-Stunden-Woche.
Herr Wolf ist da anderer Meinung und sagt, dass die Reserven aufgebraucht sind...
Das sehe ich anders. Wenn wir uns den Bereich der Minijobs anschauen und den Bereich der Arbeitslosen, dann gibt es enorme Reserven. Außerdem gehen jährlich rund 170 Tausend Menschen vorzeitig aufgrund von Krankheiten in Rente. Ich denke da zum Beispiel an schlechte Arbeitsbedingungen und mentalen Druck. Mit besserer Vorsorge kann man hier noch richtig was machen. Da gibt es auch Probleme: Diejenigen, die einmal wegen Krankheiten in der Erwerbsminderungsrente gelandet sind, kehren in der Regel nicht in den regulären Arbeitsmarkt zurück. Hier haben wir weitere Potenziale, selbst wenn man wenig verhinderbare Krankheiten wie Krebs abzieht. Und nicht zuletzt gibt es das Thema Zuwanderung. Das kommt mir in der öffentlichen Debatte manchmal etwas zu kurz.
Warum?
Wir brauchen Zuwanderung, da führt kein Weg dran vorbei. Und je besser das gelingt, umso entlastender wirkt das auf das Rentensystem.
Viele Zuwanderer hängen in Duldungsschleifen oder erhalten aus anderen Gründen keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Was muss sich aus ihrer Sicht ändern?
Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist: Wie gehen wir mit Geduldeten und Asylberechtigten um? Da sind jetzt die ersten Schritte gemacht worden, um den Zugang zu erleichtern, und das ist auch gut so. Das andere ist die Arbeitsmarktmigration. Innerhalb der EU profitiert Deutschland stark als Nettoimporteur von Fachkräften aus Südosteuropa. Das war sehr wichtig für die gute Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre. Gleichzeitig ist Deutschland aber weltweit auf der Suche nach Fachkräften. Da geht es dann etwa um die Anerkennung von Abschlüssen oder Deutschunterricht in diesen Ländern. Da sind die Hürden je nach Einwanderungsland noch deutlich zu kompliziert.
Reicht das denn? Wenn die Menschen bis 70 arbeiten, wäre das doch auch ein Potenzial…
Da muss man mal eine Rechnung aufmachen: Das Renteneintrittsalter würde schrittweise angepasst werden – zum Beispiel, indem man das Eintrittsalter an die Lebenserwartung koppelt. Die aktuelle Anhebung auf 67 Jahre gilt beispielsweise auch erst ab 2031. Wenn wir in diesem Tempo das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre erhöhen, dann befinden wir uns weit in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Es kann sein, dass wir das Instrument irgendwann brauchen, weil es natürlich einen entlastenden Effekt hätte. Aber kurzfristig hilft es uns nicht.
Es gibt aber noch andere Ideen, zum Beispiel, dass Beamte und Selbstständige in das Rentensystem einzahlen sollen. Was halten Sie davon?
Das ist grundsätzlich ein sinnvoller Vorschlag, vor allem bei Selbstständigen, die nicht pflichtversichert sind. Zum einen, weil Teile dieser Gruppe ein erhöhtes Altersarmutsrisiko haben, zum anderen glaube ich, dass ein einheitliches Rentensystem einiges vereinfachen würde. Zunächst erhöht das die Beiträge, was kurzfristig helfen würde. Langfristig gleicht sich der Effekt zwar aus, aber für eine Zeit lang könnten wir den Beitragssatzanstieg damit abdämpfen. Ob es das wert ist, ist eine politische Entscheidung. Der Weg dahin wäre jedenfalls nicht einfach.
Wo sehen sie die Hürden?
Ein einheitliches System würde bedeuten, dass wir das bisherige System abschaffen. Bei den Beamten müsste man mehr oder weniger deren Absicherung nachbauen. Das wird teuer. Man müsste das System eher Stück für Stück umbauen, und weniger verbeamten – zum Beispiel bei Lehrern. So wird das ganze System langfristig umgestellt.
Neue Arbeitszeitmodelle sehen eigentlich eher weniger Arbeitszeit pro Woche vor. Ist diese Entwicklung für das Rentensystem überhaupt tragbar?
Das ist schwierig zu sagen, wir haben jedenfalls keine eigene Berechnungen dazu. Die Rente finanziert sich aus den Löhnen, insofern ist das denkbar. Ob es ausreicht, um gute Renten zu finanzieren, ist eine andere Frage. Hier wäre es zum Beispiel so: Arbeitszeitverkürzungen können die Produktivität heben und Freiräume für Betreuung schaffen. Das kann wiederum positive Effekte auf die Pflege haben. Auf der anderen Seite gibt es Potenzialverluste. Das muss man gegeneinander aufrechnen, was sicher keine triviale Frage ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das funktioniert – aber eben auch nicht leicht zu beantworten. Auf jeden Fall könnte auch der Staat helfen, indem er mehr eigene Mittel in das Rentensystem lenkt.
Das wäre eine vierte Möglichkeit…
Ja, und wenn man sich andere Länder anschaut, dann machen das auch einige. Deutschland steckt etwa zehn Prozent seine Bruttoinlandsprodukts in das Rentensystem. In Österreich sind es 14 Prozent, und Österreich ist auch noch nicht untergegangen. Es ist also eine Frage des politischen Willens.
Das aktuelle System beruht maßgeblich auf zwei Haltelinien: Dem Beitragssatz von 18,6 Prozent, den Arbeitnehmer einzahlen müssen, und dem Rentenniveau von 48 Prozent. Dazu kommt noch das Renteneintrittsalter. An welchen Stellschrauben wird am ehesten gedreht?
Ich halte es für realistisch, dass an allen dreien etwas getan wird. Ich glaube allerdings, dass es beim Rentenniveau erstmal nicht viel weiter runtergeht. Die Fiktion, dass wir das ergänzen können durch eine kapitalgedeckte Säule…
…dass die Menschen also selbst etwas für das Alter sparen …
…diese Fiktion hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben einen Teil der Bevölkerung, der nicht spart, der muss aber auch abgesichert werden. Wir haben einen Teil, der spart, aber nicht genügend. Also, kurz gesagt: Dass wir, wie früher mal gedacht, auf 43 Prozent Rentenniveau runterkönnen, halte ich für unwahrscheinlich. Spannend wird es ab 2025, wenn wir über eine Erhöhung des Beitragssatzes diskutieren werden. Das wird kommen.
Die Rentenkommission hat hier bereits einen Pfad bis 24 Prozent vorgeschlagen. Das würde Arbeitnehmer hart treffen. Halten Sie das für realistisch?
Ja, solche Beiträge sind langfristig denkbar. Die Frage ist aber, wie man diesen Pfad dämpfend begleiten kann. Da kommen dann wieder die genannten Möglichkeiten Potenziale, Migration, usw. ins Spiel. So etwas würde einen Teil kompensieren.
Wenn sie ein weißes Blatt Papier vor sich hätten und ein Rentensystem zeichnen müssten. Wie müsste das aussehen?
Das Rentensystem ist zuletzt stehengeblieben ohne ein klares politisches Ziel. Wenn es so ein Ziel gäbe, zum Beispiel, was Arbeitnehmer hier von der Rente erwarten können, dann könnte man die Rolle der verschiedenen Säulen definieren: Privat, betrieblich und gesetzlich. Dieses Zusammenspiel muss noch mal neu gedacht werden. Wir müssen uns über die Rolle der gesetzlichen Vorsorge im Alterssicherungsmix klar werden. Und wenn man hier eine Position gefunden hat, sollten wir uns die Fragen stellen: Wie erreicht man das? Was kostet das? Klappt die Zuwanderung? Bei der privaten Säule muss man dann unbedingt schauen, dass alle Menschen mitmachen können. Sonst bringt das nicht viel und führt im Gegenteil sogar noch zu mehr Ungleichheit.