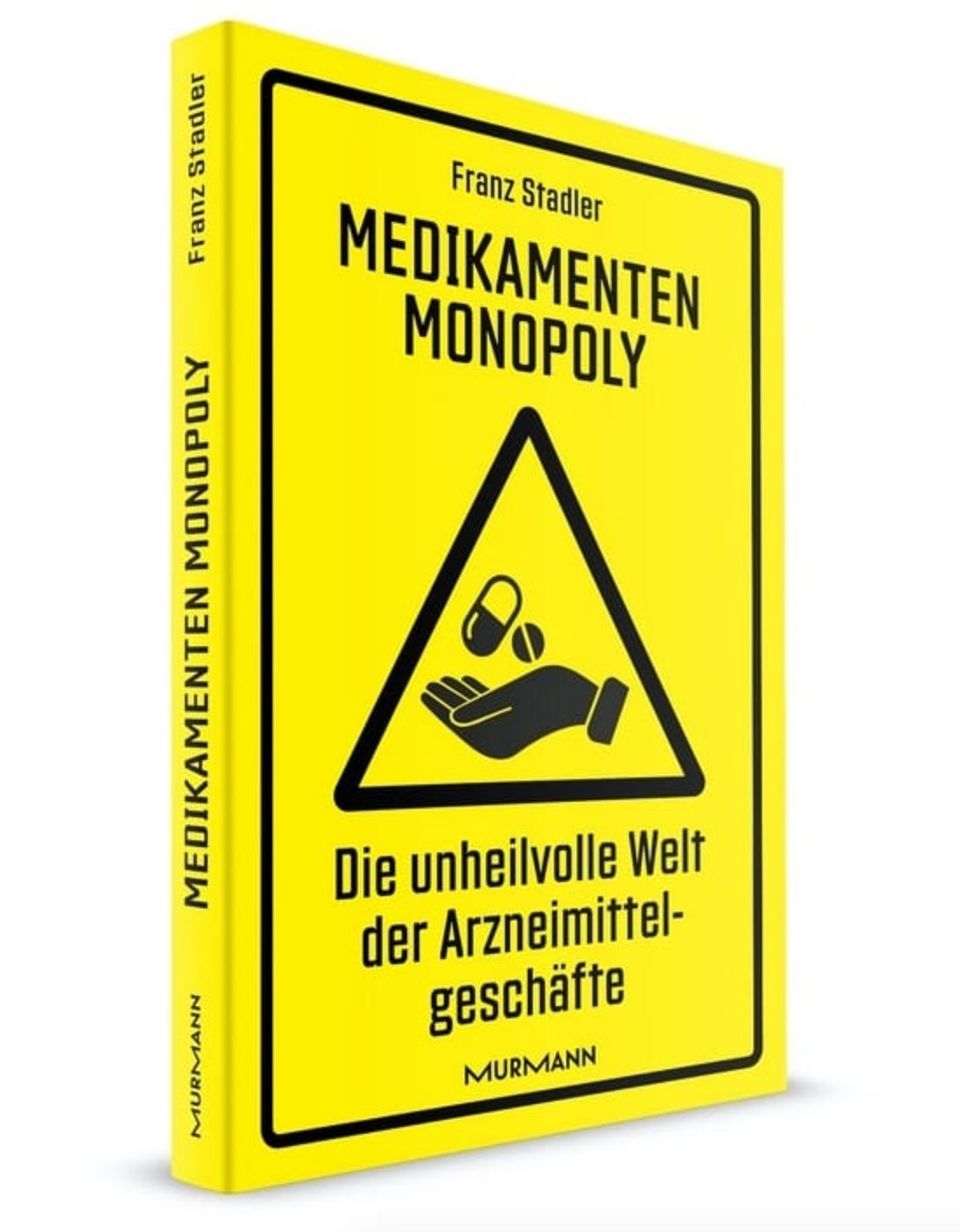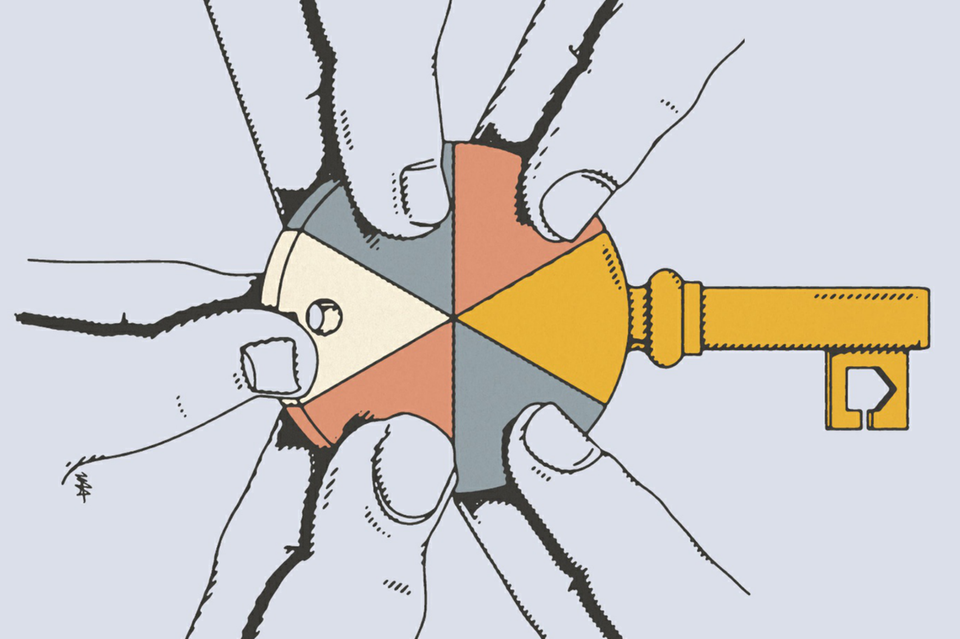Franz Stadler ist Autor des Buches „Medikamenten-Monopoly“. Stadler kennt sich auf dem Gebiet aus: Er ist Apotheker, promovierter Pharmazeut und betrieb jahrelang ein Zytostatikalabor in der Nähe von München.
Deutschland ist bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Trotzdem lautet Ihre Prognose: „Künftig wird nicht mehr jeder Kranke jederzeit die besten Arzneimittel bekommen.“ Warum?
Wir sind bisher noch gut durch die Pandemie gekommen, weil unter anderem unser Gesundheitssystem noch nicht komplett durchökonomisiert ist. Es gibt aber zwei gegensätzliche Tendenzen, die aktuell an der Stabilität sägen: Die eine ist der finanzielle Druck auf das Solidarsystem, der dafür sorgt, dass die Medikamenten-Versorgung immer stärker zentralisiert wird. Die zweite ist, das Bestreben vieler Beteiligter, möglichst viel Gewinn aus dem System zu ziehen. Beispielsweise werden patentgeschützte Medikamente immer teurer, die Gesamtausgaben für Arzneimittel steigen weiter und das obwohl bei Nachahmerpräparaten im sogenannten generischen Markt Milliardenbeträge eingespart werden. Das kann irgendwann dazu führen, dass Krankenkassen nicht mehr in der Lage sind, die Kosten für bestimmte innovative Medikamente zu übernehmen. Damit nähern wir uns dann dem amerikanischen System an. Wir hätten also die besten Versorgungsmöglichkeiten – aber nur für die, die es sich leisten können.
In Ihrem Buch nennen Sie diese und weitere Entwicklungen im Gesundheitssystem „Medikamenten-Monopoly“. Was muss man sich darunter vorstellen?
Medikamenten-Monopoly ist der sorglose, fast spielerische, von Geldgier getriebene Umgang mit unserer Arzneimittelversorgung. Jeder sieht nur die Kosten und den Nutzen auf seiner Seite. Das ist aus der Sicht der einzelnen Beteiligten verständlich. Aber so gerät das große Ganze, nämlich das Gesundheitssystem, aus dem Blick. Und genau das gefährdet unsere Arzneimittelversorgung.
Welche Rolle spielt dabei die Medikamentenproduktion?
Bei der Wirkstoffproduktion im generischen Markt haben wir mittlerweile eine weltweite Konzentration auf wenige Produzenten – das macht die Versorgung zentraler und effizienter, aber auch fragiler. Etwa 80 Prozent der Wirkstoffe kommen aktuell aus dem asiatischen Raum, allen voran aus Indien und China. Wenn es dann Störungen in der Produktion gibt, sorgt das für weltweite Lieferengpässe. Das ist allerdings kein neues Phänomen. Auch vor der Corona-Pandemie gab es schon Lieferengpässe.
Warum?
Das hängt unter anderem mit den Rabattverträgen zusammen, die Krankenkassen und Wirkstoffhersteller bei Nachahmerpräparaten abschließen. Im Prinzip funktionieren diese Rabattverträge wie Ausschreibungen, den Zuschlag bekommt also nur der billigste Anbieter. Dadurch kann natürlich eingespart werden. Für die Wirkstoffhersteller gilt aber, dass sie bevorzugt an den Abnehmer verkaufen, der ihnen den höchsten Preis bietet – und das ist dann eben nicht Deutschland. Das verstärkt wiederum Lieferengpässe, die ohnehin schon da sind.
Was heißt die Auslagerung denn für die Qualität dieser Präparate?
Die Qualität ist schwerer zu kontrollieren. Aktuell reichen beispielsweise die Wirkstoffhersteller bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein sogenanntes Cep-Zertifikat ein, das die Schritte der Produktion und mögliche Verunreinigungen aufführt. Bei Kontrollen werden nur die angegebenen Verunreinigungen geprüft. Der Valsartan-Skandal von 2018 zeigt aber, dass es auch zu Verunreinigungen kommen kann, die nicht in diesen Zertifikaten aufgeführt werden – im Fall von Valsartan mit dem krebserregenden N-Nitrosodimethylamin. Danach mussten viele Medikamente mit Valsartan vom Markt genommen werden – und das hat zu mehr als hundert Lieferengpässen weltweit geführt. Will man das vermeiden, braucht es aus meiner Sicht eine private Stiftung für Arzneimittelsicherheit, die Medikamente unabhängig und gründlich auf jegliche Verunreinigungen untersucht.
Würde eine Verlagerung der Produktion die Situation verbessern?
Viele Syntheseschritte bei der Wirkstoffproduktion sind über die ganze Welt verteilt. Wenn man das alles nach Deutschland zurückholen wollte, zieht das einen jahrelangen Prozess nach sich – und macht auch viel mehr Infrastruktur notwendig. Der schnellere Weg, wäre ein nationales Arzneimitteldepot. So hätte man einen Puffer an Medikamenten von mehreren Monaten und könnte so besser auf bestimmte Engpässe reagieren.
Wie hat sich die Lage in der Corona-Pandemie verändert?
Sie hat sich teilweise zum Positiven verändert, denn es wurden aufgrund von Notfallgesetzen einige bürokratische Hürden ausgesetzt. Das hat es beispielsweise Apotheken erleichtert, Medikamente anderer Hersteller herauszugeben als in den Rabattverträgen vereinbart. Dadurch sind die Lieferengpässe etwas zurückgegangen. Für Patienten hat das wiederum den Vorteil, dass sie nicht mehrmals zur Apotheke kommen müssen, weil das vereinbarte Präparat gerade nicht vorrätig ist.
Gibt es denn auch Lehren, die man aus der Pandemie ziehen kann?
Die Hauptlehre ist, dass man ein Gesundheitssystem braucht, das vor Ort ist und zum Beispiel durch die Apotheken direkt mit den Patienten sprechen kann. Deshalb sollten Bürokratie abgebaut und dezentrale Strukturen gestärkt werden. Durch den persönlichen Kontakt und die räumliche Nähe steigt das Verantwortlichkeitsgefühl. Beispielsweise kursierte zwischenzeitlich das Gerücht, Ibuprofen sorge für einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung . Einige Kunden wollten daraufhin Paracetamol horten. Apotheker können dann aufklärend eingreifen, vom Kauf abraten oder sagen: Nehmen Sie erstmal die eine Packung – und wenn die leer ist, kommen Sie wieder. Versandapotheken würden die Bestellungen einfach ausführen, bis die Bestände leer sind – und andere Patienten deshalb leer ausgehen.
Glauben Sie, dass Corona der Anlass für Verbesserungen sein kann?
Ich hoffe es. Das war einer der Gründe, warum ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe schon lange in Fachmedien auf diese Missstände im Gesundheitssystem hingewiesen. Es ist also nicht so, dass die Probleme nicht bekannt sind. Aber weil der öffentliche Druck fehlt, ist es bisher nicht dazu gekommen, dass sich an der Situation etwas ändert. Allerdings ist es für jeden Einzelnen von uns wichtig, dass das Gesundheitssystem funktioniert. Denn jeder ist mal krank und will dann auch mit sicheren Arzneimitteln versorgt werden.
Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung im Gesundheitssystem ein?
Ich sehe die Hauptgefahr darin, dass die jetzige Entwicklung wieder rückgängig gemacht wird, die Notfallgesetze wieder aufgehoben werden und wir so weiter machen, wie es vorher war. Ein „Weiter so“ halte ich aber nicht für gut. Denn bei einem „Weiter so“ sind wir für die nächste Pandemie nicht mehr gerüstet.
Was muss denn passieren, damit vor allem die gesicherte Versorgung von Arzneimitteln wieder im Vordergrund steht?
Wir haben ein solidarisches Gesundheitssystem das funktioniert, das hat uns auch die Corona-Pandemie gezeigt. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass dieses System finanzgetrieben ausgeplündert wird, zum Beispiel weil es immer mehr Finanzinvestoren im Gesundheitsbereich gibt, die sich vor allem auf ihre Rendite konzentrieren. Das ist langfristig auch nicht im Interesse der Patienten. Wir brauchen also weniger Bürokratie, dafür aber mehr Transparenz und dezentrale Strukturen. Kurz: Man braucht ein rückkoppelndes Solidarsystem. Auch der Patient muss ein Interesse daran entwickeln, dass die Arzneimittelversorgung sicher funktioniert. Gleichzeitig kommt auch dem Staat die Aufgabe zu, bei den Rahmenbedingungen, die er setzt, zuerst an die Arzneimittelsicherheit zu denken. Das geht zum Beispiel durch ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, mit staatlicher Arzneimittelforschung und -entwicklung in unrentablen Bereichen und einem nationalen Arzneimitteldepot. Auch der Patentschutz muss hinterfragt werden, damit der Preis für innovative Medikamente nicht zu hoch wird. Über die genaue Art und Weise kann man ja diskutieren. Aber jeder sollte ein Interesse daran entwickeln, dass unser Gesundheitssystem funktioniert.