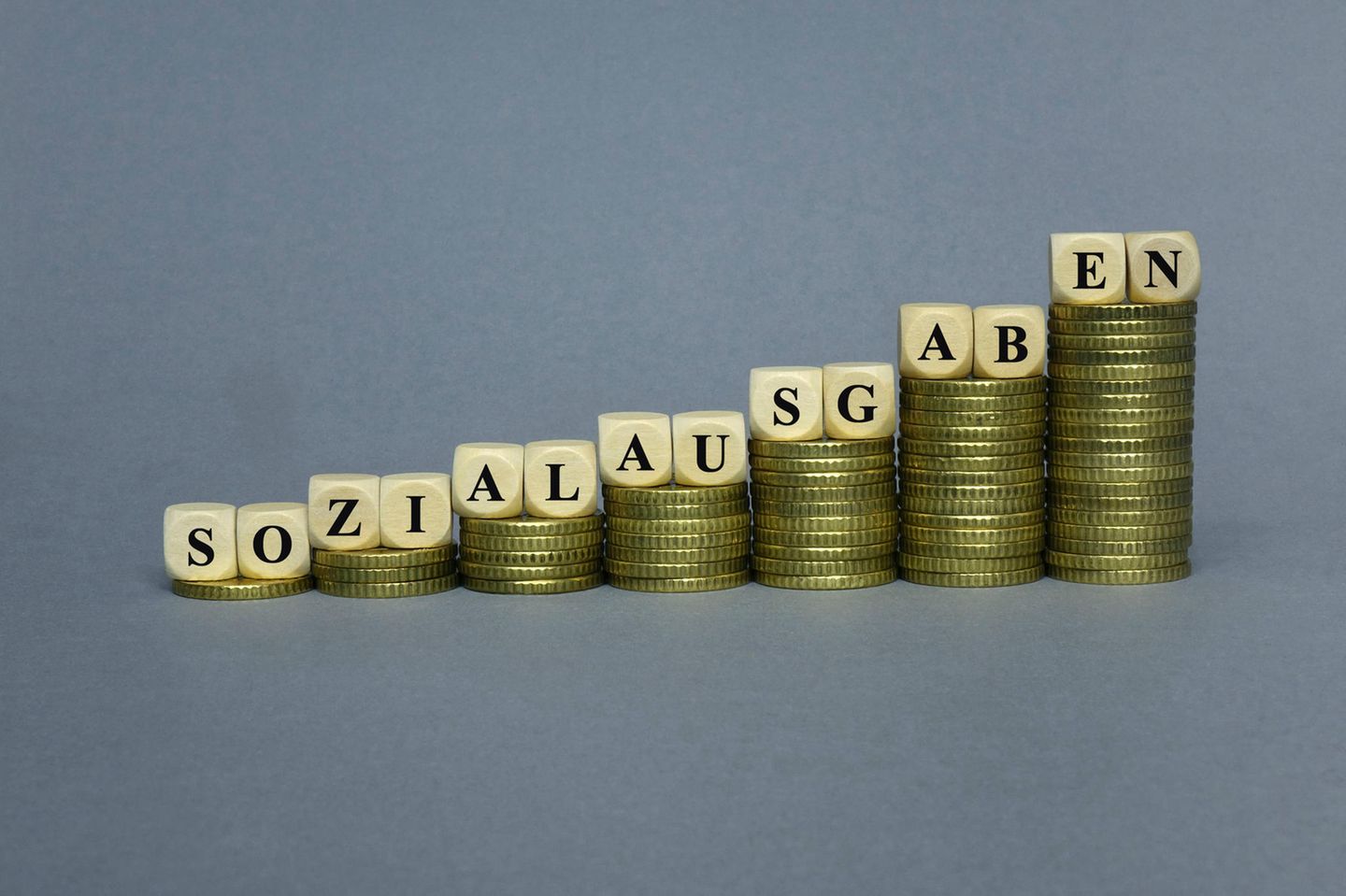Capital: Herr Peichl, wir haben eine Haushaltskrise in Deutschland. Union und FDP würden diese am liebsten mit Einsparungen bei Sozialleistungen lösen. Sie haben viel zu Ungleichheit geforscht. Aus Ihrer Perspektive: Beunruhigen Sie die Forderungen oder sind sie gerechtfertigt?
ANDREAS PEICHL: Es ist eine politische Frage, was man erreichen will. Aus ökonomischer Sicht halte ich es aber für den völlig falschen Ansatz, an den Schwächsten der Gesellschaft zu sparen. Der Hebel ist deutlich kleiner, als viele gerne vorgeben.
Warum?
Nehmen wir die Debatte um das Bürgergeld…
…Markus Söder hat im Stern gefordert, „die Bürgergelderhöhung zu verschieben und noch mal völlig neu anzusetzen“…
Ja. Und auf den ersten Blick hat er sicher einen Punkt, wenn er hinterfragt, warum die Erhöhung im kommenden Jahr mit 61 Euro so hoch ist. Das lässt sich aber leicht erklären, und wenn man dann in die Details geht, versteht man schnell, warum sich das nicht so leicht verschieben oder neu ansetzen lässt.
Und zwar?
Die Erhöhung hat zwei Gründe: Zum einen die hohe Inflation im vergangenen Jahr. Und zum anderen eine Umstellung bei der Berechnung des Existenzminimums, die sich nicht nur auf das Bürgergeld, sondern auch auf den Kinderzuschlag, und den Kinder- bzw. den Grundfreibetrag in der die Einkommenssteuer auswirkt. Die Berechnung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage und basiert auf Daten, die nur alle fünf Jahre erhoben werden – Mikrodaten aus der Einkommens- und Verbraucherstichprobe. In der Zwischenzeit schreibt man die Werte basierend auf einem Mischindex aus 70 Prozent Inflation und 30 Prozent Nettolohnentwicklung fort. Über dieses Vorgehen kann sich die Bundesregierung nicht einfach hinwegsetzen.
Aber die Inflation ist doch zuletzt gesunken.
Ja, und das wäre auch der einzige Punkt, an dem man kurzfristig ansetzen könnte. Allerdings müsste man dann statt einer Fortschreibung, wo man aktuell sozusagen zweimal die hohe vergangene Inflationsrate für die Anpassung nimmt, eine Inflationsprognose verwenden. Hierfür wäre jedoch eine erneute Anpassung der Berechnungsregeln notwendig. Bei der Berechnung im Sommer war man sicherlich von einer längerfristig höheren Inflationsrate ausgegangen. Würde man jetzt mit einer aktuellen Inflationsprognose statt der Fortschreibung noch einmal neu rechnen, kämen hier bestimmt keine 61 Euro Erhöhung raus. Es wäre aber auch nicht so, dass null Euro herauskämen.
Sondern?
Schwierig aus dem Kopf zu sagen. Wir reden hier allenfalls von Einsparungen in Höhe von maximal 1 Mrd. Euro. Und das füllt sicher nicht das Loch von 17 Mrd. Euro.
In anderen Worten: Am Bürgergeld gesundet der deutsche Haushalt nicht?
Nein, auf keinen Fall. Da muss man an ganz andere Töpfe ran.
Wo ließe sich denn minimalinvasiv und kurzfristig sparen? Geht das überhaupt bei den Sozialausgaben?
Minimalinvasiv und Sozialpolitik schließen sich ein wenig aus. Kurzfristig ist der entscheidendere Punkt. Das Existenzminimum fällt für mich raus, weil es steuerlich und verfassungsrechtlich geschützt ist. Das gleiche gilt für die Abschaffung des Ehegattensplittings oder der Pendlerpauschale. Das würde zwar zu Mehreinnahmen führen, beide sind aber verfassungsrechtlich zumindest teilweise geschützt.
Was ist mit dem Dienstwagenprivileg?
Ja, das ließe sich einfacher umsetzen, weil es keine verfassungsrechtlichen Bedenken gibt.
Wo ließe sich sonst noch ansetzen?
In der Sozial- und Finanzpolitik am ehesten bei Steuern. Wenn dem Staat Geld fehlt, kann er die Einkommenssteuer oder die Mehrwertsteuer erhöhen. Das führt natürlich zu großen Diskussionen, wie jetzt in der Gastronomie. Aber es ist formal eine verhältnismäßig leichte Möglichkeit.
Das würde vor allem die arbeitende Bevölkerung treffen. Kann das gerecht sein?
Naja, wenn man Teile der reduzierten Mehrwertsteuersätze abschafft, würde das alle beim Konsum treffen.
Es heißt doch, wir hätten kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. Das waren jetzt zwei Beispiele für Mehreinnahmen. Wo ließe sich an den Ausgaben sparen?
Da ist man sofort bei der Rente. Die Rente mit 63, Grundrente, Mütterrente – das sind alles Themen, über die sich angesichts der gestiegenen Lebenserwartung diskutieren ließen. Da haben wir in der Vergangenheit möglicherweise über unseren Verhältnissen gelebt. Das wäre also die richtige Stellschraube.
Aber auch nichts, wo sich kurzfristig ansetzen ließe, richtig?
Ja, das sind Kostenblöcke, die wir über zehn Jahre aufgebaut haben und die sich nicht mit einem Federstrich beenden ließen.
Ein Vorschlag lautet auch, bei den Kosten für Geflüchtete – vor allem aus der Ukraine – zu sparen. Sinnvoll?
Da ist man schnell wieder beim Thema Bürgergeld. Unabhängig davon ließe sich aber darüber diskutieren, ob wir die richtigen Anreize zum Arbeiten für Geflüchtete setzen.
Und haben wir die?
Naja. Erst einmal glaube ich nicht, dass das Bürgergeld Menschen vom Arbeiten abhält – schwarze Schafe ausgenommen. Arbeit macht glücklich und gibt vielen Menschen einen Sinn. Das Problem sind die Anrechnungsregeln und Transferentzugsraten – also wie viel Einkommen einem auf das Bürgergeld angerechnet wird. Das ist mitunter zu hoch, weshalb sich Mehrarbeiten bei einem Transferanspruch häufig nicht lohnt. Das hat dann aber direkt wieder mehrere Ebenen.
Und zwar?
Von Anrechnungsregeln kommt man schnell zu Bürokratie und Sanktionen. Viele Arbeitsvermittler sind nur mit der Berechnung von Ansprüchen beschäftigt und nicht mit ihrer eigentlichen Job-Beschreibung: der Vermittlung von Arbeitsplätzen. Mit Unterstützung und Vermittlung lassen sich Geflüchtete aber deutlich besser in den Arbeitsmarkt integrieren als durch Sanktionen. Nichtdestotrotz müssen wir uns fragen, warum Geflüchtete in anderen Ländern deutlich schneller im Arbeitsmarkt integriert sind.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
In Dänemark beispielsweise, wo relativ betrachtet doppelt so viele Ukrainer arbeiten wie in Deutschland, wird in Firmen häufiger Englisch gesprochen. Außerdem gibt es weniger Kündigungsschutz und Arbeitnehmerbeteiligung als in Deutschland. Das größte Problem ist aber die Anerkennung von Qualifikationen. Da gibt es absurde bürokratische Hürden in Deutschland.
Kurz gesagt: Das Problem ist die Bürokratie, nicht die Anreizstruktur selbst?
Ja, wobei die Anreize leider so sind, dass sich nur ein bisschen Arbeiten lohnt – etwa in Minijobs. Wenn ich nach einer gewissen Freigrenze nur noch 20 Prozent meines Gehalts behalten darf, arbeite ich nur noch bis zu dieser Freigrenze und lass mir den Rest als Transfer auszahlen. Das System setzt im Gegenteil sogar den Anreiz, schwarz zu arbeiten. Das taucht dann in der Statistik nicht auf. Viele beziehen also Bürgergeld und arbeiten schwarz auf der Baustelle oder als Putzkraft. Dagegen wird aus meiner Sicht zu wenig getan. Stattdessen kämpfen wir mit der Bürokratie.
Trotzdem wäre das ja ein Punkt, um Mehreinnahmen und gleichzeitig Einsparungen zu erzielen?
Ja natürlich, aber eher langfristig. Sanktionen und Anreize für Arbeitslose füllen nicht annähernd das Haushaltsloch von 17 Mrd. Euro.
Wie würden Sie denn das Loch füllen?
Die wichtigste Frage muss vorab lauten: Was kann ich machen, ohne dass ich Wachstumskräfte bremse? Es gibt Möglichkeiten, die Transferentzugsraten zu senken, sodass Menschen mehr Einkommen durch Arbeit erzielen. Das würde die Ausgabeseite des Staates reduzieren und die Einnahmen erhöhen. Bei den Einnahmen würde ich die zahlreichen Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer radikal beschränken – vielleicht sogar die gesamte Mehrwertsteuer um ein oder zwei Prozentpunkte anheben. Da sind wir im EU-Durchschnitt noch moderat unterwegs. Zweitens würde ich an die Einkommenssteuer gehen – und schauen, was man alles absetzen darf und ob manche sogenannte klimaschädliche Subvention wirklich notwendig ist. Das würde vielleicht sogar den Spielraum für selbstfinanzierende Steuersatzsenkungen ermöglichen. Und drittens würde ich einige Rentengeschenke der vergangenen Jahre zurücknehmen. Wir müssen uns der Realität stellen, dass Menschen immer älter werden. Also müssen wir auch länger arbeiten.