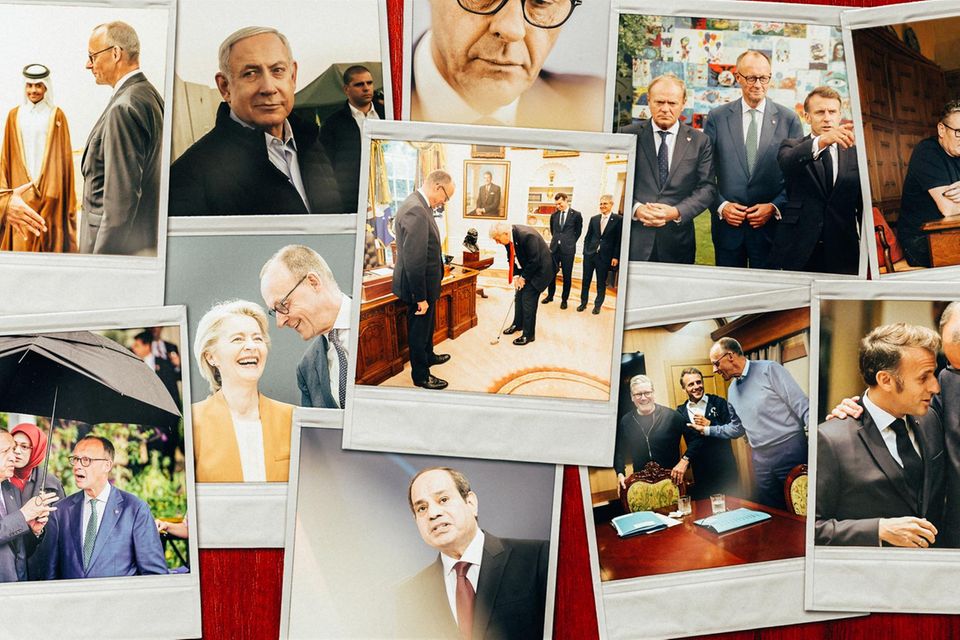Seit dem 2. August dieses Jahres führt kein Weg daran vorbei – zumindest auf dem Papier. Berater sind nun dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden in Sachen Geldanlage abzufragen. Diese Abfrage ist fester Bestandteil der sogenannten Insurance Distribution Directive (IDD). Doch drei Monate nach ihrer Einführung ist das Fazit ernüchternd: Laut einer gemeinsamen Analyse der Beratungsgesellschaft EY und dem Software-Unternehmen Bao versäumen 78 Prozent der Vermittler, im Beratungsgespräch auf die Nachhaltigkeitsvorlieben ihrer Kunden einzugehen. Woran liegt das und wie müsste die Abfrage in der Praxis eigentlich ablaufen?
„Der benötigte Inhalt und Umfang der Präferenzabfrage ist in der IDD festgelegt und der Türöffner für den weiteren Gesprächsverlauf im ESG-Beratungsprozess“, sagt Patrick Pfalzgraf, Partner bei EY EMEIA Financial Services. Eine Orientierungshilfe sind Fragebögen wie das ESG-Modul zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen, das der DIN-Ausschuss „Finanzdienstleistungen für Privathaushalte“ verabschiedet hat. Es ist Teil der DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, kann aber auch separat angewendet werden. Den Fragebogen stellt das Defino Institut für Finanznorm auf seiner Website Beratern zur Verfügung. Die erklärten Ziele: die Präferenz-Abfrage zu strukturieren und einen zielgerichteten, einfachen Abfrageprozess zu ermöglichen, der auch als Dokumentationsnachweis dient.
Informationen darüber, wie und vor allem was Berater abfragen sollten, sind also grundsätzlich vorhanden. Trotzdem spielt ESG in vier von fünf Fällen keine Rolle. Die EY-Experten führten im Rahmen ihrer „Mystery-Shopping-Studie“ insgesamt 85 telefonische und Online-Beratungsgespräche mit Vermittlern von 13 Versicherungen durch. Ihr Hauptaugenmerkt lag dabei auf der Beratungsqualität im Bereich nachhaltiger Geldanlage. Die enttäuschende Erkenntnis: In 95 Prozent der Gespräche wurde der Wissensstand zum Thema Nachhaltigkeit nicht abgefragt, 65 Prozent der zugesandten Unterlagen enthielten keinerlei Informationen zu nachhaltigen Produkten. „Nachhaltigkeit wird, offenbar aus verschiedenen Gründen, eher vermieden“, sagt Pfalzgraf. „Dass ein Großteil der Branche ein geltendes Gesetz nicht einhält, ist aber sicherlich kein Vorsatz.“
Doch woran liegt es dann? Ein großes Problem für viele Berater scheint die Tatsache, dass es für ESG-Kriterien noch immer keine offiziellen, einheitliche Definitionen gibt. In der Finanzwelt hat sich das Kürzel zwar allgemein für die Bereiche Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G) etabliert. Was die einzelnen Punkte im Detail meinen, ist jedoch nicht immer ganz klar. Was genau heißt nachhaltiges Wirtschaften, was gute Unternehmensführung? Wer sich im Beratungsgespräch nicht in die Bredouille bringen lassen möchte, muss wohl überlegt formulieren.
Wissenslücken bei den Vermittlern
Der DIN-Ausschuss schlägt folgende Frage zum Einstieg vor: „Benötigen Sie grundsätzliche Informationen über die Nachhaltigkeitsziele der Europäischen Union bei der Geld- und Kapitalanlage sowie über die Möglichkeit, Nachhaltigkeitspräferenzen zu formulieren?“ Lautet die Antwort ja, so finden Berater im Online-Katalog von der DIN vorgeschlagene Erläuterungen zu den Nachhaltigkeitszielen der EU, dem Green Deal und der EU-Taxonomie.
Ist das grüne Vorwissen vorhanden, geht es als nächstes um den Kern der Sache: Soll das Thema Nachhaltigkeit bei der eigenen Geldanlage berücksichtig werden? Lautet die Antwort nein, so haben Berater ihre Pflicht zur Nachhaltigkeitsabfrage damit bereits erfüllt. Bei einem Ja müssen die Vermittler das „Was“ und „Wie“ ermitteln, inhaltliche Schwerpunkte setzen und Prioritäten erarbeiten. Auch hierbei hilft der DIN-Katalog: Welcher Mindestanteil soll in Umweltziele (E), welcher in soziale Ziele (S) fließen? Sollen Investments ausschließlich in nachhaltige Unternehmen erfolgen? Welche Einzelthemen sind den Anlegern wichtig? Und welche Bereiche sollen aus dem Investment vollständig ausgeschlossen werden?
„Wenn es keine ESG-konformen Anlageprodukte zu vertreiben gibt oder der Anbieter keine entsprechende Klassifizierung vorgenommen hat, hängen die Vermittler natürlich in der Luft“, merkt Pfalzgraf noch an. Die Gesamtproblematik geht allerdings tiefer. Häufig seien die Kenntnisse auf der Vermittlerseite für eine dezidierte Nachhaltigkeitsberatung noch nicht ausreichend vorhanden. Eine kurzfristige Lösung sei die Etablierung von Nachhaltigkeits-Kompetenz-Centern. „An Nachhaltigkeit interessierte Kundinnen und Kunden können so an spezialisierte Vertriebseinheiten oder zertifizierte Nachhaltigkeitsberater in der jeweiligen Organisation geleitet werden“, sagt Pfalzgraf. „Mittelfristig führt jedoch an der intensiven und wiederkehrenden Schulung des gesamten Vermittlungspersonals kein Weg vorbei.“