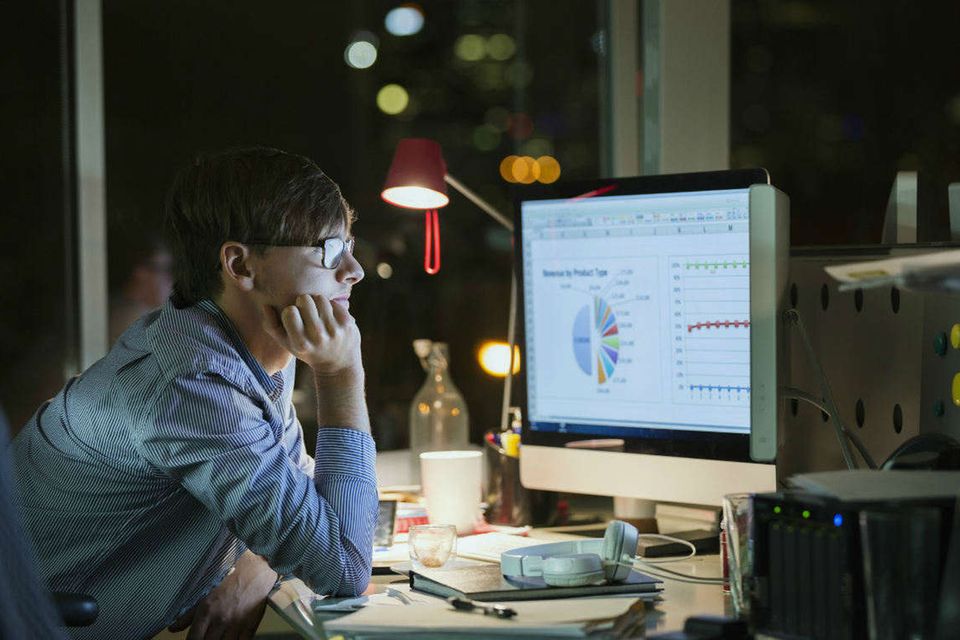Auf den ersten Blick hat die Corona-Krise an den Märkten auch etwas Positives bewirkt, auch wenn es nur minimal ist: Die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld sind ein ganz klein wenig geklettert. Beim Tagesgeld gibt es jetzt wieder Institute, die 0,6 Prozent zahlen. Und Festgeldanbieter lassen sich sogar wieder zu Zinssätzen von 1,1 Prozent hinreißen, wenn man für zwölf Monate Geld bei ihnen parkt. Das sind aber beides auch die absolut obersten Enden der Zinsspannen. Es gibt noch genügend Banken, die weiter 0,0 Prozent Zinsen zahlen.
Dennoch ließ der winzige Anstieg bei einigen Kunden und auch bei manchen Medien die Hoffnung aufkeimen, dass es nun ausgerechnet durch Corona wieder aufwärts gehen könnte – zumindest bei den Zinsen. Warum das so sein sollte? Weil die Staaten und Notenbanken zur Abwehr der schlimmsten Krisenfolgen gerade immens viel Geld auf den Markt werfen. Man könnte auch sagen: Weil sie Geld drucken. Das werde unweigerlich zur Geldentwertung führen, also zu mehr Inflation und somit zu steigenden Zinsen. Oder?
Um das Ungute gleich vorweg zu sagen: Man weiß es nicht. Zumindest lässt sich diese Frage derzeit ebenso wenig beantworten wie die, wann diese Krise wohl vorüber sein wird. Es gibt sowohl Top-Ökonomen, die fest davon ausgehen, dass es so kommen wird als auch Top-Ökonomen, die genau vom Gegenteil überzeugt sind. Die glauben, dass die Zinsen noch für eine sehr lange Zeit niedrig bleiben werden – jetzt erst recht. Und für beide Annahmen gibt es gute Begründungen.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden
Die Seite, die an höhere Zinsen und eine anziehende Inflation glaubt, begründet es damit, dass sich viele Staaten zurzeit rekordverdächtige Schulden aufladen. Schulden, die dadurch zustande kommen, dass sie neue Anleihen ausgeben, mit denen sie sich Geld von Investoren besorgen. Während die Notenbanken die Märkte mit enormer Liquidität fluten, was die Geldmenge insgesamt vergrößert und während sie zudem solche Staatspapiere in immer größerem Maße aufkaufen. Womöglich wird mancher Staat mit diesen neuen Schulden an die Grenze seiner Tragfähigkeit gelangen.
Nach 2008 kamen die Zinsen nicht wieder
Was wird also passieren? Er wird die Schulden weginflationieren. Er wird sie mit der Ausgabe von immer mehr neuem Geld versuchen, zu bezahlen. Also müssten die Zinsen steigen. Soweit so logisch und es gibt auch viele gute Beispiele in der Geschichte, wo es genau so funktioniert hat. Die Hyperinflation zu Beginn des letzten Jahrhunderts war ja genau so ein Fall. Es könnte aber auch ganz anders kommen.
Denn, so sagt die Gegenseite, wenn es zu einer großen Wirtschaftskrise durch Corona kommt, dann würde das zuerst einmal dazu führen, dass viele Privatleute ihr Geld horten. Es gibt eine große Sparschwemme, so nennen sie das. Zudem würden die Zentralbanken alles daran setzen, die Renditen von Anleihen – und damit auch die Staatsschulden – unter Kontrolle zu behalten. Sie würden also die Renditekurve dementsprechend einbremsen, wie sie es bereits in den vergangenen Jahren getan haben.
Der Effekt davon könnte sein, dass es eben keinen Anstieg der Inflation und Zinsen gibt. Genau wie in den vergangenen Jahren auch. Denn auch nach der Finanzkrise von 2008 und spätestens bei den geschnürten Milliarden-Hilfspaketen der Eurokrise hatten viele Ökonomen vor einer anziehenden Inflation gewarnt. Passiert ist seitdem ... nichts. Zumindest eher das Gegenteil: Die Zinsen sind weg. Und es könnte sein, dass es noch lange, ja sogar sehr lange so bleibt.
„Die Zinsen werden noch sehr lange niedrig bleiben“
Wenn es wirklich so käme, dann könnten die Nullkommanullprozent, die aktuell von der Europäischen Zentralbank als Leitzins ausgegeben worden sind, zum neuen Normalnull der Finanzbranche werden. Mit allen Folgen, die das für Anleihenrenditen, Tagesgeldzinsen aber auch Baufinanzierungen hätte. Aber wie wahrscheinlich ist das nun?
Um das auszuloten haben Wirtschaftswissenschaftler und die Forschungsabteilungen von Zentralbanken weit in die Vergangenheit geschaut. 700 Jahre weit, so lange haben sie zurückverfolgt, wie sich die Zinsen der Welt jeweils entwickelten, wenn Länder von großen Pandemien heimgesucht wurden. Und sie haben ebenfalls verglichen, wie sich die Zinsen in Zeiten von Kriegen verhielten. Die Auswertungen verleiten zumindest einen der weltgrößten Anleiheverwalter, die Assetmanagementgesellschaft Pimco, zu der Aussage: „Die Zinsen werden noch sehr lange niedrig bleiben“, lautet das Fazit von Pimco-Berater Joachim Fels.
Die Auswertungen von 700 Jahren Wirtschaftsgeschichte ergeben nämlich regelmäßig einen größeren Zinsschwund nach Pandemien und anschließenden Rezessionen: Demnach kam es nach großen Seuchen wie Pest, Cholera und auch nach der Spanischen Grippe – die alle eine nennenswerte Zahl von Opfern forderten und damit die Wirtschaft abwürgten – stets zu einem größeren Zinseinbruch. Im Mittel sackten die Zinsen um 1,5 Prozentpunkte ab, im besten Fall nur um einen Prozentpunkt, in schlimmen Fällen aber sogar um 2,5 Prozentpunkte.
Die Pandemie führt zu Gehaltseinbußen
Das passierte aber nicht sofort. In den ersten Jahren unmittelbar nach der Krankheit stiegen die Zinsen zunächst leicht an. Doch rund 10 bis 25 Jahre nach der Pandemie erreichten sie ihren Tiefsstand. In den Nachkrisenjahren 25 bis 40 waren sie dann damit beschäftigt, sich wieder bis auf das Vorkrisenniveau zurückzuarbeiten. Das würde bedeuten: Der jetzige Nullzins könnte noch einer ganzen Generation von Anlegern und Altersvorsorgesparern erhalten bleiben.
Doch warum kam es bisher immer nach Pandemien zu einem großen Rückgang? Weil es bisher ein ganz klassisches Muster in solchen Pandemie-Rezessionen war, dass die Bevölkerung an ihre finanziellen Reserven gehen musste, um Krankheit und Krise durchzustehen. So wie es auch jetzt viele müssen, wenn sie in Kurzarbeit sind und dadurch Einkommenseinbußen erleiden. Oder wenn sie ihre Geschäfte ganz schließen mussten wegen der Corona-Auflagen der Regierungen. Nach der Krise sind viele Bürger also erst einmal damit beschäftigt, ihre Finanzpuffer wieder aufzufüllen, aufgezehrtes Vermögen wieder anzuhäufen und mehr zu sparen. Das bremst den Konsum und kann daher auch die nicht zu einem nennenswerten Preisanstieg führen.
Zudem kosteten frühere Pandemien nicht nur viele Menschenleben, sondern sie dezimierten auch einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung. Es gab weniger Arbeiter auf den Feldern oder in den Fabriken. Deshalb stiegen zumindest die Löhne ein wenig an, je nachdem wie groß der Schwund an Arbeitern jeweils war. Doch auch, wenn die Weiterarbeitenden danach etwas mehr Geld zur Verfügung hatten: Es waren mit der Krise viele Investmentalternativen weggefallen. Die Menschen konnten mit dem Geld daher gar nichts Großartiges anfangen, als es zu sparen.
Das alles hieß: Es gab zwar viel Geld in der Welt, aber kaum jemand wollte es ausgeben, also kurbelte es auch nicht die Wirtschaft an. Woher sollte da die Inflation kommen?
Extremereignisse schlagen immer weniger durch
Auch nach Finanzkrisen drückten Rezessionen oft die Zinsen. Jedoch weitaus nicht so lange. Sondern nur für rund fünf bis zehn Jahre, so wie wir es nach der Finanzkrise von 2008 auch gesehen haben. Nicht aber für jene 25 bis 40 Jahre, die nach den Pandemiewellen als Zinstiefzeiten üblich waren.
Nun erkennt man im Langfristvergleich ebenfalls, dass das Zinsniveau insgesamt auch deutlich nach unten sackte: Von rund 10 Prozent im Jahr 1400 fiel es auf rund 5 Prozent in Zeiten der industriellen Revolution und auf wenige Prozent im 20. Jahrhundert, bis es schließlich bei den heutigen null Prozent landete.
Und ebenso nahm die Heftigkeit der Ausschläge ab bei den Zinsen. Extremereignisse schlugen daher im Laufe der Jahrhunderte immer weniger durch. Das verdankt die Menschheit dem Fortschritt, der Extremereignisse wie Dürren, Missernten, Naturkatastrophen und Kriege seltener werden ließ oder ihre Folgen etwas einzudämmen vermochte. Das lässt wenigstens hoffen, dass der Zinsknick diesmal nicht ganz so heftig ausschlägt, wie er es in der Vergangenheit möglich war.
Apropos Kriege, ... man könnte nun entgegnen: Wieso aber galoppierte die Inflation dann regelmäßig nach Kriegen davon? Auch die wurden ja durch die Ausgabe von neuen Staatsschulden finanziert. Also durch die massive Ausweitung der Geldmenge. Und auch sie vernichteten ja viele Menschenleben und Arbeitskräfte. Doch sie führten eher dazu, dass die Bürger danach den Konsum kräftig ankurbelten. Warum? Weil die Kriege nicht nur die Zahl der Arbeitskräfte reduziert hatten, sondern auch große materielle Schäden hinterließen: Häuser mussten neu gebaut werden, Maschinen und Fabriken ebenso. Deshalb sparten viel weniger Menschen ihr Geld, sie mussten es notgedrungen für den Wiederaufbau ausgeben. Genau das ist der große Unterschied.
Löhne sind diesmal weniger betroffen
Ein großes Gegenargument zählt nun aber doch: In früheren Pandemien starben viele Leute „in der Mitte des Lebens“. Eben das ließ ja die Zahl der Arbeitsbevölkerung so schrumpfen. Die Corona-Epidemie aber fordert eher unter den Älteren viele Opfer. Von daher dürfte sie die Zahl der Arbeitskräfte weniger beeinflussen. Die Löhne damit auch weniger als es früher der Fall war. Die Lohnsteigerungen nach Pandemien früherer Jahrhunderte waren zwar nie groß, aber dennoch statistisch signifikant, sagen die Forscher.
Zwar wird es auch nach Corona der Fall sein, dass viele Bürger zunächst einmal ihre Finanzpuffer auffüllen werden – und daher nicht sparen. Und die Zahl der Investmentmöglichkeiten wird ebenfalls beschränkt sein, wenn die üblichen – und zumindest hierzulande heißgeliebten – Zinsbringer wegfallen, wie Tagesgeld, Bankeinlagen oder Bundesanleihen und auch die kapitalbildenden Versicherungen. Weil das alles dann noch unattraktiver wird als derzeit schon.
Doch genau dieser Punkt ist derzeit die große Unbekannte: Der Fakt nämlich, dass die jungen Generationen viel weniger vom Virus betroffen sind und deshalb viel weniger stark dezimiert sein werden als in früheren Seuchenwellen. Wenn man so will, bleibt das als einzige Hoffnung. Darauf, dass es dieses Mal doch anders kommen könnte. Dass diesmal der Konsum schneller wieder voll anspringen wird – und die Zinsen dann doch in die Höhe treiben wird. Womöglich ist diesmal alles anders. Das allerdings haben bisher schon viele Generationen von Krisengebeutelten wieder und wieder gehofft.