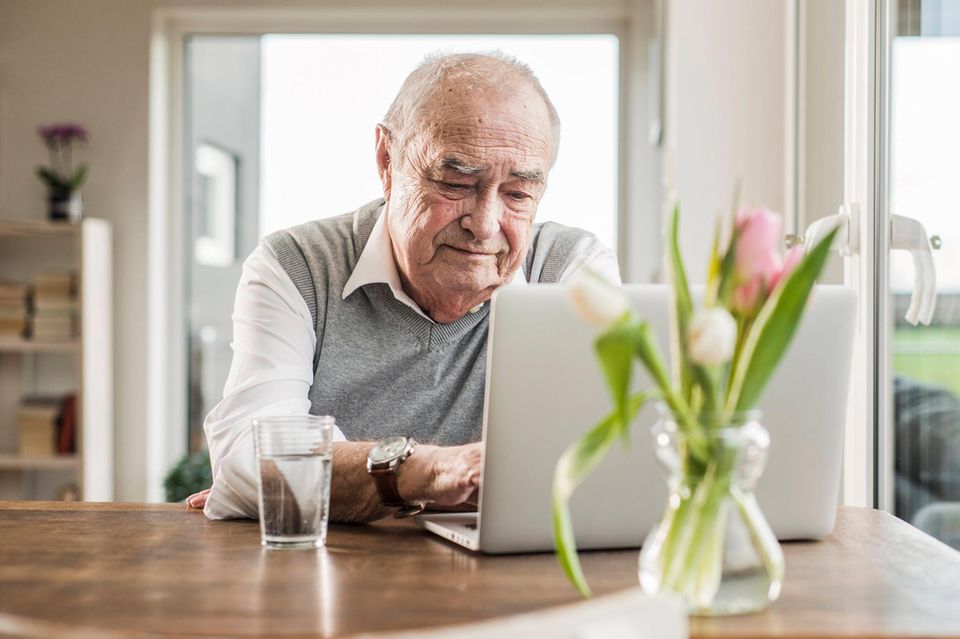Bei den Republikanern riecht es nach Frittierfett und Puderzucker. Gegenüber dem Zelt der Partei gibt es Donuts, daneben stehen die Menschen Schlange vor der Bratwurstbude. Es ist Volksfest in Ohio, und die Republikaner sind neuerdings die Partei des Volkes hier. Es ist ein pausenloses Kommen und Gehen in dem Parteizelt, Menschen schütteln sich gegenseitig die Hände, klopfen auf Rücken, tragen sich auf E-Mail-Listen ein, verteilen Flyer, kaufen T-Shirts, Anstecknadeln und Kappen, auf denen steht: „Make America Great Again“. Das Sternenbanner flattert munter über dem Zeltdach.
Mark Munroe sitzt auf einem Plastikstuhl vor dem Eingang und begrüßt jeden, der kommt. „Komm rein, hier ist jeder willkommen“, sagt der Ortsverbandsvorsitzende. „Hast du schon unsere neuen T-Shirts -gesehen?“ Munroe hat eine bunte Sammlung mit Slogans im Angebot. „Trump 2020 – The Perfect Union“ steht auf dem einen, „I love Trump“ auf dem anderen. Auf dem nächsten ist ein grinsender, kleiner Comic-Trump zu sehen, der in hohem Bogen auf ein Logo des Nachrichtensenders CNN pinkelt. „Den mag ich am liebsten“, sagt Munroe.
Munroe ist seit Jahrzehnten Republikaner, und die längste Zeit davon war er ziemlich einsam mit seinem Parteibuch hier in Mahoning County im Bundesstaat Ohio. Mitten in seinem Wahlkreis liegt die Stadt Youngstown, einst das Herz der US-Stahlindustrie, nun das Zentrum des sogenannten Rostgürtels, des alten Industriegebiets im Nordosten der USA. Hier leben Menschen, die an Gewerkschaften, Arbeiterrechte und guten Lohn für harte Arbeit glauben und deren Väter und Mütter, Großväter und Großmütter schon die Demokratische Partei gewählt haben. Munroe konnte es selbst erst nicht so recht glauben, als diese Menschen plötzlich in seinem Parteibüro auftauchten und helfen wollten beim Wahlkampf für Trump. „So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen“, sagt der 67-Jährige. „Es ist eine Bewegung. Eine starke, unaufhaltsame Bewegung.“
Donald Trump hat diese Bewegung losgetreten. Viele der Menschen hier zögern, sich als Republikaner zu bezeichnen, obwohl sie die Partei gewählt haben. Sie nennen sich Trump-Anhänger, und es klingt ein wenig nach einer Religion, Trump ist ihr Messias. „Donald Trump ist genau, worauf wir hier gewartet haben“, sagt Munroe. „Er bringt endlich die Veränderung, die wir uns seit Ewigkeiten wünschen.“
Zeit für einen neuen Besuch
Capital hatte Youngstown und Trumps Anhänger vor einem Jahr besucht , kurz vor der Präsidentschaftswahl im November. Youngstown war eine Stadt, die seit Jahrzehnten im Niedergang steckte und in der die Menschen ihre Hoffnung verloren hatten. Alles Gute lag für sie in der Vergangenheit, vor der Zukunft hatten sie Angst. Bis Trump kam und ihnen neue Hoffnung gab. Jetzt ist ihr Mann seit einem Jahr im Weißen Haus. Zeit für einen neuen Besuch im zerrissenen Herzen der USA.
Die Bewegung ist stärker und lauter als vor einem Jahr. Die Lager haben sich nicht versöhnt. Der Konflikt, der die USA spaltet, löst sich nicht auf. Er wird schärfer.
Hier, außerhalb von Youngstowns Stadtgrenzen, in den weißen Mittelklassevororten des Wahlkreises, ist Trump-Land. Auch ein Jahr nach der großen Wahl. In manchen Vorgärten haben sie die Wahlschilder stecken lassen: „Trump 2016“ steht da in Großbuchstaben Weiß auf Blau. Es ist nicht mehr als Aufruf gemeint, sondern als Jubelschrei. In den Vororten wehen so viele Sternenbanner vor den Haustüren wie nie zuvor. Und ab und zu ist auch die Konföderiertenfahne zu sehen, einst Symbol der Südstaaten, inzwischen steht sie für viel mehr – für eine Rückkehr zum Amerika der Starken, der Eroberer und vor allem: der Weißen. Für viele Menschen hier in Ohio, einem Bundesstaat, der im Bürgerkrieg gegen die Konföderierten kämpfte, steht die Flagge für das Gleiche, was auf ihren roten Kappen steht: Make America Great Again.
Trump weiß, dass seine treuesten Anhänger in Ohio wohnen. Vor einem Jahr ist er extra angereist zu dem Volksfest in Canfield, einem der größten Vororte von Youngstown. Die Schwarzen nennen ihn „Clanfield“, „Clan“ wie in Ku-Klux-Klan. Weil hier so viele Weiße wohnen, die gern unter sich bleiben. Munroe war aufgeregt, seinen Kandidaten zu treffen. „Er stand genau hier, genau auf diesem Fleck“, sagt der Chef der Republikaner in Mahoning County. Die Leute haben Trump zugejubelt, alle wollten ein Autogramm oder ein Foto mit dem Kandidaten. Der Secret Service war nicht begeistert. „Es war unglaublich, so eine Menschenmenge haben wir hier noch nie gesehen“, sagt Munroe und klingt ein wenig wie sein Präsident selbst. „Die Massen gingen, so weit das Auge reichte“, sagt Munroe.
Ein Jahr später laufen die Menschen noch immer mit den Make-America-Great-Again-Kappen herum. Munroe verkauft sie eifrig. „Der Enthusiasmus ist keinen Deut geringer geworden“, sagt er, „ich habe das Gefühl, er wird immer stärker.“ Darum machen auch so viele Leute auf dem Weg vom Riesenrad zum Riesenkürbiswettbewerb halt im Zelt der Republikaner.
Munroe hat noch niemanden getroffen, der enttäuscht ist von Trump oder der die Entscheidung bereut, nach Jahren als Demokrat für Trump gestimmt zu haben. „Oder wie siehst du das, Dan?“, fragt er und schaut hinüber zu Dan Madden, der in Youngstown als Bestatter arbeitet. „Er hat mehr geleistet als alle anderen Präsidenten vor ihm. Sieht doch jeder, die Aktienmärkte boomen“, sagt der 38-Jährige. „Die Mainstreammedien schreiben halt nicht über seine Erfolge.“
„Und du, du bist auch nicht enttäuscht, oder, Paul?“, sagt Munroe zu Paul Lyden. Lyden reckt die Daumen in die Höhe und lacht schallend. Er ist groß, breit und bärtig und hat einen Händedruck wie ein Schraubstock. Der 56-Jährige hat nicht bloß ein kleines Trump-Schild in seinen Vorgarten gerammt, er hievt ein meterhohes Zeichen mit einem Kran in die Luft über dem Grundstück seiner Schmierstoff-Firma Lyden Oil. „Im Moment ziehe ich es nur hoch, wenn Bedarf ist“, sagt Lyden. „Also wenn wieder irgendwer unseren Präsidenten Donald J. Trump attackiert. Passiert dauernd. Ich lese das ja nicht mehr. Alles Fake News.“
Lyden und die vielen anderen rotbemützten Trump-Anhänger hier rücken immer weiter nach rechts – und merken es oft gar nicht. Weil sie glauben, dass alle Menschen, die anders denken als sie, ohnehin lügen. Vor allem die Medien. Der Graben durch Amerika wird tiefer und tiefer.
Schuld sind die anderen
„Trump sagt, was er denkt. Er ist nicht immer so verdammt politisch korrekt. Ich mag seinen Stil“, sagt Lyden. „Klar, er hat Fehler. Aber die habe ich auch. Zeig mir einen Geschäftsmann, der keine Fehler hat.“ Trump wolle die gleichen Dinge wie er: weniger Steuern, weniger Regulierung, mehr Jobs, mehr Energie aus Amerika, ein starkes Militär, ein starkes Amerika. Ja, sagt Lyden, Trump hat noch nicht so viel erreicht, wie er sich das gewünscht hat. „Aber es ist nicht seine Schuld, er hat die Medien und den Kongress gegen sich. Wir müssen geduldig sein.“ Immerhin hat Trump ein paar Umweltauflagen für die Energiebranche kassiert und ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, das gefiel Lyden.
Lydens Firma ist 98 Jahre alt, ein Familienbetrieb. Sie hat harte Zeiten überstanden. „Ich war hier an unserem Black Monday, ich habe die Männer weinen sehen“, sagt Lyden. „Politiker haben doch seit Jahrzehnten auf uns geschissen hier, sorry für das Wort, aber es stimmt doch. Trump sind wir nicht egal.“
Am Black Monday, dem 19. September 1977, hat das Stahlwerk Youngstown Iron Sheet and Tube Company dicht gemacht. 5000 Arbeiter verloren an diesem einen Tag ihre Stelle. Binnen weniger Jahre, zwischen 1977 und den späten 80er-Jahren, verschwanden in den Stahlwerken der Stadt 50.000 Jobs. 1930 lebten 170.000 Menschen in Youngstown, heute sind es nur noch 64.000.
Lydens Schmierstoffunternehmen hat die Krise überlebt, auch wenn immer weniger Firmen seine Ölprodukte kaufen. Die Finanzkrise hat ihn noch einmal hart getroffen. Er hat am Grab seines Vaters gebetet, als er Leute entlassen musste. Jetzt geht es wieder aufwärts, weil Trump ein Freund der Ölwirtschaft ist, glaubt Lyden. „Wir sind Kämpfer, wir arbeiten hart“, sagt er. „Sehen Sie!“ Er zeigt seine Handflächen vor, sie sind voller Risse und Schwielen. „Und jetzt haben wir einen Präsidenten, der mit uns kämpft und für uns kämpft. Für Amerika.“
Natürlich sieht nicht ganz Amerika das so wie Lyden, im Gegenteil. Die Zahl der Menschen, die mit Trump zufrieden sind, sinkt seit seinem Amtsantritt, sie liegt nur noch bei 39 Prozent. Doch das Besondere ist, dass die Leute, die mit Trump zufrieden sind, extrem zufrieden sind. Eine Umfrage kam neulich zu dem Ergebnis, dass gigantische 98 Prozent der Menschen, die bei den Vorwahlen für Trump gestimmt haben, mit ihm noch immer einverstanden sind. Solche Quoten gab es noch nie. Andererseits sind nur noch zwei Drittel der Republikaner, die bei den Vorwahlen andere Kandidaten unterstützten, auf seiner Seite. Laut der Umfrage schämen sich einige Menschen sogar, bei den Vorwahlen Trump gewählt zu haben. Nur noch 39 Prozent gaben zu, dem Präsidenten ihre Stimme gegeben zu haben. Er hat aber gut 45 Prozent der Stimmen gewonnen: ein deutliches Zeichen, dass die Zustimmung sogar in seiner Partei schrumpft. Aber nicht bei seinen Hardcore-Fans in Ohio.
Maria Megia weiß, wie es mit den Fans ist, wenn man nicht so aussieht, wie sie es sich vorstellen. Megia stammt aus El Salvador und arbeitet im Restaurant El Jalapeño in Austintown, einem Vorort von Youngstown. „Es gibt immer mehr Unfreundlichkeit“, sagt die 37-Jährige. „Man könnte auch sagen: Rassismus.“
Neulich beschwerte sich ein Gast lautstark, dass außer als Kindergericht keine Hamburger und Sandwiches auf der Karte stehen. „Natürlich nicht, wir sind ein Latino-Restaurant, ist ja wohl klar“, sagt Megia und zuckt mit den Schultern. Im El Jalapeño spielt Mariachi-Musik, auf dem Schild am Eingang steht „authentische mexikanische Küche“, auf Megias T-Shirt lacht eine schnurrbärtige Chilischote samt Sombrero. „Ihr seid jetzt hier, macht verdammt noch mal amerikanisches Essen“, rief der Gast, bestellte dann aber trotzdem etwas bei ihr, ohne sie je anzusehen, ohne „bitte“ und „danke“. Dann weigerte er sich, zu essen und zu bezahlen, diskutierte mit seinem Freund darüber, dass die Mexikaner den Leuten die Jobs wegnehmen. So laut, dass es alle im Restaurant hören konnten, erzählt Megia, die schon vor 16 Jahren nach Ohio gezogen ist.
„So etwas kommt jetzt häufiger vor. Weil Trump uns ja auch so sieht“, sagt Megia. Seit der Wahl haben sich die Regeln des öffentlichen Zusammenlebens radikal verändert. Rassisten verstecken sich nicht mehr.
Der einsame Bürgermeister
John McNally versteht sie nicht: die Wut auf die Einwanderer aus Lateinamerika. McNally ist der Bürgermeister von Youngstown, ein Demokrat. „Wir haben hier doch kaum Mexikaner“, sagt er. „Und den Mexikaner, der hier jemandem den Job weggenommen hat, muss man mir erst mal zeigen. Es gibt doch gar keine Jobs, die jemand wegnehmen könnte.“ McNally kann die Logik der Trump-Anhänger oft nicht nachvollziehen, aber er kann das Gefühl verstehen, das die Menschen zu Trump lockt. Es ist das Gefühl, das die Menschen hier bekommen, wenn jemand sagt, dass er Amerika wieder great machen will. „So wie damals eben, als die Arbeiter in den Stahlwerken noch genug verdient haben, um ihre Kids zum College zu schicken. Aber die Zeiten sind vorbei. Der Stahl kommt nicht zurück“, sagt McNally.
Und dann sagt er einen Satz, den man nicht so schnell vergisst: „Die Leute wollen Trumps Lügen glauben.“ Und je mehr sie sie glauben, desto weiter entfernen sie sich von der Realität. Desto unversöhnlicher werden links und rechts.
McNally ist früh aufgestanden heute Morgen, es gibt mal etwas Positives in Youngstown. 800 Freiwillige treffen sich in aller Frühe in der East Side der Stadt, sie tragen Arbeitshandschuhe und neongrüne T-Shirts mit der Aufschrift „Day of Caring“. Ihre Arbeitgeber haben ihnen einen Tag freigegeben, um in der East Side aufzuräumen. McNally feuert sie an, geht von einem Grüppchen, das Gestrüpp um ein Abrisshaus absägt, zum nächsten Grüppchen, das mit Mülltüten die Vorgärten säubert, und weiter zum nächsten, das mit Rechen und Schaufeln das Unkraut aus den Rissen im Gehweg reißt. Er klopft einem jungen Mann auf den Rücken. „Es ist so toll, dass ihr mitmacht“, sagt er.
„Früher, in den guten Zeiten, stand hier ein Haus ordentlich neben dem anderen, hier lebte die Mittelschicht“, sagt McNally. Die East Side ist keine gute Gegend, nachts möchte man hier nicht unterwegs sein. Die Stadtverwaltung hat Hunderte leer stehende Häuser abgerissen. Die Abbrissbagger zu den verfallenen Häuser zu schicken, in denen nur noch Ratten und Drogendealer hausen, ist eine der größten Aufgaben für McNally. 518 Häuser hat er im Jahr 2016 abreißen lassen, dieses Jahr sollen es noch mehr werden. „Es gibt immer noch so viele Häuser, die wegmüssen. So, so, so viele“, sagt McNally. Nirgends gibt es eine so hohe Zahl Brandstiftungen wie in Youngstown, weil Feuerteufel es lustig finden, die leeren Häuser abzufackeln. Der Begriff, den McNally am häufigsten benutzt, ist urban blight, städtische Verödung, er sagt ihn über fast jede Straße in der East Side. Die South Side ist genauso schlimm.
Ein Unternehmer aus Kalifornien will in der Stadt, direkt in der East Side, eine große Abfüllanlage für Getränkedosen bauen, die 240 Jobs schaffen soll, das Gelände steht schon bereit. Der Youngstown Business Incubator, die Start-up-Schmiede in der Innenstadt, expandiert. Die Baustelle für das neue Hotel in der Nähe schreitet voran. Doch für jede gute Nachricht gibt es eine schlechte. Der Bürgermeister sucht schon seit Jahren und hat noch immer niemanden gefunden, der einen Supermarkt eröffnen will. Um Lebensmittel zu kaufen, muss man entweder in die Vororte fahren oder sich mit Fertiggerichten von der Tankstelle begnügen. Der alte Diner Golden Dawn, seit 1932 einer der Treffpunkte der Stadt, hat zugemacht. Genauso wie der Coffeeshop mit den Fair-Trade-Bohnen in Downtown. Vallourec, das einzige Stahlwerk, das noch wächst, stellt ab und zu ein paar Leute ein – doch es fehlen Tausende Jobs.
Gespaltene Familien
McNally lässt die Freiwilligen allein die East Side aufräumen und macht sich auf den Weg zum Volksfest in Canfield. Er fährt über die Stadtgrenze hinaus in die Vororte, sofort ist der Straßenbelag besser, es gibt keine Schlaglöcher mehr. Es gibt eine Shell-Tankstelle, einen Supermarkt, eine große Drogerie, einen Dunkin’ Donuts, eine Drive-in-Bank. „Die zahlen jetzt alle außerhalb von Youngstown Steuern“, sagt McNally.
Der Bürgermeister geht schon seit seiner Kindheit zum Volksfest in Canfield, er isst jedes Jahr den gleichen Hotdog und die gleichen Zimtschnecken. Das Zelt der Demokraten ist auch schon seit seiner Kindheit an der gleichen Stelle. „Eher trübe Stimmung hier“, sagt er. Zwei Parteimitglieder sitzen hinter einem Tapeziertisch voller Plakate und Unterschriftenlisten, aber kaum jemand kommt vorbei und unterschreibt. Vor dem Zelt steht ein Mann von der Heilsarmee, bimmelt mit seiner Glocke und sammelt Geld für Hurrikanopfer, aber kaum jemand gibt etwas. Selbst das Sternenbanner hängt lasch hinab, es weht keine Brise.
„Wir müssen uns erst noch mit dem Gedanken anfreunden, dass wir jetzt hier in der Minderheit sind“, sagt Bonnie Wingard, die kurz im Zelt der Partei vorbeischaut, die sie schon ihr ganzes Leben lang wählt. „Im Zelt der Republikaner ist irgendwie mehr los, wir waren eben kurz da“, sagt ihr Mann Dennis. Seine Schwägerin hat Trump gewählt, obwohl sie immer Demokratin war. Auch in ihrem Freundeskreis gibt es viele Trump-Anhänger. „Es geht ein Riss durch unsere Familie“, sagt Dennis. „Wir versuchen, das Thema zu vermeiden“, sagt Bonnie.
Als Trump in diesem Sommer in Youngstown war, sind sie hingefahren und haben demonstriert. „Lock him up“, hat Bonnie gerufen – so wie damals die Trump-Fans grölten, dass Clinton eingesperrt werden soll. Dennis fand das nicht lustig. „Die Trump-Anhänger sind eine Bewegung“, sagt der pensionierte Lehrer. „Und das macht mir Angst.“
Der jubelnden Menge erzählte Trump, seine Frau habe ihn auf der Fahrt gefragt, was denn mit all den verfallenen Fabriken passiert sei. „Diese Jobs haben Ohio verlassen“, habe er ihr geantwortet. Und dann rief Trump den 7000 Fans zu: „Sie kommen alle zurück. Zieht nicht weg. Verkauft euer Haus nicht. Wir werden die Werte wieder hochtreiben. Wir werden die Jobs zurückholen, wir werden die Fabriken wieder ausfüllen, oder wir werden sie niederreißen und neue bauen. Es wird passieren.“ Die Menge raste vor Glück.
Am gleichen Tag gab Trump dem „Wall Street Journal“ ein Interview über einen anderen Teil des Rostgürtels, dem es wirtschaftlich schlecht geht – aber immer noch besser als Youngstown. „Ich werde anfangen, den Leuten zu erklären, dass es Gebiete gibt wie den nördlichen Teil vom Bundesstaat New York, die einfach nicht funktionieren und wo es den Menschen schlecht geht und wo nur 500 Meilen entfernt Leute fehlen. Ich werde den Leuten erklären, dass man wegziehen kann. Es ist okay. Mach dir keine Sorgen um dein Haus.“ Trumps Fans in Youngstown haben das Interview nicht gelesen. Es stand ja in den Fake-Medien.