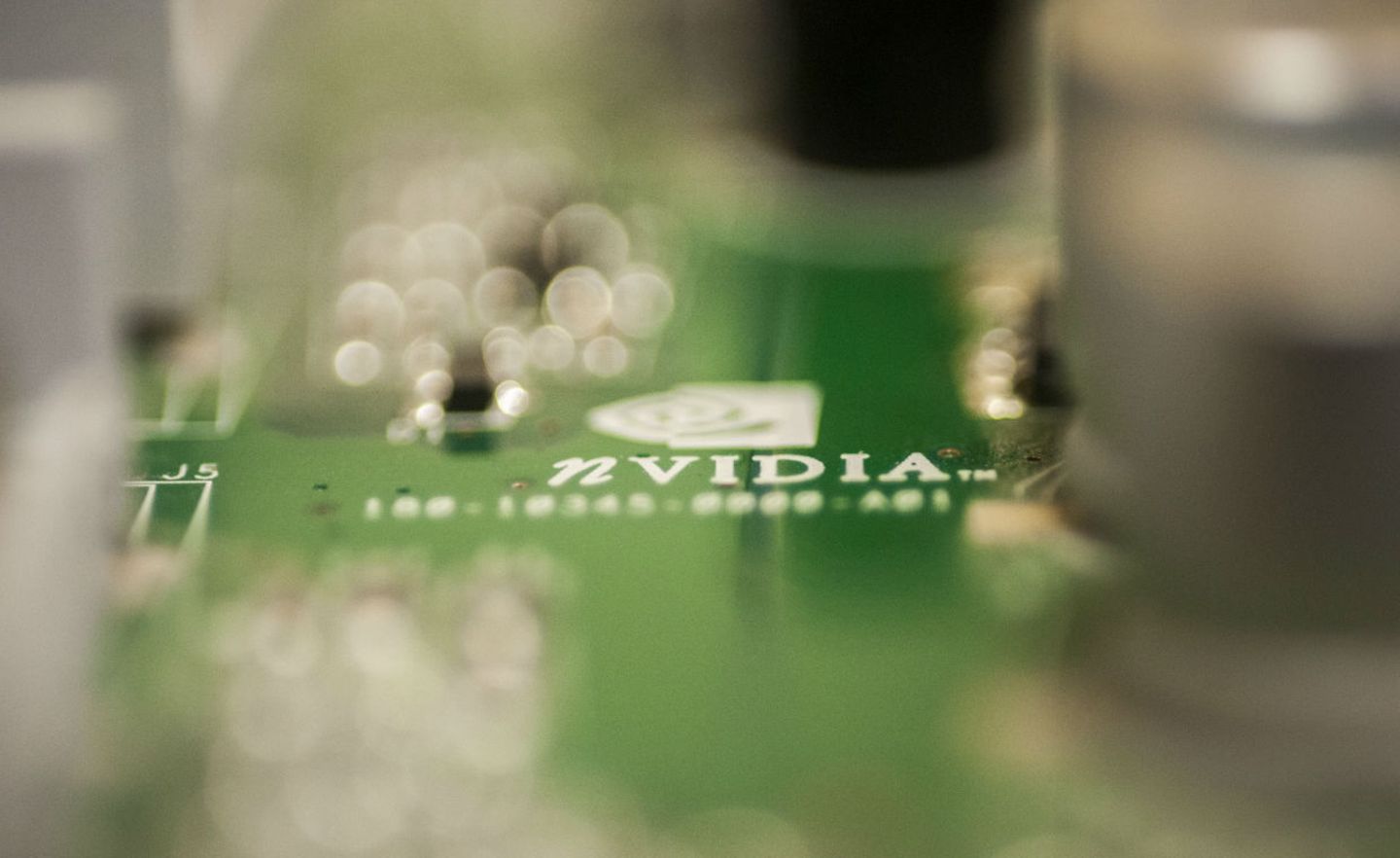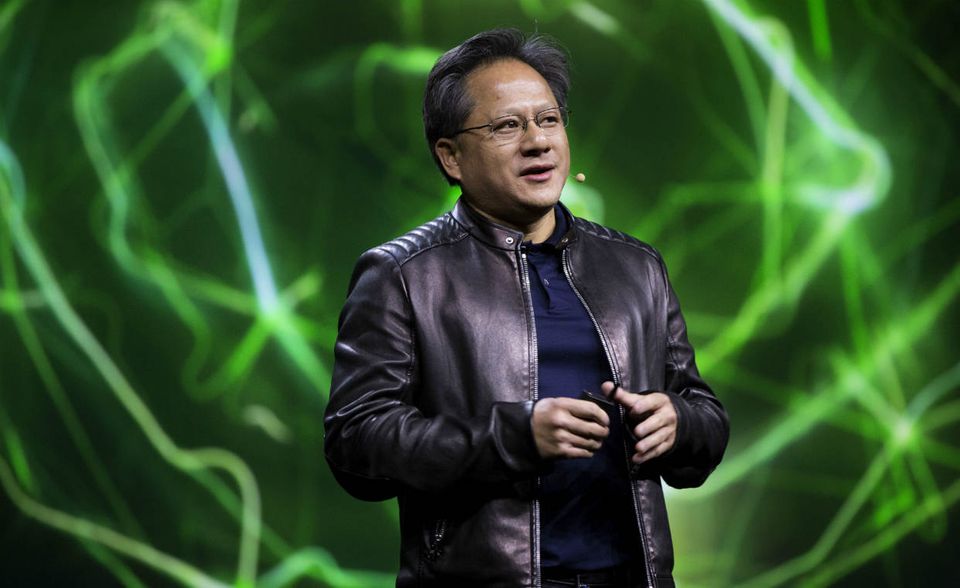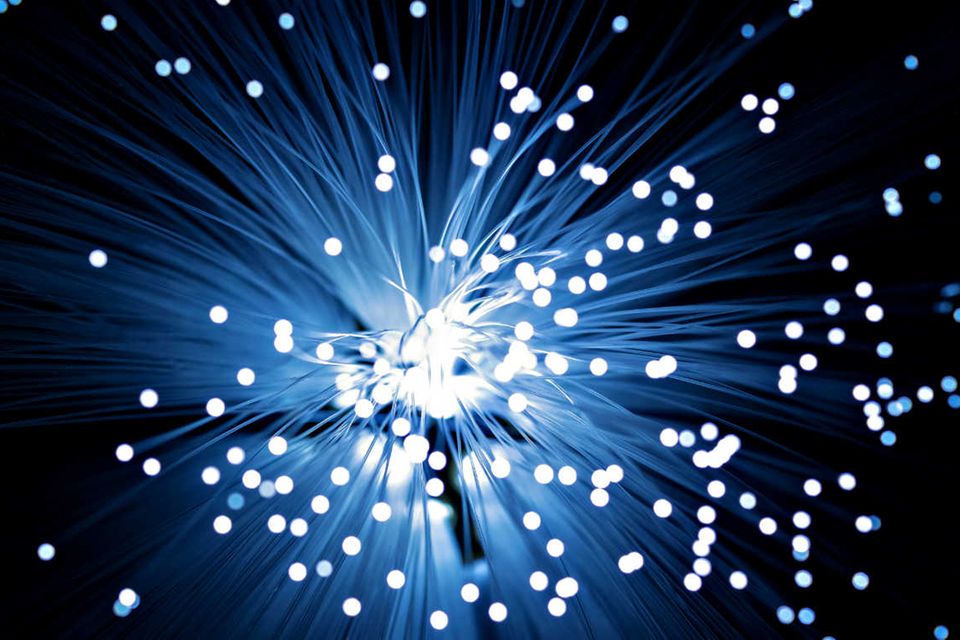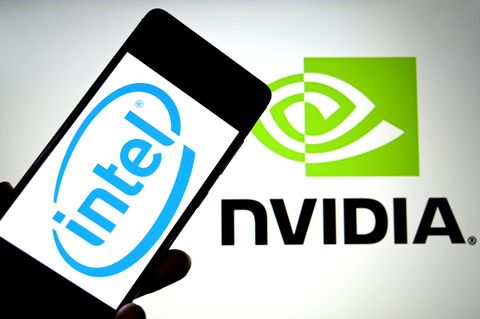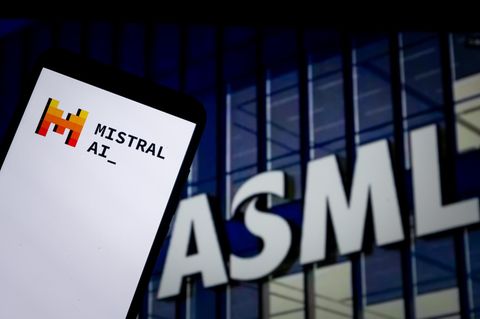Die Professorin hält ein Gehirn aus Plastik in der Hand. Lächelnd lässt sie die beiden Hirnhälften wackeln. „Was wir hier machen“, sagt sie dann, „ist eine Art Google Earth des Gehirns.“ Katrin Amunts, die im Forschungszentrum Jülich das Human Brain Project leitet, hat einen großen Plan: Ihr Team will ein komplettes menschliches Gehirn einscannen. Am Ende soll man virtuell darin herumwandern und sich alles von innen anschauen können, wie in einer Stadt. Im Rahmen des Forschungsprojekts werden die Gehirne von Organspendern in Teile geschnitten, auf Glasplatten aufgebracht und durch Scanner eingelesen.
Ein menschliches Gehirn, das bedeutet: 86 Milliarden Nervenzellen, jede davon durch 10.000 Synapsen mit anderen Zellen verbunden. Eine Zelle ist zehn Mikrometer groß, das sind zehn Tausendstel eines Millimeters. Ein Abgrund an Daten.
Dass daraus am Ende ein detailgenaues, hoch aufgelöstes Computerabbild entstehen kann, hat viel mit einem Mann zu tun, dessen Arbeitsplatz etwa 9000 Kilometer entfernt von Jülich liegt: Jensen Huang, Gründer und Chef des kalifornischen Technologieunternehmens Nvidia. Huangs Lieblingsspruch: „Wir machen nur Sachen, die schwierig sind. Alles andere interessiert uns nicht.“
Wenn beide, Amunts und Huang, mit ihrer Arbeit fertig sind, dürften sie die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ein ganzes Stück weitergebracht haben – denn beide treiben sie auf ihre eigene Weise die Idee voran, Maschinen zu erschaffen, die Verbindungen zwischen Daten herstellen, so wie es Gehirne tun.
Gestartet mit Videospielen
Der Techkonzern Nvidia hat sich zu einem der wichtigsten Akteure im Feld künstliche Intelligenz entwickelt. Ob in der Autoindustrie, in der Medizin oder im Maschinenbau – fast überall, wo datengetriebene Projekte für maschinelles Lernen entstehen, ist das Unternehmen mit im Boot. Dabei war Nvidia lange eine wenig bekannte Nerd-Firma, die nur Videospielern ein Begriff war.
Wichtigstes Produkt des Konzerns sind nach wie vor Grafikkarten, die anfangs vor allem dazu dienten, Videospiele mit möglichst realistischen Bildern auszustatten. Wer als 14-Jähriger seine Wochenenden mit „Counter-Strike“ oder „World of Warcraft“ verbrachte, kam um Nvidia kaum herum.
Grafikprozessoren unterscheiden sich von anderen Prozessoren dadurch, dass sie viele Rechenschritte parallel ausführen können. Sie erhöhen damit die Leistung von Computern um ein Vielfaches. Genau das macht sie für jeden interessant, der mit großen Datenmengen umgeht: Autokonzerne, die selbstfahrende Wagen entwickeln, Krebsforscher, die in Röntgenbildern Muster suchen, oder eben Hirnforscher. -„Nvidia ist zum führenden Anbieter von Rechenpower für KI-Software geworden“, schrieb das Magazin des Massachusetts Institute of Technology, das den Konzern zum „smartesten Unternehmen des Jahres 2017“ kürte.
In Deutschland kooperiert Nvidia mit den Autozulieferern ZF, Bosch und Continental. Volkswagen-Chef Matthias Müller erwähnte das Unternehmen im März bei seiner Jahrespressekonferenz als „neuen Partner“ für KI. Im Oktober stellte Nvidia einen Minicomputer vor, der als Komplettlösung für das autonome Fahren dienen soll und deutlich weniger Platz braucht als die bisherige Technik. Zwar haben die Kalifornier nach dem tödlichen Unfall eines selbststeuernden Uber-Autos Ende März angekündigt, ihre Experimente mit Roboterfahrzeugen vorerst auszusetzen, was die Nvidia-Aktie zwischenzeitlich um acht Prozent einbrechen ließ. In der Makrosicht aber liegt der Börsenwert des Techkonzerns heute rund siebenmal so hoch wie vor zwei Jahren.
Der Chef dieses Unternehmens steht an einem trüben Morgen in einem Münchner Hotel und sprüht vor Energie. Zu einem Treffen mit einer kleinen Gruppe Journalisten hat Jensen Huang Frau und Kinder mitgebracht, die im hinteren Teil des Raums sitzen und zuhören. Huang trägt, was er immer trägt: eine schwarze Lederjacke und glitzernde schwarz-rote Turnschuhe. Er streift wie ein Tiger durch den Raum, eine Wasserflasche in der Hand. Als eine Mitarbeiterin Kaffee bringt und dabei die Tür laut ins Schloss fallen lässt, herrscht er sie kurz ungeduldig an. Was ist künstliche Intelligenz für ihn? „KI ist die Automatisierung der Automatisierung“, sagt Huang. „Sie hat ein gewaltiges Potenzial, uns Freude und Produktivität zu bringen. Und der beste Weg, um diese Macht in gute Hände gelangen zu lassen, besteht darin, sie zu demokratisieren.“
Satte Gewinne mit Spielen
Es gibt nicht viele Menschen, die in einer Bemerkung über KI Worte wie „Freude“ und „Demokratie“ unterbringen können. Aber Huang ähnelt manchmal eher einem Religionsführer als einem Unternehmer. Er ist ein Prediger der technischen Revolution. Der heute 55-Jährige wurde in Taiwan geboren, kam aber schon als Kind in die USA und studierte Elektrotechnik an der Stanford-Universität. Nvidia gründete er mit zwei Kompagnons im April 1993, er ist nach wie vor CEO und wichtiger Anteilseigner. Wie Tesla-Chef Elon Musk oder Google-Gründer Sergey Brin ist Huang eines jener Einwandererkinder, die im Techmekka Kalifornien ihre Chance nutzten – und seitdem überzeugt sind, dass sich jedes Problem mit technischen Mitteln lösen lässt.
Im Unterschied zu vielen anderen KI-Unternehmern hat Huang mit Nvidia einen gewaltigen Vorteil: Das Geschäft mit Videospielen läuft noch immer so gut, dass jedes Jahr satte Gewinne eingefahren werden. Damit lassen sich Investitionen in Forschung und Entwicklung finanzieren und neue Geschäftsfelder aufbauen.
Was das bedeutet, lässt sich im Forschungszentrum Jülich beobachten, wo zerschnittene Gehirne in den Scanner gepackt werden. „Wir haben in der Hirnforschung solche Datenmengen und solche Komplexität, dass das selbst für Supercomputer zur Herausforderung wird“, sagt Katrin Amunts. Wenn die acht Scanner mit dem Gehirn durch sind, was bei voller Auslastung etwa ein Jahr dauern kann, kommt ein Datenvolumen von knapp drei Petabyte zusammen – das entspricht dem Speicherplatz von mehr als einer halben Million DVDs. Mit diesem Datenberg wollen die Forscher dann arbeiten: Sie wollen Erkenntnisse über das Gehirn in ihrem Computermodell ablegen und es damit beschreiben, ähnlich wie in Google-Karten Informationen zu Landschaften und Gebäuden vermerkt sind.
Im Rechenzentrum, in dem die Daten zusammenlaufen, reihen sich gewaltige Computer aneinander. Es dröhnt wie in einer Werkshalle, weil die Rechner belüftet werden müssen, um nicht heiß zu laufen. Es ist eines von drei Höchstleistungsrechenzentren in Deutschland.
Für Computer galt lange, dass sich die mögliche Leistung ihres Hauptprozessors, also der zentralen Recheneinheit, etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Die Anzahl der Komponenten, die auf einem Chip untergebracht werden können, nahm in ungefähr diesem Tempo zu. Doch damit ist es seit einiger Zeit vorbei, das Wachstum ist an seine Grenzen gestoßen. Wer schneller rechnen will, muss auf andere Bauteile setzen – und dazu gehören die Grafikkarten.
Das bringt Nvidia ins Spiel. Auch in Jülich helfen Grafikprozessoren des Unternehmens den IT-Spezialisten des Human Brain Project dabei, Gehirnbilder auszuwerten. Die Bilderkennungsprogramme werden darauf trainiert, Gehirnzellen zu identifizieren.
Nvidia hat dabei früh erkannt, dass nicht allein die Grafikkarten entscheidend sind. Wer mit Dirk Pleiter vom Jülich Supercomputing Centre spricht, versteht schnell, welche Rolle auch die Software spielt: „Der beste Grafikprozessor hilft uns nichts, wenn er nicht genug zu tun bekommt“, sagt Pleiter. Nvidia hat in den vergangenen Jahren zusätzlich zur Hardware auch viel in die Entwicklung von Programmen investiert, um die Prozessoren besser auszulasten.
Bei Projekten wie dem in Jülich lernen die Kalifornier mindestens genauso viel wie ihre Kunden. Ins Forschungszentrum unweit der belgischen Grenze wurde sogar eigens ein in Vollzeit angestellter Nvidia-Mitarbeiter entsandt. Ein Grund: Die Ergebnisse des Human Brain Project könnten für künftige KI-Projekte interessant sein, weil sie Aufschluss darüber geben, wie maschinelles Denken funktionieren kann. „Wir Hirnforscher versuchen, die Organisationsprinzipien von Netzwerken zu durchdringen“, sagt Katrin Amunts. „Es ist naheliegend, die Ergebnisse auf die Strukturen künstlicher neuronaler Netze zu übertragen. Die Art von Informationsverarbeitung, die wir in menschlichen Gehirnen sehen, finden wir zum Teil auch in Deep-Learning-Netzwerken wieder.“
Nvidia steckt viel Arbeit in die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern. Im Herbst 2017 fand in München eine eigene Konferenz des Unternehmens statt, an deren Workshops nicht nur Kunden wie Volkswagen oder die Deutsche Post teilnahmen, sondern auch Forscher und Technik-Nerds, deren Diskussionen für Laien oft kaum zu verstehen waren. Da Nvidia erklärtermaßen nicht daran interessiert ist, etablierte Technik möglichst billig zu verkaufen, sondern vor allem Neues entwickeln will, braucht es diese Kooperation mit der Wissenschaft.
Die Konkurrenz holt auf
Dranzubleiben ist für das Unternehmen wichtig, weil auch die Konkurrenz erkannt hat, dass der Boom des maschinellen Lernens Geld bringt. Der US-Halbleiterhersteller Intel übernahm 2017 die israelische Hightechfirma Mobileye, die fast überall mitmischt, wo Autos das Selbstfahren lernen sollen. Außerdem arbeitet Intel an einem „neuromorphen Chip“, der die Techniken des menschlichen Gehirns nachahmt. Der zweite große Wettbewerber AMD wiederum bastelt mit der Elektroautofirma Tesla an einem eigenen KI-Chip für das autonome Fahren. Tesla entschied sich angeblich für die Zusammenarbeit, um seine Abhängigkeit von Nvidia zu verringern.
Den Mitarbeitern des Jülicher Forschungszentrums soll dieser Konkurrenzkampf nur recht sein, solange die Technik die eigene Arbeit voranbringt. Projektleiterin Amunts steht jetzt im Keller ihres Gebäudes neben einem echten Gehirn. Das Organ sieht abstrakt aus, es fällt schwer, sich vorzustellen, dass es wirklich einmal Teil eines menschlichen Kopfs war. 86 Milliarden Nervenzellen. Unzählige Synapsen. Kaum denkbar, dass sich so etwas auch nur ansatzweise nachahmen lässt. Forscher wie Amunts aber treibt genau diese Idee um. Und die Technik macht ihnen Hoffnung.