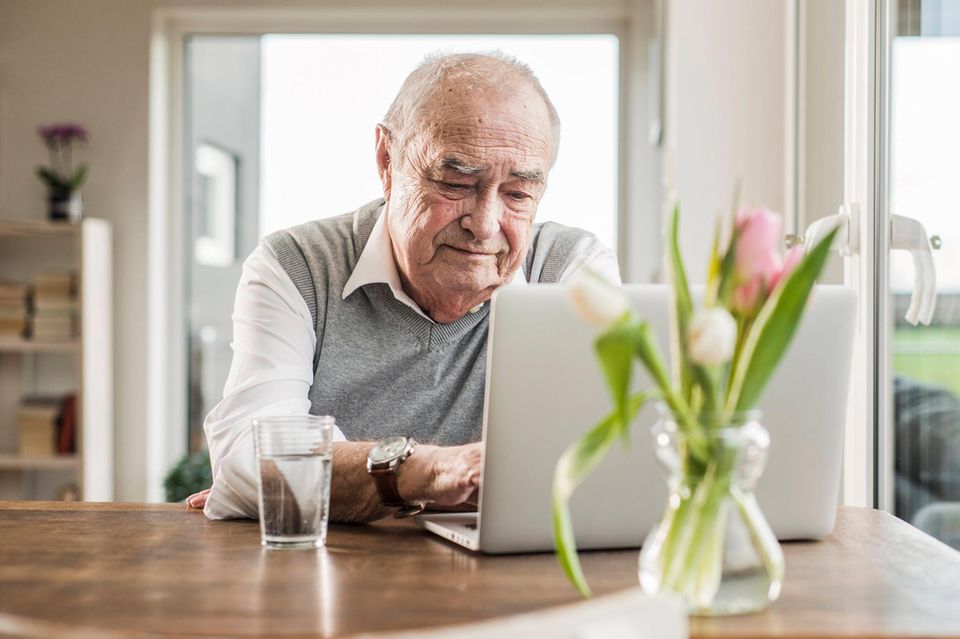Die Leidensgeschichte des Patienten René K. beginnt im Jahr 2000 mit einer wilden Mischung aus Symptomen: Kopfschmerzen, Sehstörungen, Hautekzeme, Darm- und Nierenbeschwerden. Sein Hausarzt kann sich keinen Reim darauf machen. K. begibt sich auf eine Odyssee zu unterschiedlichsten Fachärzten, die Diagnosen stellen und Medikamente verschreiben. Doch K.s Leiden haben kein Ende. Sie verschlimmern sich sogar. Er wird arbeitsunfähig, wegen der Schmerzen zunehmend unerträglich für sein Umfeld, verliert seinen Job, seine Familie.
Es dauert 14 Jahre, bis K. bei einer Spezialistin landet, die seine Krankenakte noch einmal durchforstet. Dabei stößt sie auf die Ergebnisse einer 2001 durchgeführten Dünndarmbiopsie, aus denen sich Hinweise auf eine seltene Erkrankung ableiten lassen. Nachgegangen wurde ihnen nicht. Die Ärztin lässt die Untersuchung wiederholen. Ihr Verdacht bestätigt sich: K. leidet am Hyper-IgG4-Syndrom. Es gibt erprobte Behandlungsmittel dagegen, die bei K. schließlich anschlagen.
Ada, ist Martin Hirsch überzeugt, hätte K. das Martyrium ersparen können.
Daten und Doktoren
Hirsch ist gelernter Humanbiologe und Enkel des Physiknobelpreisträgers Werner Heisenberg. Er hat jahrelang zu theoretischer Medizin und kognitiven Neurowissenschaften geforscht, außerdem eine assoziativ arbeitende und recht erfolglose Internetsuchmaschine entwickelt, in seiner Freizeit hält er Vorträge über konstellatives Denken bei Carl Zuckmayer und Pina Bausch. Ada ist seine jüngste Schöpfung: ein medizinischer Assistent, gesteuert durch künstliche Intelligenz (KI), benannt nach der Informatikpionierin Ada Lovelace und der Adalbertstraße in Berlin-Kreuzberg, wo Hirschs Startup inzwischen drei Etagen in einem Hinterhofbau belegt. Nutzer können der Ada-App ihre Symptome anvertrauen und bekommen nach einigen Nachfragen eine Liste wahrscheinlicher Diagnosen ausgespuckt – sowie im Zweifel den Hinweis, einen Arzt aufzusuchen.
Zu Testzwecken hat Hirsch die App mit allen Arztbriefen aus K.s Krankenakte gefüttert. Das Ergebnis: „Für Ada war die Diagnose schon 2001 eindeutig.“ Der Algorithmus konnte das ungewöhnliche Ergebnis der Dünndarmbiopsie einordnen.
Es gibt weltweit 7 000 seltene Erkrankungen mit jeweils bis zu 100 verschiedenen Symptomen. Kein Arzt kann dieses Wissen beherrschen – schon gar nicht, wenn er wie in vielen Ländern üblich im Schnitt nur sieben bis zehn Minuten Zeit für einen Patienten hat. KI-Systeme dagegen hantieren problemlos mit riesigen Datenmengen und liefern Ergebnisse in Sekundenbruchteilen, ohne dafür üppige Arztgehälter zu beziehen. Alle Wirtschaftszweige stehen vor einer KI-Revolution, doch nirgends sind die Erwartungen an die neue Technologie so groß wie im Gesundheitsmarkt. Es geht dabei nicht nur um Einsparpotenziale und vielversprechende neue Märkte, sondern um die Hoffnung vieler Menschen auf bessere Versorgung, auf Diagnosen, auf Heilung.
Intelligente Algorithmen, die seltene Krankheiten früh erkennen, Epidemien voraussagen, bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen und Therapien perfekt auf einzelne Patienten abstimmen können – all das wirkt zum Greifen nahe. An der KI-Revolution der Gesundheit arbeiten nicht nur Startups, sondern Forscher, Krankenhäuser, Techkonzerne, Pharmagiganten, Versicherungen und Medizintechnikunternehmen. „Von KI wird die komplette Wertschöpfungskette betroffen sein“, sagt Branchenkenner Michael Burkhart von PwC. So große KI-Fortschritte wie bei der Diagnose-App Ada sind allerdings nicht überall zu verzeichnen. „Es gibt einzelne Leuchttürme“, sagt Burkhart. „Die meisten Institutionen sind aber noch nicht auf den Einsatz von KI vorbereitet.“
Trotzdem schätzen etwa die Berater von Frost & Sullivan, dass der globale Markt für Gesundheits-KI bis 2021 auf 6,7 Mrd. Dollar wachsen dürfte – das ist mehr als das Zehnfache des Volumens im Jahr 2014. Politiker und Manager schielen zudem auf die riesigen Einsparpotenziale: Accenture schätzt, dass sich allein das US-Gesundheitssystem durch KI um fast 150 Mrd. Dollar jährlich verschlanken ließe. Der Kostendruck ist massiv: 2016 verschlangen in den USA Gesundheitskosten 17,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Deutschland waren es 11,3 Prozent.
Die Kostenspur
Eine App wie Ada kann da einen Unterschied machen. „Bei seltenen Erkrankungen dauert es in den USA im Schnitt sieben Jahre, bis die richtige Diagnose steht“, erklärt Ada-CEO Daniel Nathrath. „Da werden die teuersten Untersuchungen gemacht, die falschen Medikamente verschrieben. Das ist eine riesige Kostenspur, die so ein Patient hinter sich herzieht.“ Hirsch, der Tüftler, und Nathrath, ein leutseliger und zupackender Manager, haben ihr Startup 2010 gegründet, ursprünglich mit dem Plan, ein System zur Entscheidungsunterstützung für Ärzte zu bauen. Das Programm gibt es noch, wichtiger ist aber inzwischen die Variante für Patienten. Nach einem Jahr am Markt hat die App bereits zwei Millionen Nutzer. 2017 hat Ada 40 Mio. Euro von Investoren eingesammelt, die mit Abstand höchste Finanzierung für ein deutsches KI-Startup. Das soll nur der Anfang sein: „Unser Ziel ist es, bis 2020 mindestens 100 Millionen Nutzer zu haben und in ein paar Jahren über einer Milliarde Menschen mit Ada zu helfen“, so Nathrath.
Sieben Jahre, für ein Startup ungewöhnlich lange, arbeiteten sie an ihrem Modell. Ein Grund: Ada setzt nicht auf Deep Learning, die inzwischen am weitesten verbreitete KI-Technologie, bei der ein künstliches neuronales Netz ohne vorherige Instruktion mit Daten gefüttert wird. Das Problem bei Deep Learning ist, dass nicht einmal der Programmierer genau weiß, wie der Algorithmus zu seinem Ergebnis kommt. Doch kein Arzt würde einem System vertrauen, „wenn es eine komplette Blackbox ist“, so Nathrath. „Deshalb versuchen wir, das Denken des Systems zu visualisieren. Der Arzt kann genau sehen, welche
Symptome wie stark auf eine Erkrankung hinweisen.“
Die Medizin ist für KI kein Anwendungsfeld wie jedes andere. Das musste auch eine Forschergruppe am Mount Sinai Hospital in New York feststellen, die mit einem neuronalen Netz in der Lage war, für eine Gruppe von Testpersonen ziemlich gut vorherzusagen, wer innerhalb des nächsten Jahres an Leberkrebs, Typ-2-Diabetes oder sogar Schizophrenie erkranken würde. Erklären, wie die Resultate zustande kamen, konnte sie allerdings nicht.
Die Techies kommen
Trotzdem wurden mit Deep Learning schon spektakuläre Erfolge erzielt. Sebastian Thrun, Gründer des Innovationslabors Google X, hat ein neuronales Netz trainiert, das Hautkrebs so zuverlässig erkennt wie ausgebildete Dermatologen. Bald könnte damit jeder per Smartphone auf der eigenen Haut überprüfen, ob ein Muttermal gefährlich werden kann. Ein anderes neuronales Netz haben Forscher von Verily, dem Health-Ableger der Google-Holding Alphabet, trainiert: Es kann anhand eines Netzhautbilds das Risiko von Herzerkrankungen vorhersagen – fast so gut wie der bisher dafür übliche Bluttest.
Die Technologiekonzerne stoßen mit finanzieller Power und großem Optimismus in den lukrativen Gesundheitsmarkt vor, wo sie ihre Software- und KI-Stärken ausspielen wollen. Apple hat gerade eine App aufs iPhone gepackt, mit der Nutzer ihre Krankenakte speichern können. Samsung unterhält eine erfolgreiche Pharma-Tochterfirma. Auch Grundlagenforschung wird betrieben: Bei Microsoft arbeiten Informatiker daran, „das Problem Krebs zu lösen“. Sie versuchen etwa, per Algorithmus vorauszusagen, wie sich Tumore entwickeln. Die Forscherin Jasmin Fisher verspricht, in zehn Jahren werde „ein krebsfreies Jahrhundert“ anbrechen. Zu optimistisch? Wer weiß? Experten zeigen sich jedenfalls beeindruckt von den neuen Playern im Markt. „Die Techkonzerne werden in den nächsten zehn Jahren der große Game-Changer für den Gesundheitsmarkt“, sagt Burkhart von PwC.
Auch den großen Pharmariesen machen die ungewohnten Wettbewerber Beine. Obwohl James Kugler, Chief Digital Officer bei Merck in Darmstadt, beschwichtigt: „Wir reden hier über Medikamente. Einer der größten Vorteile von großen Pharmakonzernen ist unser Wissen über regulatorische Prozesse – was man beachten muss, um ein Medikament auf den Markt bringen zu können.“ Andererseits ist allein die Personalie James Kugler ein Zeichen dafür, dass sich etwas ändert: Der Amerikaner, der Anfang 2016 Chefdigitalisierer bei dem 350 Jahre alten Konzern wurde, ist gerade mal 30.
„Wir nutzen Daten, um unsere Prozesse zu verbessern und zu beschleunigen und unsere Kunden besser zu verstehen“, sagt Kugler. „Es ist schwierig, Bereiche im Konzern zu finden, wo KI nicht irgendwie eine Rolle spielt.“ Das fängt bei vermeintlich simplen Aufgaben wie der Qualitätskontrolle in der Pillenproduktion an. Merck nutzt selbstlernende Algorithmen, um zu prüfen, ob eine Tablette der vorgegebenen Form entspricht, um vorauszusagen, in welcher Charge Probleme auftreten könnten, und zu warnen, wenn die Maschine gewartet werden muss. Bei der komplexen Herstellung von Biopharmaka werden die Bedingungen im Bioreaktor – Druck, Temperatur, Nährstoffdosierung – mit Deep Learning auf den größten Ertrag hin optimiert. In der Forschung sollen Algorithmen riesige Datenbestände durchforsten und bisher unbeachtete Angriffspunkte in Zellen oder Moleküle für Wirkstoffe identifizieren. „Früher hatte man eine Hypothese und hat den Computer das über Nacht durchrechnen lassen“, sagt Kugler. „Heute hast du in einer Sekunde ein Ergebnis – du kannst also radikal mehr Hypothesen testen.“
KI hat das Potenzial, die Regeln einer Branche auf den Kopf zu stellen, die bis zu ein Jahrzehnt und im Schnitt etwa 2,6 Mrd. Dollar braucht, um ein neues Medikament zu entwickeln. Die entscheidende Zutat sind die Daten. Merck etwa engagierte vor einem Jahr das sagenumwobene US- Unternehmen Palantir, um alle über den Konzern verteilten Datenbestände strukturieren und aufbereiten zu lassen. Laut CDO Kugler hat diese Kooperation einen Zusatznutzen: Sie bewirkt einen Kulturwandel. „Da sitzen dann junge Typen aus San Francisco mit Shorts und Sandalen im Büro neben lauter Leuten in Anzügen.“
Als der Ingenieur Walter Märzendorfer 1985 bei Siemens anfing, war James Kugler noch nicht einmal geboren. Märzendorfer, der seit 2015 die wichtige Bildgebungssparte der Medizintechniktochter Healthineers leitet, hat schon einige technologische Revolutionen kommen und gehen sehen. Und betont dennoch: „Firmen, die KI nicht einsetzen, werden verlieren.“ Märzendorfer weiß: In kaum einem Feld haben neuronale Netzen so erstaunliche Fortschritte gemacht wie in der Analyse von Bildern. Gibt es genug Trainingsdaten, erkennen die Algorithmen Katzen, Pferde – oder eben gefährliche Hautveränderungen.
Healthineers ist mit einem Vorsprung ins KI-Rennen gegangen. „Wir beschäftigen uns schon seit den 90er-Jahren mit diesen Technologien“, sagt Märzendorfer. 400 Machine-Learning- und 75 Deep-Learning-Patente hat sein Unternehmen angehäuft, im US-Unistädtchen Princeton betreibt es ein KI-Entwicklungszentrum mit eigenem Supercomputer. Und Healthineers hat bereits etwa 30 KI-getriebene Anwendungen im Markt. „Wir sind da an der Spitze der Entwicklung.“
Im November stellte das Unternehmen etwa eine 3D-Kamera für Computertomografen vor, mit der sich die Position und Körperform des Patienten analysieren lassen. Mittels Deep Learning errechnet dann ein Programm, wie der Patient im Scanner platziert werden muss, damit gleich beim ersten Versuch ein gutes und genaues Bild entsteht und unnötige, teure Wiederholungsscans vermieden werden können.
Für den Radiologen übernehmen künstliche neuronale Netze die erste Stufe der Bildanalyse: Sie nummerieren die Wirbel auf Thorax-Aufnahmen, stellen auf Ganzkörperscans die wesentlichen Organe frei oder visualisieren Herzschlag und Durchblutung. Auch bei der Diagnose helfen die Algorithmen inzwischen: Sie erkennen Anomalien und heben sie für den Radiologen hervor. Bei der Früherkennung von Prostatakrebs im Magnetresonanztomografen wiederum zieht der Computer nicht nur Bilder als Quellen hinzu, sondern auch Biopsieergebnisse und andere klinische Daten, um das Risiko zu beurteilen.
Das Ende der Radiologie
Der durchschnittliche Radiologe hat alle drei bis vier Sekunden ein neues Bild zu interpretieren – acht Stunden am Tag. 2015 ermittelte ein Verband, dass in Großbritannien in einem Jahr 30 Prozent mehr CT-Scans anfielen, die Zahl der Radiologen aber nur um fünf Prozent zunahm. Wenn ein medizinisches Berufsfeld eine Automatisierung durch KI gebrauchen kann, dann dieses.
Walter Märzendorfer hielt vor zwei Jahren beim Jahreskongress der Röntgengesellschaft einen Vortrag mit dem Titel „Radiologie – ein Auslaufmodell?“ Das Fragezeichen im Titel ist ihm wichtig. „Selbst der beste Arzt der Welt kann diese enormen Mengen an Informationen und medizinischen Richtlinien nicht alle im Griff haben“, sagt er. Daher brauche es Assistenzsysteme, die Ärzten helfen, informiertere Entscheidungen zu treffen. Menschliche Mediziner nicht ersetzen, sondern ergänzen – so sehen sie das bei Healthineers. Aber natürlich wollen sie auch ihre angestammten Kunden nicht verschrecken.
Die Pipeline mit KI-Innovationen sei gut gefüllt, sagt Märzendorfer. Dazu trägt auch eine Datenbank bei, in die Healthineers in den letz- ten Jahren mehr als 100 Millionen Bilder, Arztberichte und klinische Daten eingespeist hat. Wer weiß, was damit eines Tages noch möglich sein wird?
Zurück nach Berlin, zu Ada in die Adalbertstraße. Martin Hirsch führt am Ende des Gesprächs einmal quer durchs Büro, in einen kleinen Nebenraum, den er als Labor bezeichnet, obwohl auch hier einfach nur junge Menschen vor Bildschirmen sitzen. Im Labor wird an der Zukunft von Ada getüftelt. Der Algorithmus soll nämlich künftig nicht nur mit aktuellen Symptomen, sondern auch mit Daten aus Genprofilen gefüttert werden. Gerade läuft ein Test mit den Daten von Daniel Nathrath. „Wir arbeiten daran“, erklärt der Mitgründer, „dass Ada noch mehr zu einer permanenten Begleiterin wird, die auch die Krankheitshistorie des Patienten berücksichtigt und vielleicht einmal das genetische Profil.“ Das werde es künftig ermöglichen, Probleme an- zugehen, die „noch 10-Euro-Probleme sind“. Bevor sie zu 100.000-Euro-Problemen werden.
Dieser Beitrag erschien erstmals 2018 in der Capital-Printausgabe.