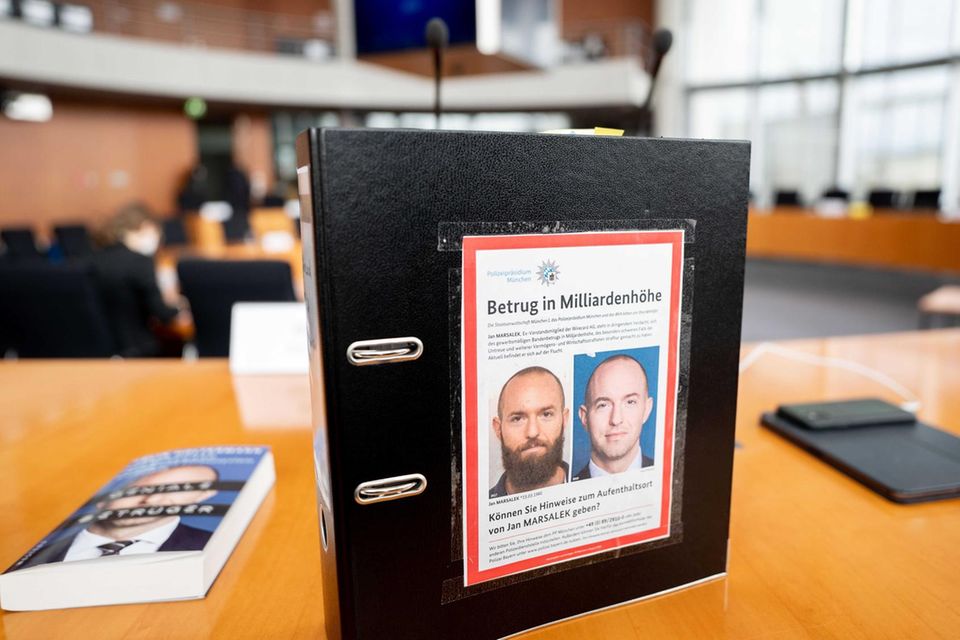Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar über die Rechtmäßigkeit von Gebühren für den polizeilichen Mehraufwand bei sogenannten Hochrisikospielen der Fußball-Bundesliga ist die Rechtslage geklärt: Die Länder sind berechtigt, den Mehraufwand, der aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Polizeikräfte entsteht, auf die Veranstalter umzulegen, wenn eine entsprechende gesetzliche Grundlage besteht.
Diese Rechtsgrundlage gibt es bisher nur in Bremen. Damit hat das Land Bremen den juristischen Streit mit der DFL endgültig für sich entschieden. Den politisch motivierten Entschluss, diese Kosten den Veranstaltern zuzuweisen, mag man als falsch erachten. Am juristischen Sieg des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer lässt sich jedoch nicht mehr rütteln.
Die DFL hat daraufhin angekündigt, in den juristischen Grabenkampf zu gehen und die Entscheidungen der Polizei überprüfen zu wollen, ob die Einstufung einzelnen Partien als Risikospiele berechtigt war. Das wird aber nicht von grundlegendem Erfolg gekrönt sein. Der Polizei steht bei der Planung von Sicherheitseinsätzen ein weiter Beurteilungsspielraum zu, zumal sich die Angemessenheit von Sicherheitseinsätzen sowieso immer erst in einer Rückschau beurteilen lässt. Es ist, wie im Fußball selbst: Nach dem Spiel ist man eben immer schlauer. Somit bleibt die Frage, wie die Kostenverteilung von Hochrisikospielen zukünftig geregelt werden kann.
Nur zur Erinnerung: Bereits 2014 wurde das Bremische Gebühren- und Beitragsgesetz dahingehend ergänzt, dass bei gewinnorientierten, erfahrungsgemäß gewaltgeneigten Veranstaltungen mit mehr als 5000 erwarteten Besuchern den Veranstaltern der Mehraufwand für zusätzliche Polizeikräfte in Rechnung gestellt wird. Infolge eines Hochrisikospiels zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV im April 2015 im Weserstadion hatte die Bremer Innenbehörde der DFL erstmals einen Gebührenbescheid für Mehrkosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt.
Eindeutiger Standortnachteil
Sechs weitere Gebührenbescheide folgten, davon drei im Zusammenhang mit Spielen von Werder gegen den HSV. Jeweils einer betraf Spiele gegen Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt. Die durchschnittliche Gebührenforderung betrug etwa 334.000 Euro. Die fälligen Bescheide in Höhe von rund 1,17 Mio. Euro wurden zunächst von der DFL bezahlt, gehen nach fast einstimmigem Beschluss (eine Ablehnung, eine Enthaltung) der Mitgliederversammlung des DFL e. V. – alle 36 Klubs der Ersten und Zweiten Bundesliga sind Mitglieder – zu Lasten des Klubs Werder Bremen.
Die Frage ist, wer zukünftig für diese Kosten aufkommen soll. Bleibt Werder Bremen der einzige Bundesligaklub, der solche Mehrkosten zu tragen hat und wird der hierdurch unstreitig bestehende Standortnachteil zementiert? Werden auch andere Bundesländer entsprechende Regelungen erlassen oder kommt es zu einer solidarischen Finanzierung? Denn Hochrisikospiele gibt es an vielen Standorten der Ersten und Zweiten, auch der Dritten Liga und sogar in den Regionalligen. Die Aktualität und das Ausmaß des Problems wurde jüngst beim Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden deutlich, als der Einsatz von rund 1300 Polizeikräften nicht ausreichte, um schwere Ausschreitungen zu verhindern.
Nicht nur die Bundesliga betroffen
Polizeirecht und die für Polizeieinsätze fälligen Gebühren sind Ländersache. Das Thema geht über „König Fußball“ oder den Sport hinaus: Kulturveranstaltungen und Volksfeste können angesichts sich schnell verändernder Sicherheitslagen ebenfalls ein Hochrisiko darstellen und werden häufig von gewerblichen Veranstaltern ausgerichtet. Die Büchse der Pandora wird geöffnet, unken Verbands-, Vereins- und Fanvertreter, denn: Liegen die Voraussetzungen für einen Gebührenbescheid vor, hat eine Innenbehörde aus Gleichbehandlungsgründen wenig Spielraum. Andererseits hält es laut Umfragen eine Mehrheit für richtig, wenn der Milliardenbetrieb Fußball für Polizeikosten verantwortlich ist und dem Verursacherprinzip Genüge getan wird.
Bremens Innensenator hat seit Beginn des Rechtsstreits eine Fondslösung zur Finanzierung der Polizeimehrkosten vorgeschlagen. Hierfür haben mehrere Bundesländer bereits ihre Unterstützung signalisiert, zuletzt der hessische Innenminister Roman Poseck, der eine bundeseinheitliche Lösung anstrebt, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und den administrativen Aufwand für die Abrechnung von Einzelspielen zu vermeiden. Die DFL hatte eine solche Lösung stets als nicht interessengerecht abgelehnt, da die Klubs entsprechend ihres Anteils aus den Erlösen der zentralen Vermarktung, nicht aber entsprechend ihrer Verantwortung an Hochrisikospielen beteiligt würden.
Die Argumentation der DFL überzeugt allenfalls jene, die den Verteilerschlüssel für die Erlöse aus der Zentralvermarktung der Ersten und Zweiten Bundesliga für ein objektiv gerechtes System halten. Schwerer wiegt dagegen das Argument, dass eine zentrale Fondsfinanzierung die Anreize für Gewaltprävention erheblich reduzieren könnte. Die DFL-Klubs leisten nämlich bedeutende Beiträge zur Gewaltprävention und lassen sich dies einiges kosten. Dieses Engagement durch eine Art Ablasshandel zu unterlaufen ist riskant. Gefordet ist daher eine Lösung, die die Anreize für Investitionen in Gewaltprävention verstärken.
Untätigkeit seitens der DFL mit dem Argument, es handele sich um ein Bremer Problem und diesen wirtschaftlichen Standortnachteil müsse Werder deshalb hinnehmen, weil es auch in anderen Bereichen wie bei Sponsoren, Stadion und anderen Faktoren keine Standortgerechtigkeit gebe, überzeugt wenig. Denn das Bundesverfassungsgericht hat der Bremer Regelung ausdrücklich attestiert, dass sie Gemeinwohlzwecke fördere und die Allgemeinheit unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips vor zusätzlichen Kosten bewahre. Daraus ergibt sich zwar keine direkte Rechtspflicht an die übrigen Bundesländer, nun ebenfalls dem Bremer Gebührenrecht entsprechende Regelungen zu erlassen. Aber das Abwälzen dieses polizeilichen Mehraufwands auf den Steuerzahler dürfte politisch kaum mehr akzeptabel sein und die Umlage auf die Veranstalter haushalterisch von den Rechnungshöfen der Länder eingefordert werden.
Innenministerkonferenz ist gefordert
Zudem stellt sich die Frage, ob es sich bei einer Vernachlässigung der Kostenumlage um eine verdeckte Subventionierung des oder der Klubs des eigenen Bundeslandes handelt. Der Ball liegt also bei der Politik, und der Bremer Innensenator sollte seinen aktuellen Vorsitz der Innenministerkonferenz 2025 mit Nachdruck dafür nutzen, durch eine bundeseinheitliche Regelung den Standortnachteil einzelner Klubs zu beseitigen. Das Thema steht daher auf der Agenda für die Innenministerkonferenz 2025.
Hier könnte man das folgende Finanzierungssystem zur Diskussion stellen: Die DFL beziehungsweise der DFB zahlt die von ihr für Verstöße gegen Sicherheitsauflagen, zum Beispiel wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Stadion, gegen die Klubs verhängten Geldbußen in einen Fonds ein. Die von DFL beziehungsweise DFB verhängten Strafgelder gegen die Klubs der Bundesliga sowie der Zweiten und Dritten Liga sind durchaus erheblich. Sie betrugen laut Internetportal fussballmafia.de in der Saison 2023/24 insgesamt über 12,5 und in der Saison 2024/25 bisher 2,5 Mio. Euro. Das sind erhebliche Beträge, die vermutlich ausreichen, um zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen abzudecken.
Der Vorteil einer solchen Finanzierung: Die Klubs können die gegen sie verhängten Bußgelder durch Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen zur Gewaltprävention beeinflussen. Somit besteht ein Anreiz aller Klubs, strenge Maßnahmen zu treffen. Da Bußgelder auch gegen Auswärtsclubs verhängt werden, können neben den Heimclubs auch die verantwortlichen Auswärtsclubs herangezogen werden. Zugrunde liegt die Annahme, dass die für Sicherheitsverstöße herangezogenen Klubs auch für die Polizeikosten von Hochrisikospielen, zumindest indirekt, verantwortlich sind. Und es würde sich um ein solidarisches Finanzierungssystem handeln, das Standortnachteile einzelner Klubs aufgrund auf sie anwendbarer Polizeigesetze verringert.
Angesichts der Umsatzerlöse der Ersten und Zweiten Bundesliga von mittlerweile über 5 Mrd. Euro in der Saison 2023/24 sollte eine solidarische Finanzierung zusätzlicher Polizeikosten für Hochrisikospiele in Höhe eines voraussichtlich niedrigen einstelligen Millionenbetrages pro Saison wirtschaftlich verkraftbar sein. Eine Überwälzung dieser Kosten auf den Steuerzahler und damit die Allgemeinheit ist spätestens nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr akzeptabel.