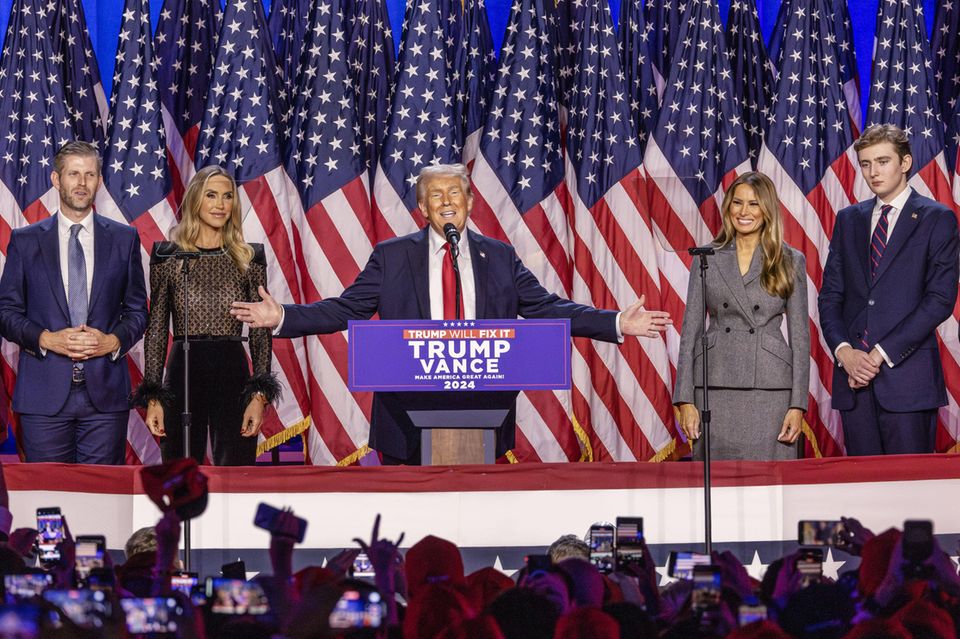Nach dem Wahlsieg Donald Trumps treiben zwei Sorgenthemen Europa um: der Verlust der USA als Sicherheitsgarant Europas sowie eine Wirtschaftspolitik, die die US-Wirtschaft anfacht und Europa und insbesondere Deutschland durch protektionistische Maßnahmen unter Druck setzt. Trumps „America First“-Politik, die europäische Unternehmen bereits in seiner ersten Amtszeit empfindlich traf, dürfte ab Januar 2025 noch rigider umgesetzt werden, denn Trump kann dank der republikanischen Mehrheit im Senat und wahrscheinlich auch im Repräsentantenhaus durchregieren.
Die zweite Trump-Regierung übernimmt – entgegen der Wahrnehmung vieler US-Bürgerinnen und -Bürger – eine robuste US-Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt legte trotz angehobenen Leitzinses laut US-Handelsministerium von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 2,8 Prozent zu. Und ein Teil der von Joe Biden umgesetzten wirtschaftspolitischen Maßnahmen dürfte sich, etwa auf dem Arbeitsmarkt, erst dann positiv niederschlagen, wenn Trump bereits im Amt ist.
Und dennoch will Trump seinen internationalen Wirtschaftspartnern erneut hohe Importzölle auferlegen: mindestens 10 Prozent auf alle Einfuhren und sogar 60 Prozent auf Importe aus China. Im vergangenen Jahr importierten die USA Waren im Wert von 3,8 Billionen US-Dollar. Die Zoll-Einnahmen für die US-Staatskasse wären erheblich. Für Europa und insbesondere Deutschland wären sie ein schwerer Schlag, weil die USA einer der wichtigsten Exportmärkte sind. Besonders betroffen sein könnten erneut die Automobil-, Aluminium- und Stahlindustrien. Bereits während Trumps erster Amtszeit wurden Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium erhoben. Die Biden-Regierung setzte diese aus, um die Handelsbeziehungen zu entspannen – Trump könnte sie bereits Anfang 2025 wieder in Kraft setzen und so auch die ohnehin schwächelnde Automobilbranche belasten.
Werden deutsche Unternehmen in die USA abwandern?
Ausnahmen von den Importzöllen soll es geben – wenn es den USA nützt: Für die Fertigung müsste auf einen erheblichen Anteil lokaler Komponenten zurückgegriffen werden. Obwohl alle deutschen Automobilhersteller große Werke in den USA betreiben, produzieren sie dort nur bestimme Modelle und sind nach wie vor auf Importe von Zulieferern aus Europa angewiesen. Die Verlagerung zusätzlicher Produktion in die USA wäre für den Standort Deutschland sehr schädigend. Sie könnte auch durch eine unternehmensfreundliche Steuerpolitik befördert werden: Die Unternehmenssteuer will Trump von 21 auf 15 Prozent senken, allerdings nur für Unternehmen, die in den USA produzieren. Denn Trump geht es um die Sicherung amerikanischer Arbeitsplätze.
Trump gehört zu den Klimawandelleugnern und es gilt als sicher, dass er die USA erneut aus dem Pariser Abkommen herausführen wird. Ebenso sicher ist die Rücknahme von nationalen Vorschriften zur Eindämmung der Umweltverschmutzung und zur Bekämpfung des Klimawandels. Trump versprach, für jede neue Regelung zehn bestehende zu streichen und sofort eine „nationale Notstandserklärung“ zu erlassen. Dadurch dürfte er nicht nur die Energiepreise senken, um Projekte wie Pipelines, Kraftwerke und Reaktoren schneller genehmigen zu lassen. Er würde der US-Wirtschaft auch gegenüber Europa einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die weitreichender Regulierung unterliegt.
Abschaffen möchte er auch den Inflation Reduction Act (IRA), das große industriepolitische Vorhaben der Biden-Regierung zur grünen Transformation der USA. Eine vollständige Abschaffung ist unrealistisch, denn gerade viele republikanisch regierte Bundesstaaten profitieren enorm von den großzügigen Förderungen und Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur. Wahrscheinlicher ist es, dass die Trump-Regierung die Förderbedingungen so verändert, dass künftig auch fossile Technologien profitieren können. Das würde nicht nur den Anreiz, auf erneuerbare Energien umzustellen, erheblich abschwächen, sondern auch der US-Wirtschaft durch einen niedrigeren Energiepreis einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Trump fährt keine klare Linie
Trumps Potpourri an wirtschaftspolitischen Ankündigungen birgt innere Widersprüche. Seine Wirtschaftspolitik setzt auf begrenzte staatliche Intervention, Deregulierung und Bürokratieabbau. Eine neue Kommission zur Überwachung und Kürzung der Staatsausgaben soll unter der Leitung von Elon Musk „Billionen Dollar“ einsparen, eine Besetzung, die aufgrund der zahlreichen Regierungsaufträge für Musks Unternehmen wie SpaceX Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte aufwirft. Doch ob die Staatsausgaben tatsächlich sinken, hinterfragen viele, denn der Katalog von Wahlkampfversprechen ist insbesondere auch wegen der geplanten Steuersenkungen kaum finanzierbar.
Auch von seiner Migrationspolitik werden negative Effekte für die Wirtschaft erwartet. Führt er tatsächlich die „größte Abschiebungsaktion in der amerikanischen Geschichte“ durch, könnte dies in einigen Branchen zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel führen. Sogar die Einfuhrzölle könnten negative Effekte für die US-Wirtschaft haben, etwa wenn die Kosten nicht komplett bei den ausländischen Herstellern hängenbleiben, sondern an die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Ironischerweise könnten seine protektionistischen Maßnahmen zwar mehr Jobs ins Land holen, die Preise aber weiter anheizen.
Trotz dieser Widersprüchlichkeiten könnte Trumps „America First“-Politik positive Effekte für die US-Wirtschaft haben, insbesondere wenn sein Team noch einige der Widersprüche ausräumt. Wenig überraschend haben sich viele amerikanische Wirtschaftslenker bereits im Wahlkampf hinter Trump gestellt und ihn bestärkt, die Steuern zu senken und die inländische Produktion zu stärken. Der US-Präsident tritt nun mit einem Programm an, das für Europas Wirtschaft und den globalen Handel eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Auch weil er möglicherweise Europa dazu zwingen will, weniger Handel mit China zu treiben, besteht für das deutsche und europäische Wirtschaftsmodell eine grundlegende Herausforderung, die langfristiges Umdenken erzwingt.
Die EU muss sich auf sich konzentrieren
Die Diskussion darum hat, getrieben vom fortschreitenden Wettbewerbsfähigkeitsverlust der europäischen Wirtschaft, längst begonnen. Mit dem Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit und dem Letta-Bericht zum Binnenmarkt liegen wichtigen Vorschläge auf dem Tisch und wurden beim EU-Gipfel diskutiert. Die Gefahr ist indes, dass die Regierungen in der EU sich in einem entscheidenden Moment nicht darauf einigen können, wie sie nötige Investitionen und Maßnahmen für bessere Wettbewerbsbedingungen auf den Weg bringen und wirklich gemeinsame Sache machen. Das reicht von einem tieferen Kapitalmarkt über Infrastrukturmaßnahmen bis hin zur Innovationsförderung.
Trump könnte auch daran seinen Anteil haben: Einige Staaten, etwa Ungarn, werden stärker auf ein enges bilaterales Verhältnis zu Trump setzen als auf eine stärkere EU. Und für alle Regierungen hat er die Trade-offs verschärft: In dem Maße, in dem die USA ihren Beitrag zur europäischen Sicherheit reduzieren, müssen die europäischen Regierungen mehr ausgeben, um sich gegenüber Russland und anderen Herausforderungen zu schützen. Auch dies kann Europas Wachstum weiter lähmen. Wenn die EU jetzt aber mit der neuen Kommission die Chance ergreift, ihre Prioritäten zu ordnen und sich selbst zukunftsfähiger aufzustellen, macht sie sich zu einem interessanteren Partner für die USA und ist auch auf andere geopolitische Herausforderungen besser vorbereitet.
Transparenzhinweis: Die Bertelsmann Stiftung hält Anteile am Bertelsmann-Konzern, zu dem auch RTL Deutschland und Capital gehören.