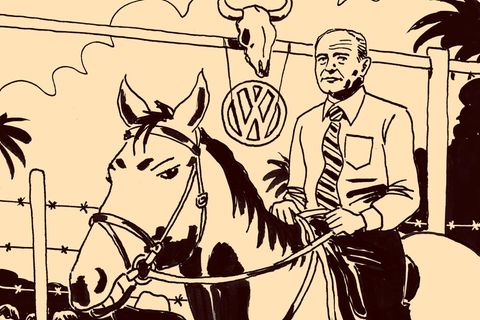Bei Volkswagen sind IG Metall und Betriebsrat auch zu Gehaltsverzicht bereit, um die Kosten zu senken und so Werksschließungen und Entlassungen zu verhindern. Das sieht ein eigenes Zukunftskonzept vor, das die Arbeitnehmervertreter am Tag vor der nächsten Tarifrunde am Mittwoch vorgestellt haben. Das Gesamtkonzept ermögliche eine Entlastung bei den Arbeitskosten um rund 1,5 Mrd. Euro, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. „1,5 Mrd. Euro, die wir auf den Verhandlungstisch legen.“
Im Gegenzug verlangen IG Metall und Betriebsrat Garantien für Standorte und Beschäftigung. Die von VW im September gekündigte Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigen bisher ausschließt, müsse wieder in Kraft gesetzt werden – sowohl für die sechs westdeutschen Werke mit 125.000 Mitarbeiter in Niedersachsen und Hessen als auch für die drei Standorte in Sachsen.
Konkret angeboten wird, die nächste Tariferhöhung befristet als Arbeitszeit in einen Zukunftsfonds einzubringen und vorerst nicht auszuzahlen. Das ermögliche flexible Arbeitszeitkürzungen ohne Personalabbau. Maßstab solle dabei der jüngste Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie sein, der eine Erhöhung um insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen bis 2026 vorsieht.
„Gegenmodell zum Kahlschlag-Plan“
„Weil nachhaltige Lösungen hermüssen, gehen wir nun in die Offensive und legen ein Lösungskonzept vor“, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo bei der Vorstellung des Konzepts in Wolfsburg. „Es ist ein Gegenmodell zum Kahlschlag-Plan des Vorstandes, der Zukunft verhindert statt schafft.“ Bei dem eigenen Plan handel es sich dagegen um einen Plan, „der ohne Werksschließung und ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommt“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.
Hier produziert VW in Deutschland
Das VW-Stammwerk am Mittellandkanal gilt als größte zusammenhängende Autofabrik der Welt. Auf 6,5 Quadratkilometern erstrecken sich die Anlagen, rund 62.000 Mitarbeiter arbeiten am Stammsitz für VW. Gegründet wurden das Werk und die Stadt Wolfsburg 1938 für die Produktion des „KdF-Wagen“, aus dem später der VW Käfer wurde. Heute werden hier Golf, Tiguan und Touran gebaut. Mit zuletzt rund 500.000 Fahrzeugen Jahresproduktion ist der Standort aber nur zur Hälfte ausgelastet. Den Bau eines weiteren Werks für E-Autos in Wolfsburg hatte VW 2023 wieder abgeblasen.
Hannover war 1956 das zweite deutsche Werk des Konzerns. Sechs Jahre zuvor war in Wolfsburg der erste VW Transporter vom Band gelaufen. Jetzt bekam der „Bulli“ seinen eigenen Standort. Der Transporter blieb bis zum Auslaufen der sechsten Generation Mitte 2024 das wichtigste Modell in Hannover. Heute entstehen hier der Multivan und der 2022 gestartete vollelektrische ID. Buzz. Der Standort hat rund 14.700 Mitarbeiter. Bereits seit 2020 wird Personal abgebaut – ohne Entlassungen, indem frei werdende Stellen nicht besetzt werden. 3000 Arbeitsplätze fielen seither weg, weitere 2000 sollen bis 2029 folgen.
50 Jahre lang war das VW-Werk in Emden vor allem mit einem Modell verbunden: dem Passat, der hier ab 1974 vom Band lief. Zehn Jahre zuvor hatte VW den Standort in Ostfriesland eröffnet – vor allem wegen des Zugangs zum Hafen für den Export nach Übersee. Inzwischen wurde das Werk mit heute 8600 Mitarbeitern zum reinen Elektro-Standort umgebaut. Mehr als 1 Mrd. Euro hat VW dafür seit 2020 investiert. Statt des Passats werden hier jetzt ID.4 und ID.7 gebaut. Wegen der zuletzt schwachen Nachfrage nach E-Autos musste VW bereits zeitweise die Bänder stoppen.
Das Volkswagenwerk Kassel steht gar nicht in Kassel, sondern im nahen Baunatal. Der 1958 gegründete Standort ist heute das weltweit größte Komponentenwerk des Konzerns und mit 16.800 Mitarbeitern größter deutscher VW-Standorte nach Wolfsburg. Produziert werden Getriebe und Abgasanlagen für Verbrenner sowie die E-Motoren für die Elektro-Modelle. In einer eigenen Gießerei entstehen auch Teile für Karosserie und Fahrgestell. Zum Standort gehört zudem das größte Ersatzteillager Europas, das die Originalteile der Marken VW, Audi, Škoda und Seat weltweit vertreibt.
Das heutige Komponentenwerk in Braunschweig gilt als älteste VW-Fabrik überhaupt. Bereits vor dem Stammwerk in Wolfsburg lief hier 1938 die Herstellung von Werkzeugen für die künftige Autoproduktion an. Heute werden an dem Standort mit rund 7.200 Mitarbeitern unter anderem Achsen, Bremsscheiben und Lenkungen hergestellt. Die Produktion erfolgt verteilt auf drei Standorte in der Stadt. Zudem spielt Braunschweig eine wichtige Rolle bei der E-Mobilität: Hier entstehen seit 2013 aus angelieferten Zellen die Batteriesysteme, die dann in den E-Autos verbaut werden.
Die derzeit größte Baustelle des Konzerns befindet sich in Salzgitter: Direkt neben dem bestehenden Motorenwerk entsteht dort die erste eigene Batteriezellfabrik des Konzerns. 2025 soll die Produktion anlaufen, Salzgitter dann „vom Leitwerk Motor zum Leitwerk Zelle“ werden, wie VW ankündigte. Für den Standort mit heute 6.350 Mitarbeitern ist es bereits die zweite große Transformation. Gegründet wurde das Werk 1970 für die Fertigung eines neuen VW-Modells, das sich dann aber nur mäßig verkaufte. Fünf Jahre später machte VW daraus ein Motorenwerk. 2023 wurden mehr als 800.000 Benzin- und Dieselmotoren hergestellt.
Der heutige VW-Standort blickt auf eine mehr als 100-jährige Tradition im Autobau zurück. Bereits 1901 übernahm Wilhelm Karmann hier ein Fahrrad- und Autowerk, ab 1949 baute die Firma als Auftragsfertiger Cabrios für VW. Als Karmann 2009 Insolvenz anmelden musste, übernahm Volkswagen den Standort. Zu verdanken war das nicht zuletzt dem Einsatz des damaligen Ministerpräsidenten und VW-Aufsichtsrats Christian Wulff (CDU). Heute fertigt der Standort mit 2300 Mitarbeitern vor allem Fahrzeuge für die Konzernschwester Porsche: Boxster und Cayman. Das letzte VW-Cabrio – der offene T-Roc – läuft 2025 aus.
August Horch legte hier vor 120 Jahren den Grundstein für die Marke Audi, zu DDR-Zeiten wurde in Zwickau der Kleinwagen Trabant gebaut. Nach der Wiedervereinigung zog VW am Stadtrand eine neue Fabrik hoch. Heute gilt sie mit rund 9.500 Beschäftigten als Leitwerk der E-Mobilität im Konzern. Dazu wurde die Autofabrik bis 2020 für rund 1,2 Milliarden Euro komplett auf Elektro umgestellt, als erste im Konzern. Der Standort leidet nun unter der schwachen Nachfrage nach E-Autos. Deswegen wurden bereits Schichten gestrichen und die Verträge Hunderter befristet Beschäftigter nicht verlängert.
Das Engagement von Volkswagen in Chemnitz begann schon vor der Wiedervereinigung. Bereits seit 1988 wurden hier in Lizenz VW-Viertaktmotoren für die DDR-Modelle Trabant, Wartburg und Barkas hergestellt. Das Ganze war vom damaligen VW-Konzernchef Carl Hahn eingefädelt worden, einem gebürtigen Chemnitzer. Nach der deutschen Einheit übernahm Volkswagen dann das Motorenwerk. Anders als Zwickau hängt der Standort noch komplett am Verbrenner. Im vorigen Jahr produzierten die 1800 Mitarbeiter 690.000 Motoren - ausschließlich für Benziner.
Es ist der jüngste und zugleich kleinste VW-Standort: die „Gläserne Manufaktur“ in Dresden. Gegründet 2001 für das Oberklassemodell Phaeton war es ein Prestigeprojekt des damaligen Vorstandschefs Ferdinand Piëch. Doch 2016 zog VW angesichts sinkender Verkaufszahlen die Reißleine. Seither ringt die Manufaktur mit ihren 340 Mitarbeitern um eine neue Bestimmung. Seit Anfang 2021 wird der ID.3 montiert – in geringen Stückzahlen. VW denkt inzwischen offen über Ende der Fahrzeugfertigung in Dresden nach. Stattdessen könnte Dresden zum reinen Auslieferungszentrum neben der Autostadt in Wolfsburg werden.
Cavallo sprach von einem „Masterplan, der die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens dauerhaft sicherstellt“. Einem Personalabbau verschließe man sich dabei nicht grundsätzlich. Er müsse aber sozialverträglich erfolgen. Und: Auch das Management solle auf Boni verzichten und in den geforderten Fonds zur Zukunftssicherung einbringen. „Die Probleme, die wir haben, sind nicht durch die Beschäftigten verursacht, die Probleme lassen sich nicht alle durch Arbeitskosten lösen“, sagte Gröger.
VW will Löhne kürzen
Das Gesamtkonzept will die IG Metall am Donnerstag bei der Tarifrunde „auf den Tisch legen“, kündigte Gröger an. Volkswagen fordert bisher eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent. Zudem stehen Werkschließungen und Personalabbau im Raum. „Jetzt hat es VW in der Hand, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen und zügige Lösungen zu ermöglichen“, sagte Gröger. „Andernfalls würde der Tarifpartner mutwillig eine Eskalation provozieren.“
Das wolle man vermeiden, fügte Gröger hinzu. Ziel sei es, bis Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. „Aber wir sagen ebenso klar: Die Belegschaft ist kampfbereit, die Vorbereitungen laufen.“ Die Friedenspflicht bei Volkswagen läuft noch bis Ende November. Ab 1. Dezember sind Warnstreiks möglich.
Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian sagte, das Unternehmen begrüße, dass die Arbeitnehmervertreter sich offen für Maßnahmen bei den Arbeitskosten und Kapazitätsanpassungen zeigten. Das unterstreiche, dass die Einschätzung der ernsten Lage der Kernmarke Volkswagen geteilt werde. VW werde die Vorschläge der Arbeitnehmer dahingehend prüfen, ob diese einen ausreichenden Beitrag zu den Einsparungen leisteten. „Für die Volkswagen AG steht unverändert die nachhaltige Erreichung des finanziellen Ziels und damit die Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Aus diesem Grund lassen sich Werksschließungen weiter nicht ausschließen.“
Volkswagen hatte sich Ende 2023 mit dem Betriebsrat auf ein 10 Mrd. Euro schweres Sparprogramm geeinigt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte, inzwischen habe sich das Sparziel auf 17 Mrd. Euro erhöht. Auch Finanzchef Arno Antlitz hatte bei der Vorlage der Quartalszahlen erklärt, dass höhere Einsparungen nötig seien, jedoch keine Zahl genannt. Zu schaffen machen dem Unternehmen unter anderem die schwächere Nachfrage nach Autos in Europa und die Flaute in China.